Die 6., umfassend neu bearbeitete, hochaktuelle Auflage des Lehrbuchs stellt das gesamte Völkerrecht dar, einschließlich der Bezüge zum Verfassungs- und Europarecht. Behandelt werden neben den Grundlagen (Entwicklung; Rechtsquellen; Völkerrechtsubjekte) die Menschenrechte, das Recht der Internationalen Organisationen, das der Staatenverantwortlichkeit, der Umwelt und der Wirtschaft sowie das humanitäre Völkerrecht.
Eckart Klein Bücher
6. April 1943
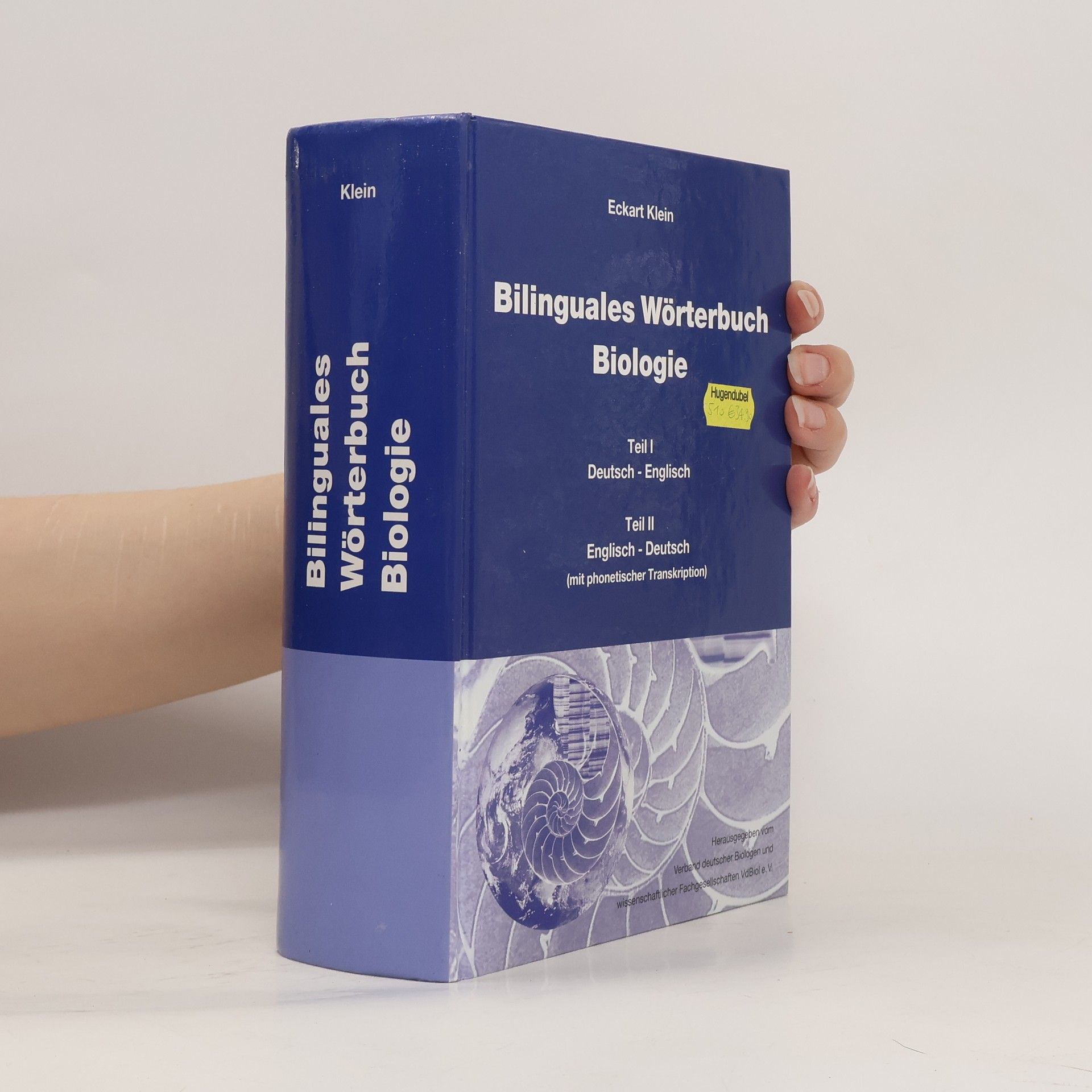
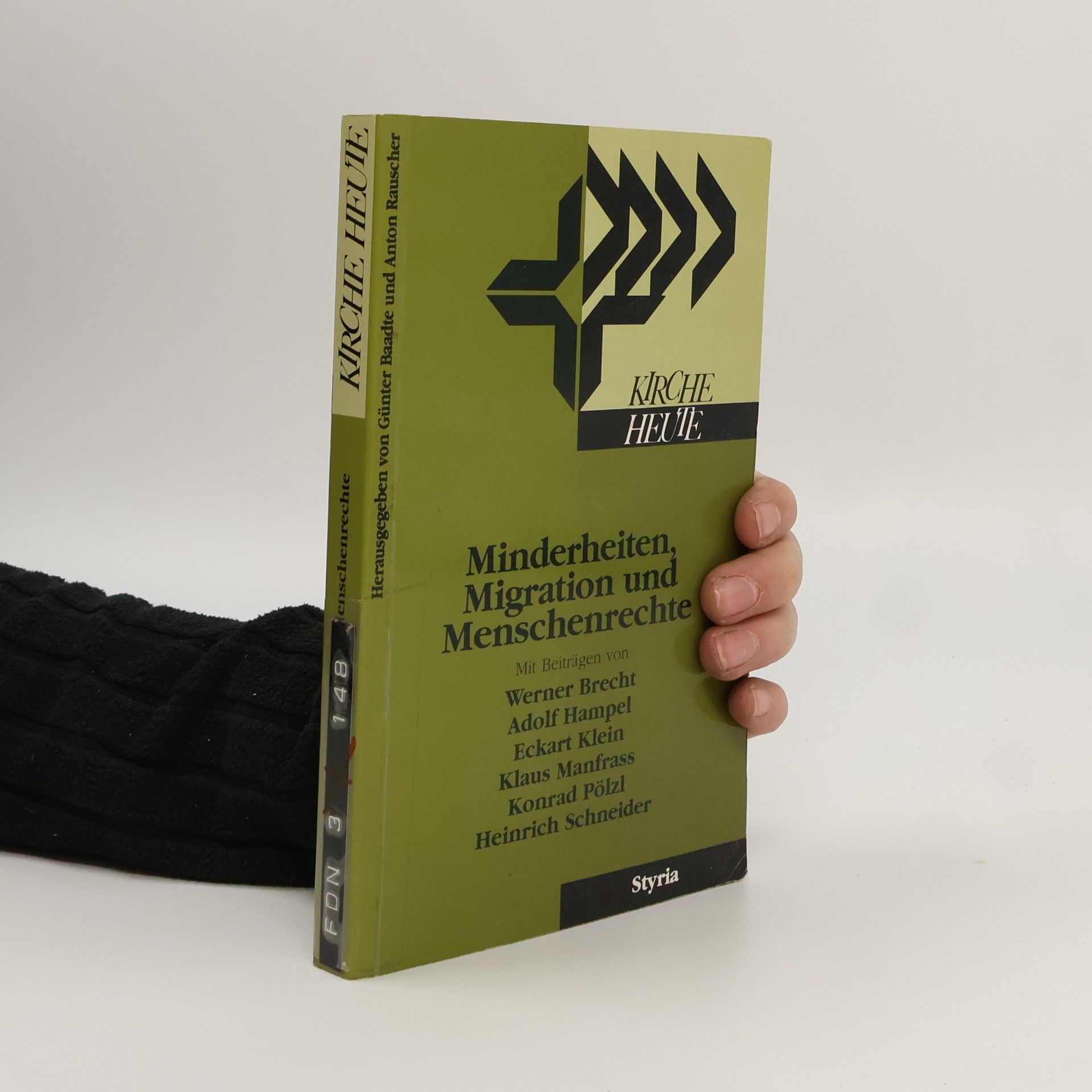
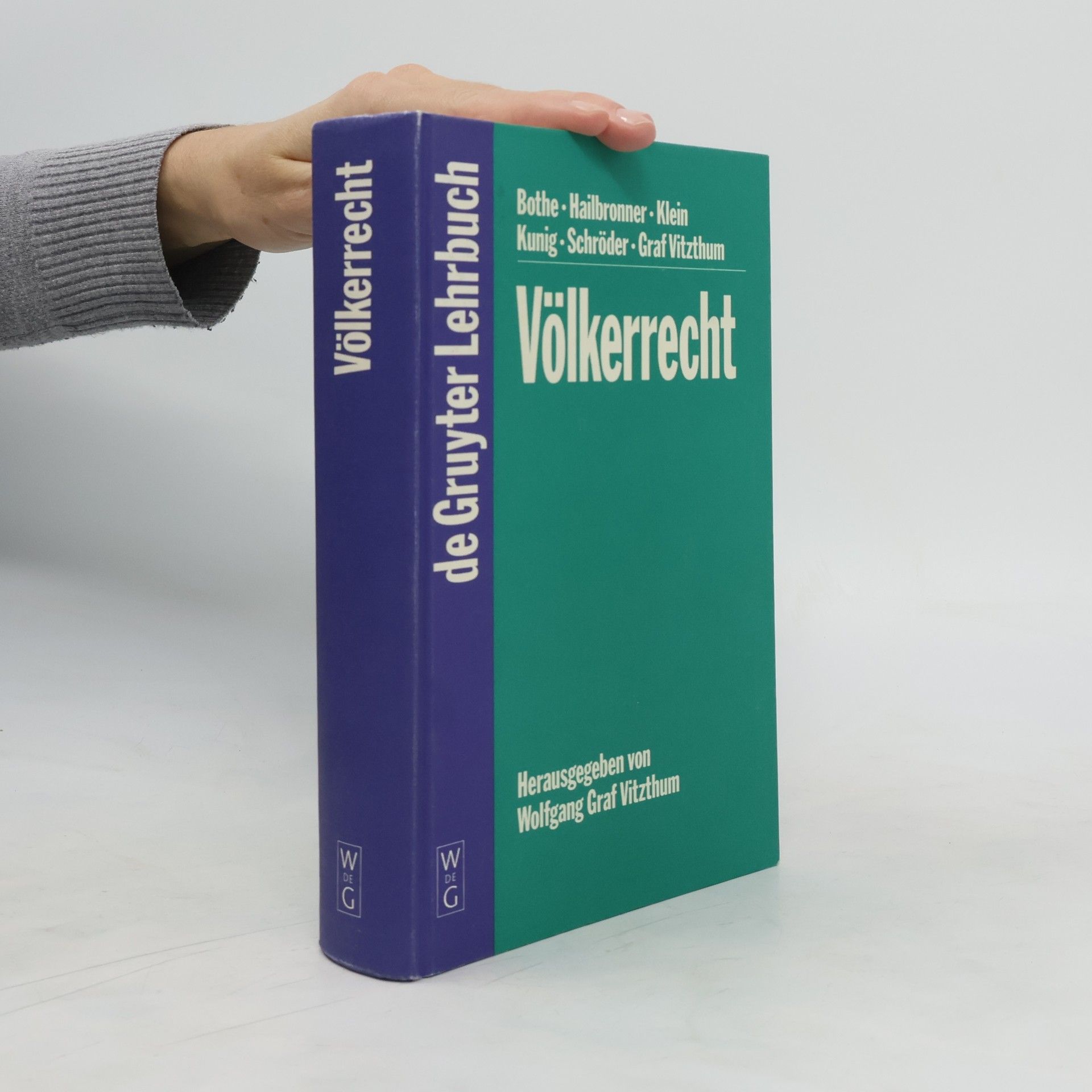
Kirche heute - 3: Minderheiten, Migration und Menschenrechte
- 186 Seiten
- 7 Lesestunden
Text: German
Bilinguales Fachwörterbuch zum Erlernen von biowissenschaftlichen Fachbegriffen auf Deutsch und Englisch. Eher eine Enzyklopädie als ein reines Wörterbuch, mit Ausspracheregeln für die englischen Fachbegriffe.