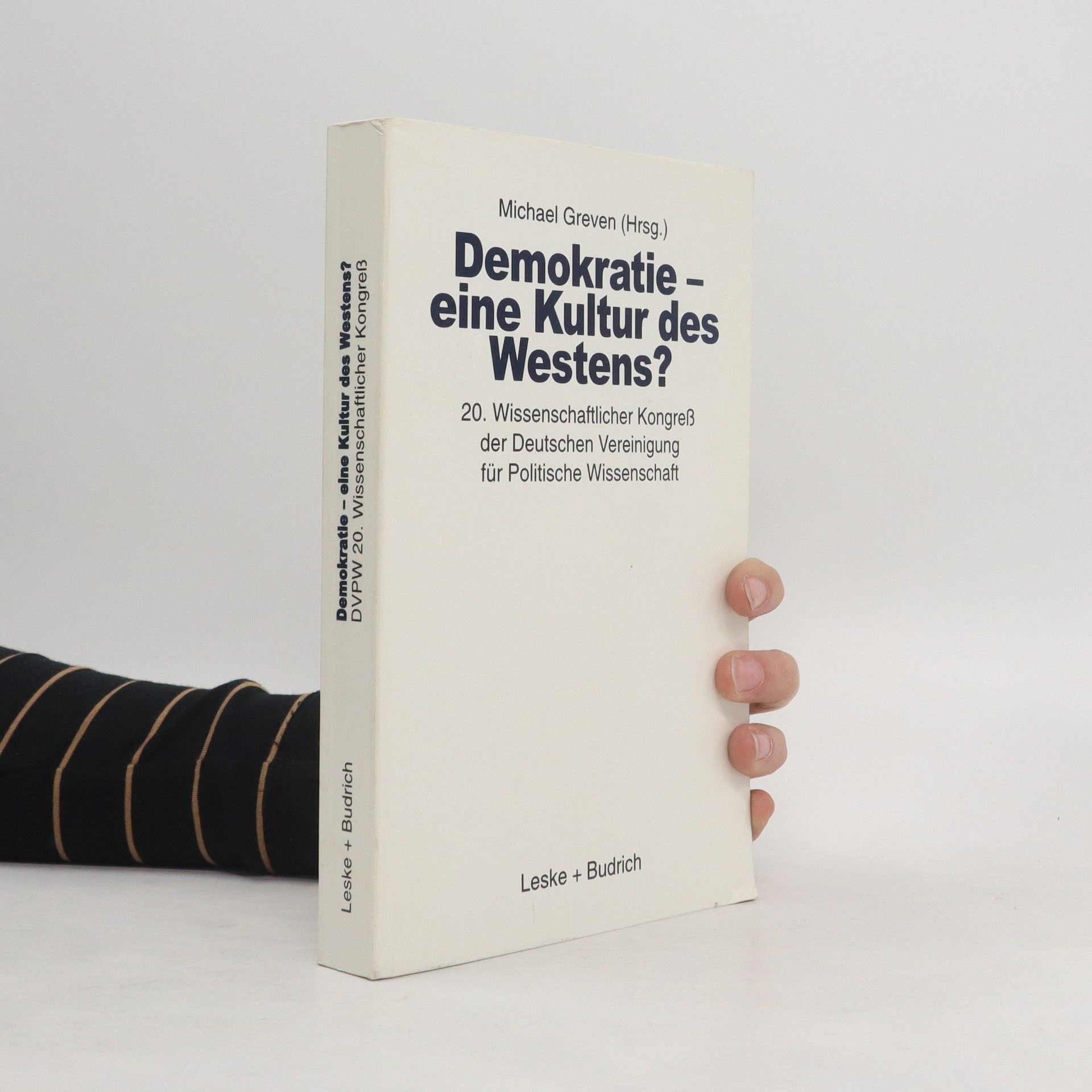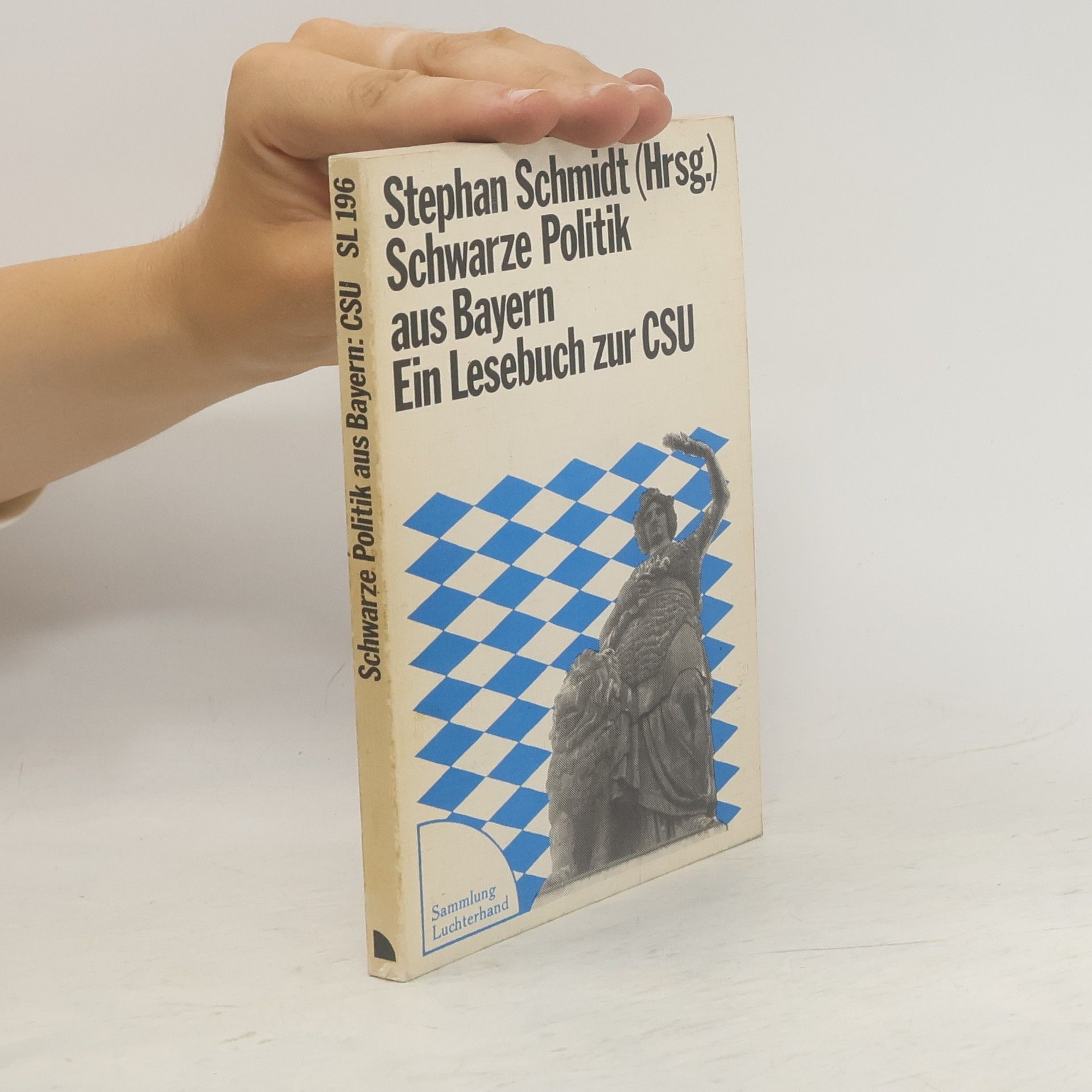Der Krieg in der Nachkriegszeit
- 369 Seiten
- 13 Lesestunden
In diesem Buch untersuchen bekannte WissenschaftlerInnen aus verschiedenen Disziplinen die Verarbeitung oder Verdrängung der Kriegserfahrung in der deutschen Nachkriegsgesellschaft. Ein Teil der Beiträge befasst sich mit der jüngsten Kontroverse um Wehrmachtsverbrechen, ausgelöst durch die Ausstellung „Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944“. Basierend auf dem aktuellen Forschungsstand werden Verdrängung und Thematisierung der Kriegserfahrung in den verschiedensten Bereichen der deutschen Nachkriegsgesellschaft von der Geschichtswissenschaft bis zur Bundeswehr, in Filmen, der Presse und der Literatur behandelt.