Hans Günther Homfeldt Bücher
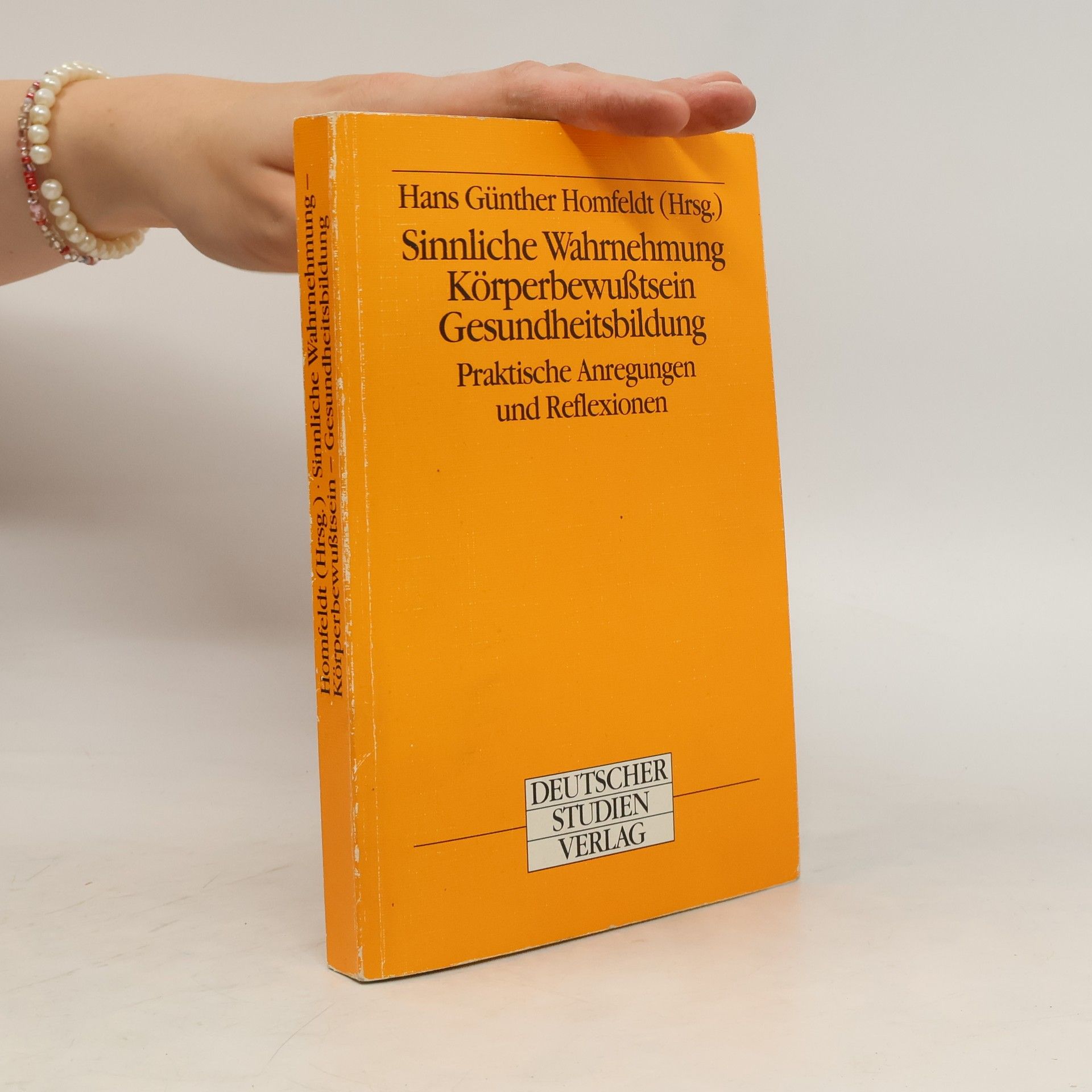
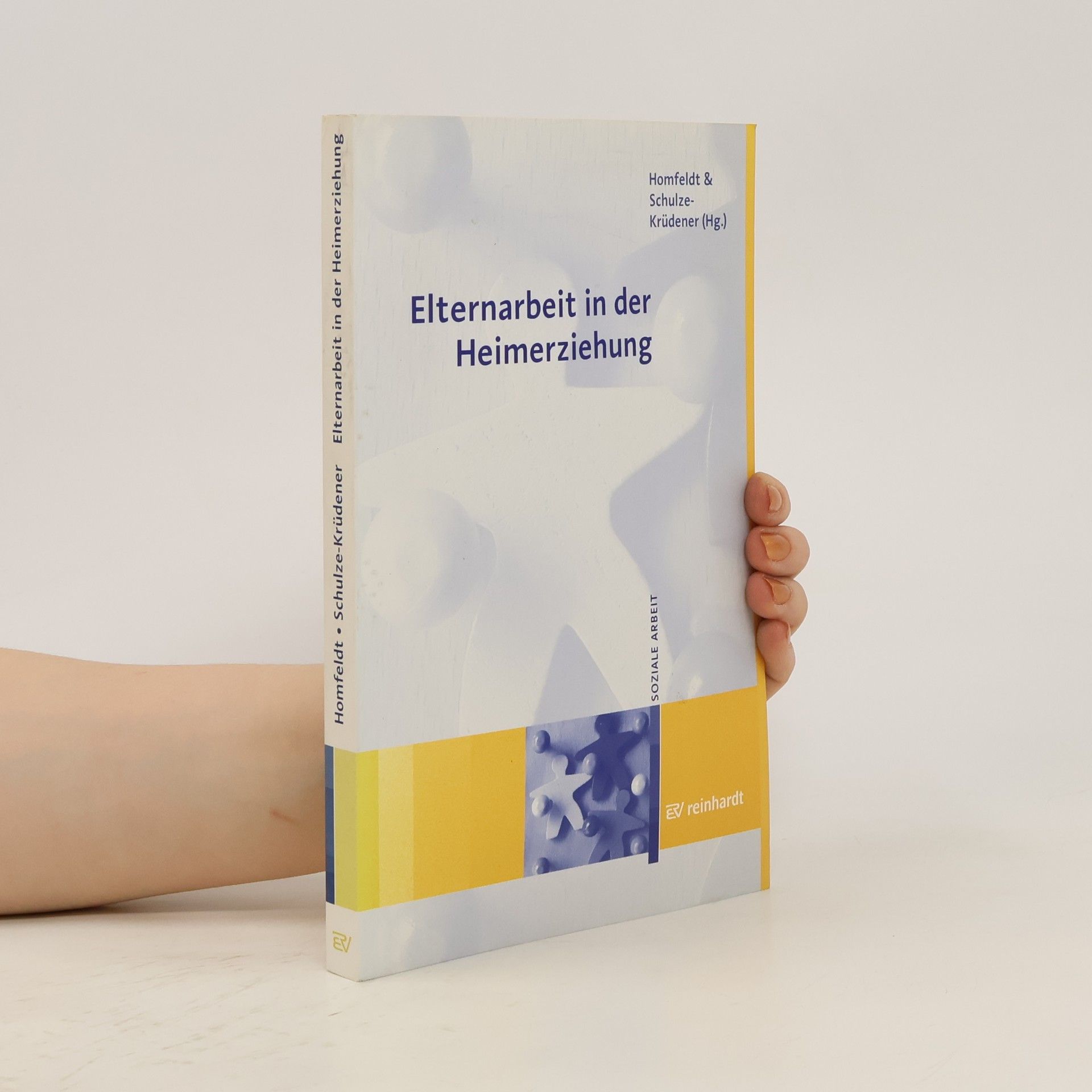

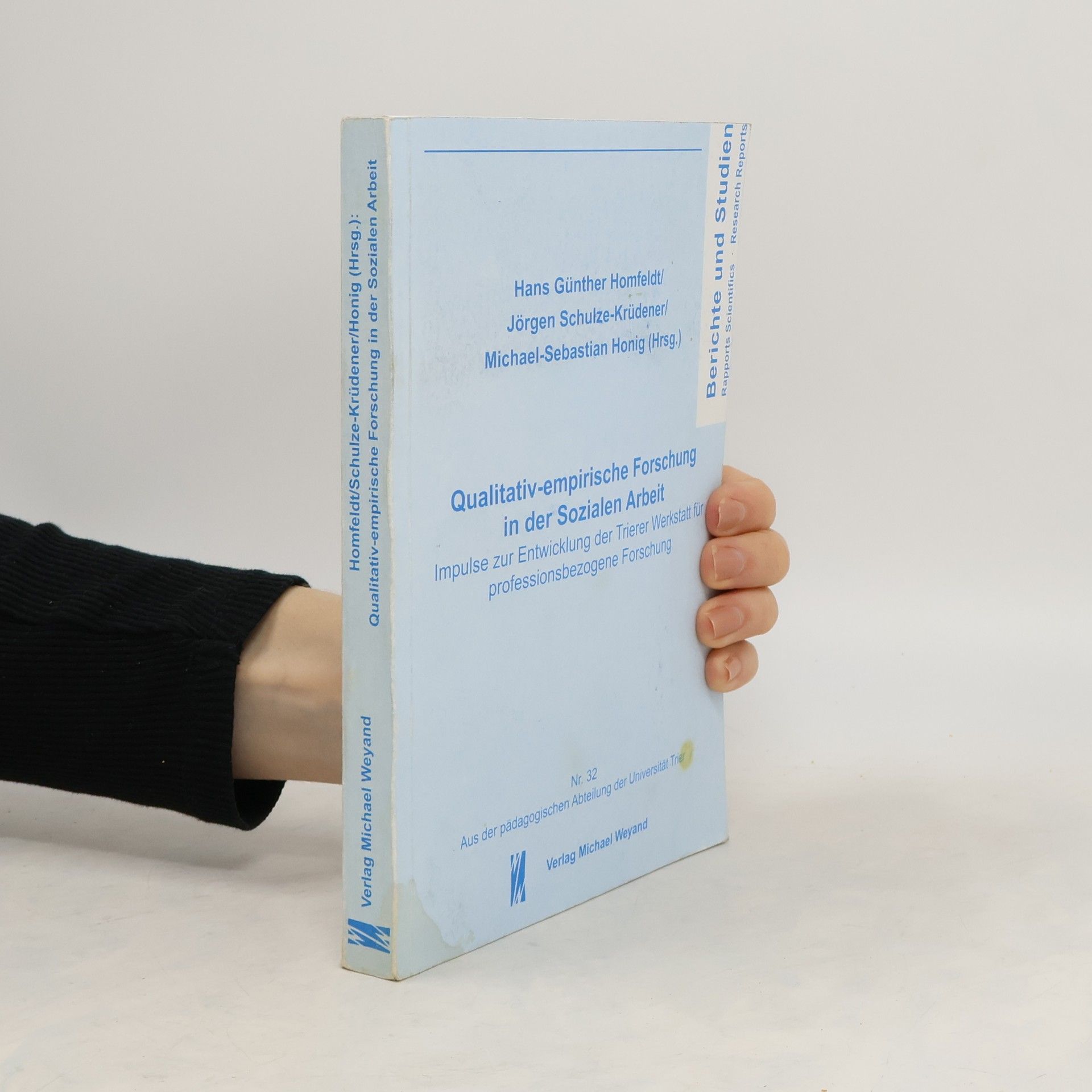

Vorlage für die Beiträge dieses Bandes sind Vorträge an der Universität Trier gewesen. Die Herausgeber erhielten durch sie in den Jahren 1997 bis 1999 in grundsätzlicher, aber auch in beispielbezogener Hinsicht Entwicklungsimpulse für ihre im Aufbau befindliche Werkstatt für professionsbezogene Forschung im Fach Pädagogik. Die Werkstatt will Anstöße geben für eine stärkere Forschungsorientierung des Lehrangebots und interessierten Studierenden des Hauptstudiums Chancen eröffnen, zu Koproduzenten/-innen wissenschaftlichen Arbeitens zu werden. Der vorliegende Band kann dafür – so hoffen die Herausgeber – Begründungen und Anregungen liefern.
In diesem Band 1 kommen Vertreter und Vertreterinnen aus Profession und Disziplin zu Wort, die zu unterschiedlichen Zeiten nach 1945 einen nachhaltigen Einfluß auf die Gestaltung der Sozialen Arbeit genommen haben. Die Beiträge beziehen sich auf drei zentra le Bereiche Sozialer Arbeit: Theoriebildung, Professionalisierung/Ausbildung sowie Methodenentwicklung. Die Autoren und Autorinnen plazieren die Reflexion als Zeitzeugen innerhalb ihres jeweiligen berufsbiographischen Kontextes: für die Zeit des Aufbruchs (reeducation, Institutionalisierung): K. Mollenhauer, C. W. Müller, H. Pfaffenberger, K. Rawiel, H. Schiller; für die Zeit des Umbruchs (Politisierung): S. Müller, D. Oelschlägel, H.-U. Otto, H. Thiersch; für die Zeit der Konsolidierung (Verwissenschaftlichung): E. Engelke, F. Hamburger, R. Merten, U. Uhlendorff und W. R. Wendt. Spannungslinien und Konträrpositionen der Zeitzeugen werden in fünf dialogischen Reflexionen nachempfunden.
Wenn Kinder in einem Heim untergebracht werden müssen, gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Jugendamt oder Heim oft schwierig. Wie können Eltern in die Arbeit des Heims einbezogen werden? Welche Methoden haben sich als besonders erfolgversprechend erwiesen? Wie geht man mit schwer erreichbaren Eltern um? Kann man bei knappen personellen Ressourcen eine professionelle Elternarbeit gewährleisten? Die AutorInnen geben praktische Antworten auf diese Fragen und stellen darüber hinaus Neues aus Forschung und Wissenschaft zum Thema vor. Das Buch hilft Fachkräften auf dem Weg, die Praxis der Elternarbeit im Heim weiter zu verbessern.