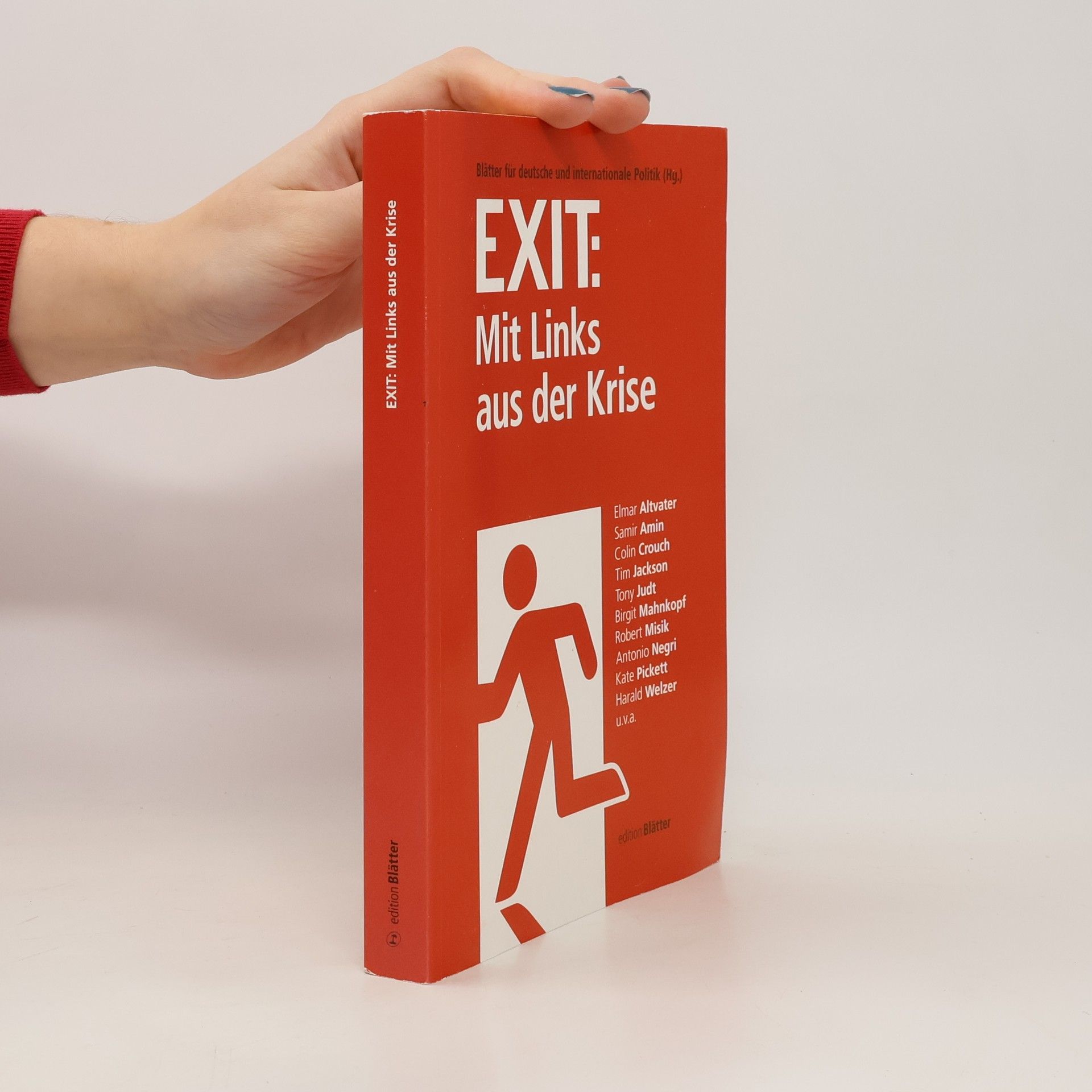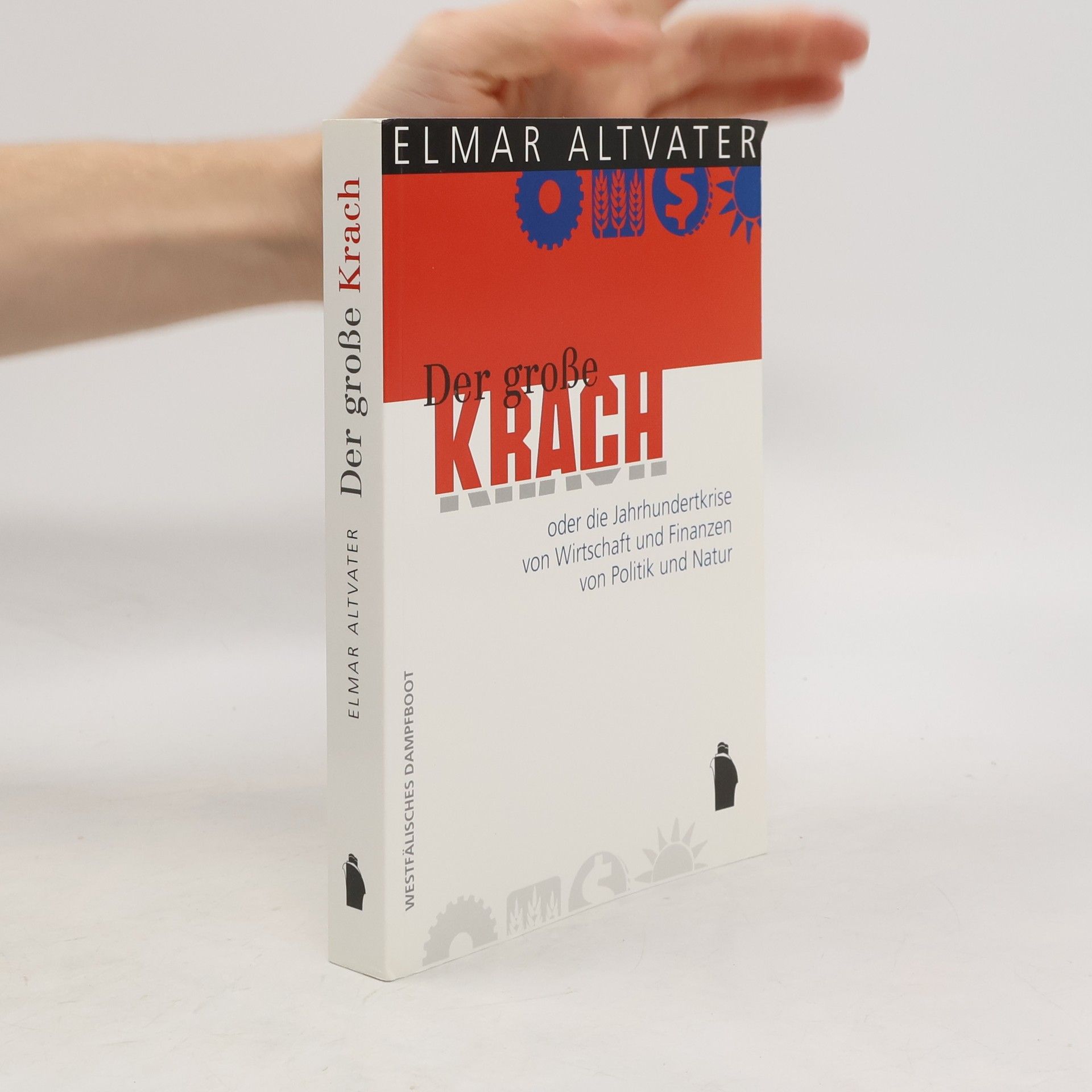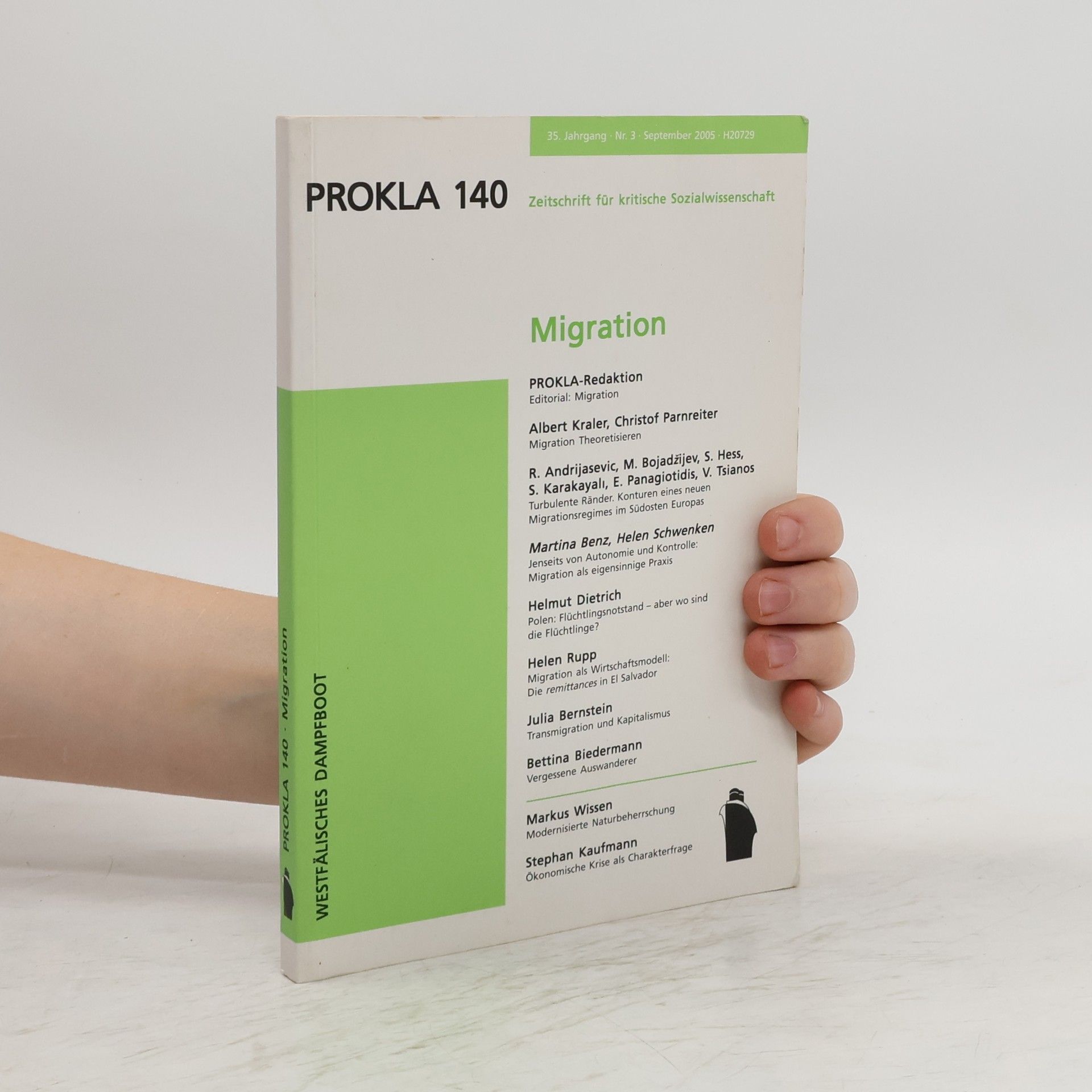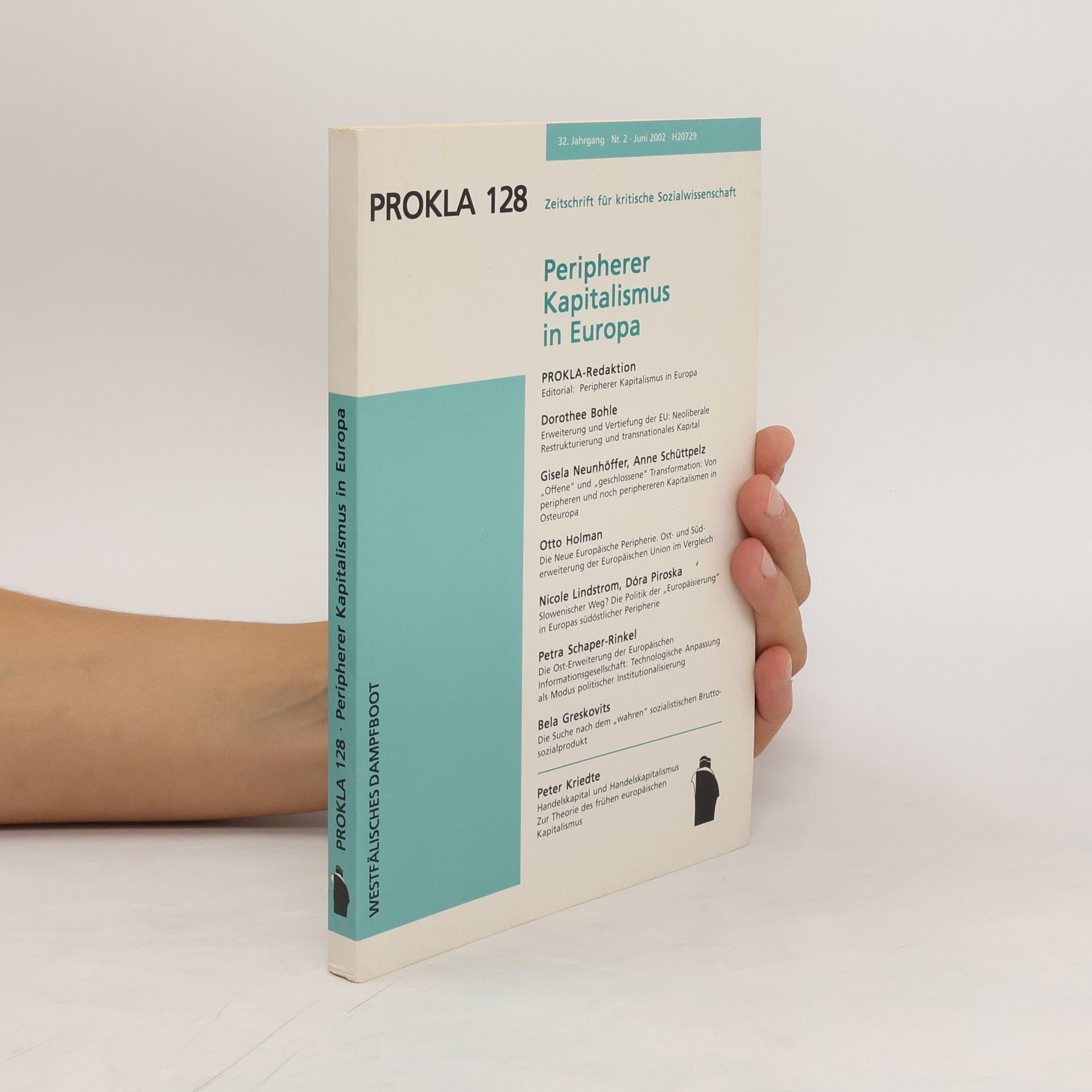Im Jubiläumsjahr von Friedrich Engels' 200. Geburtstag wird seine Kritik am Verhältnis von Gesellschaft und Natur hervorgehoben. Engels' Einsichten zur kapitalistischen Dynamik und deren Auswirkungen auf das Klima sind heute besonders relevant. Als Weggefährte von Marx spielte er eine entscheidende Rolle in der Arbeiterbewegung und unterstützte maßgeblich die Veröffentlichung von „Das Kapital“.
Elmar Altvater Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
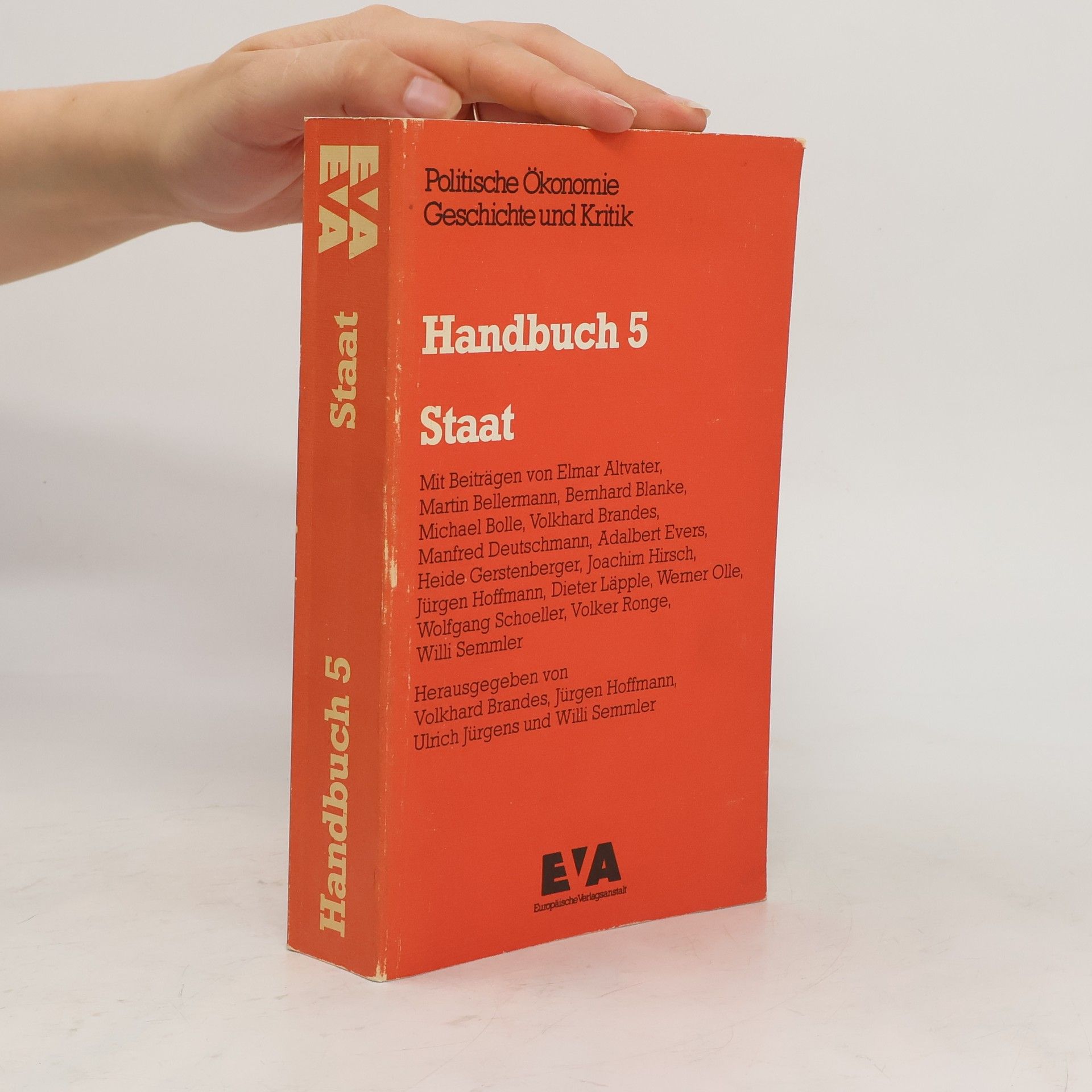
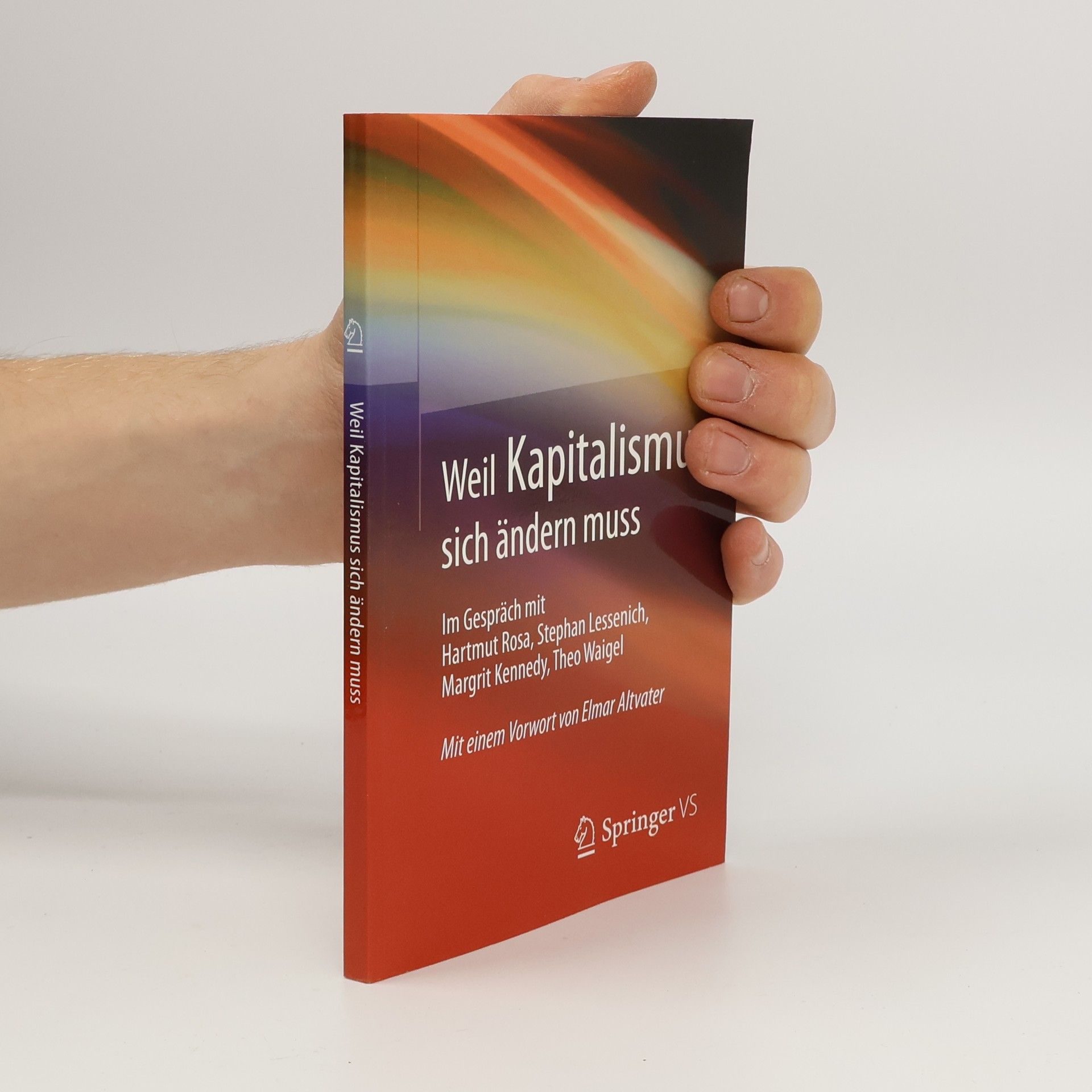
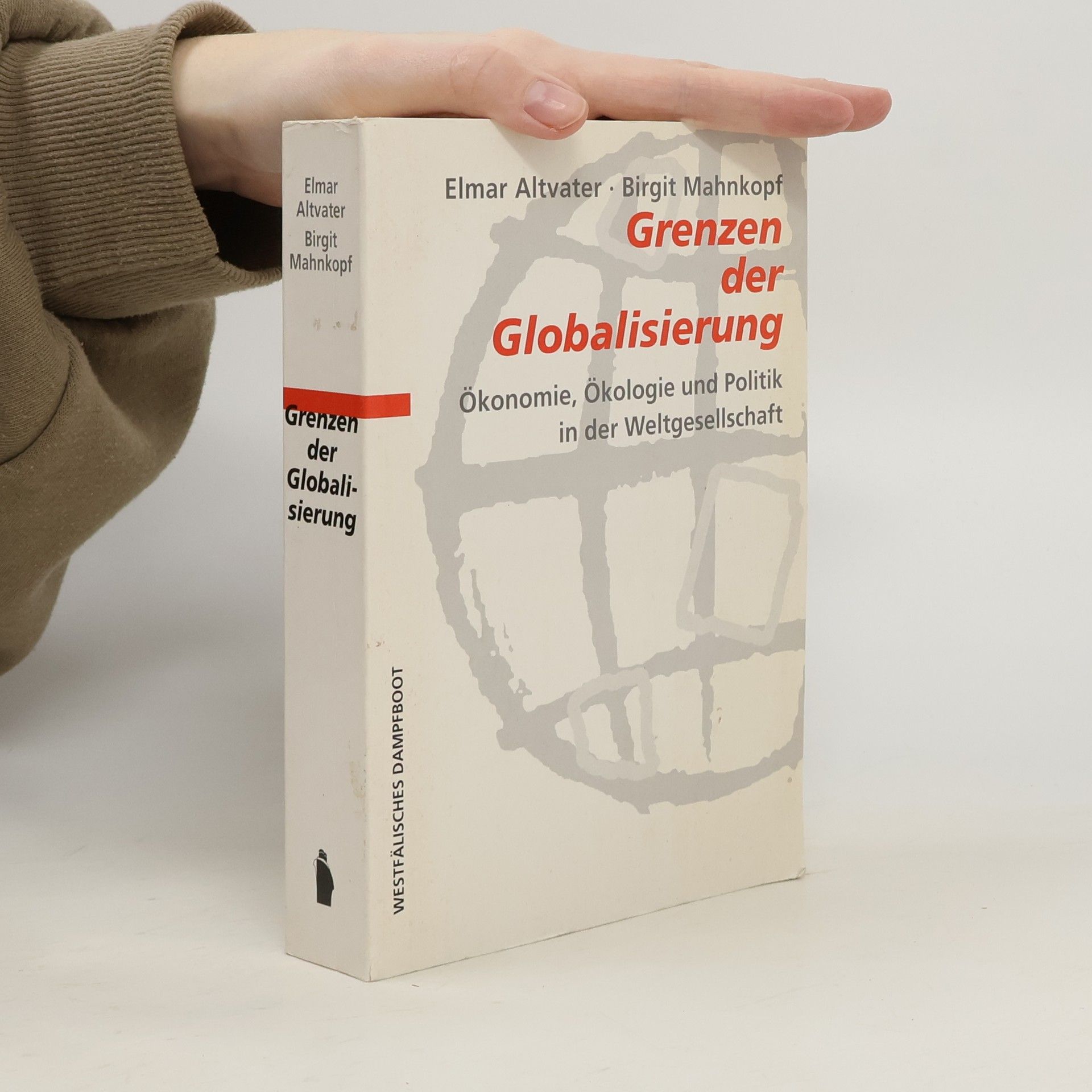
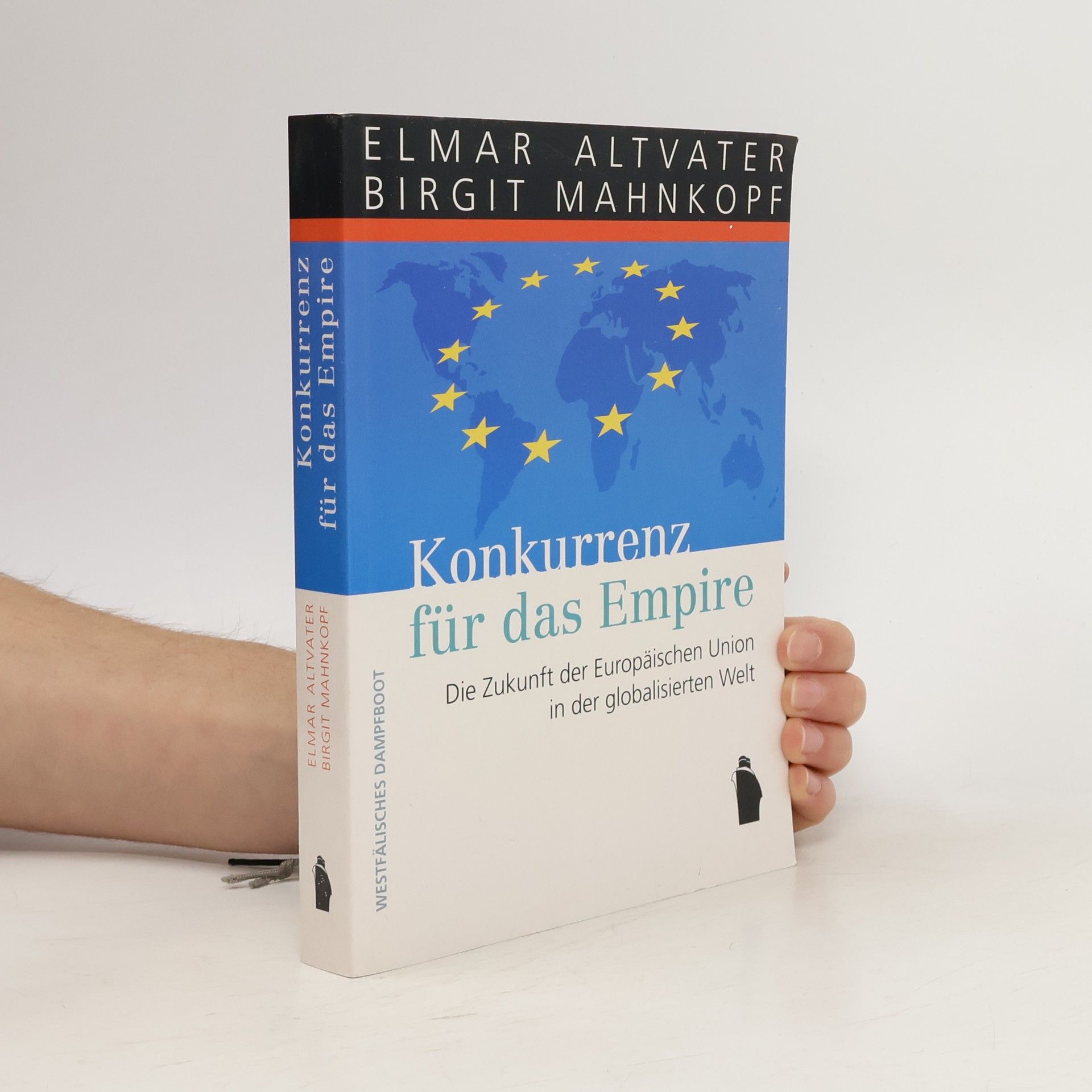
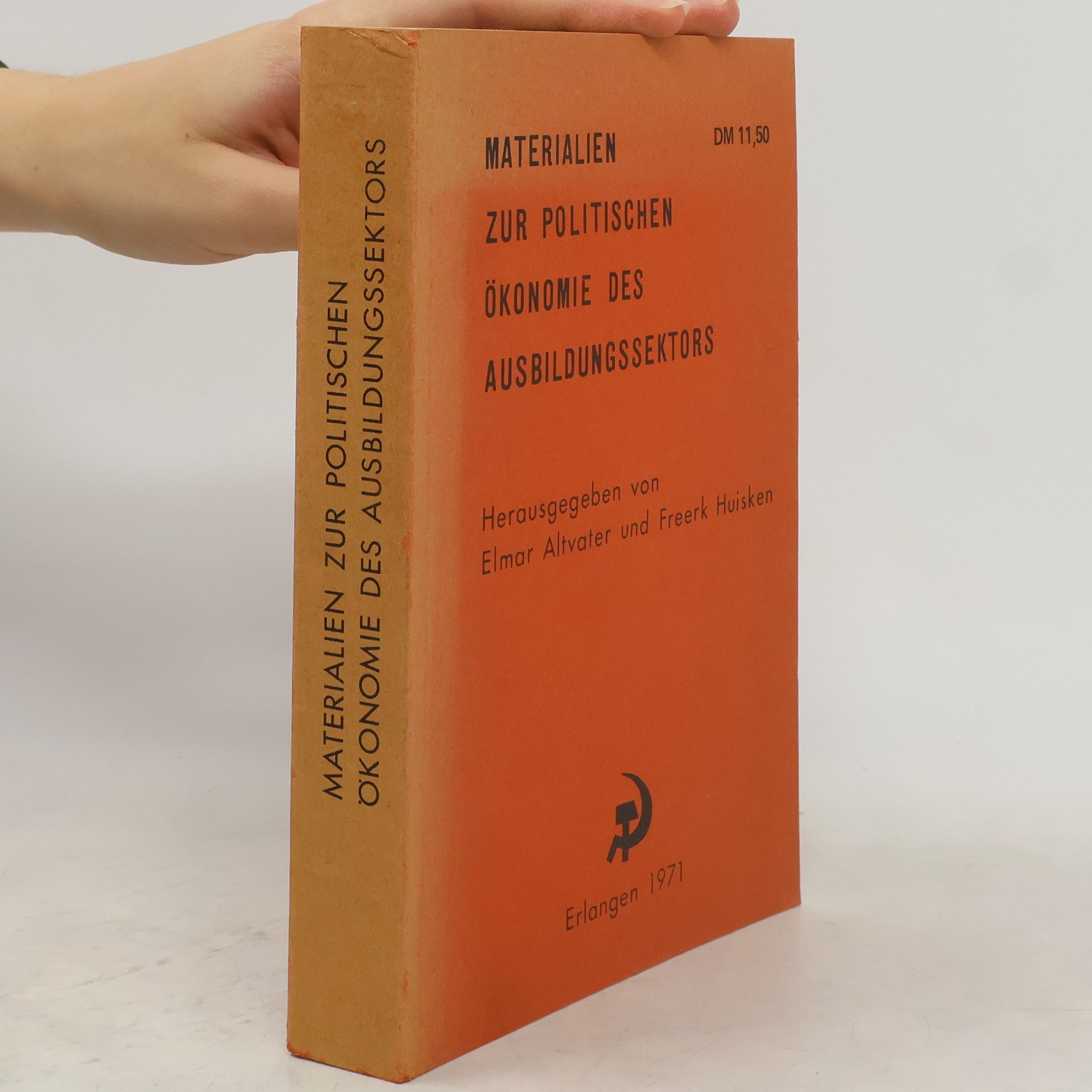
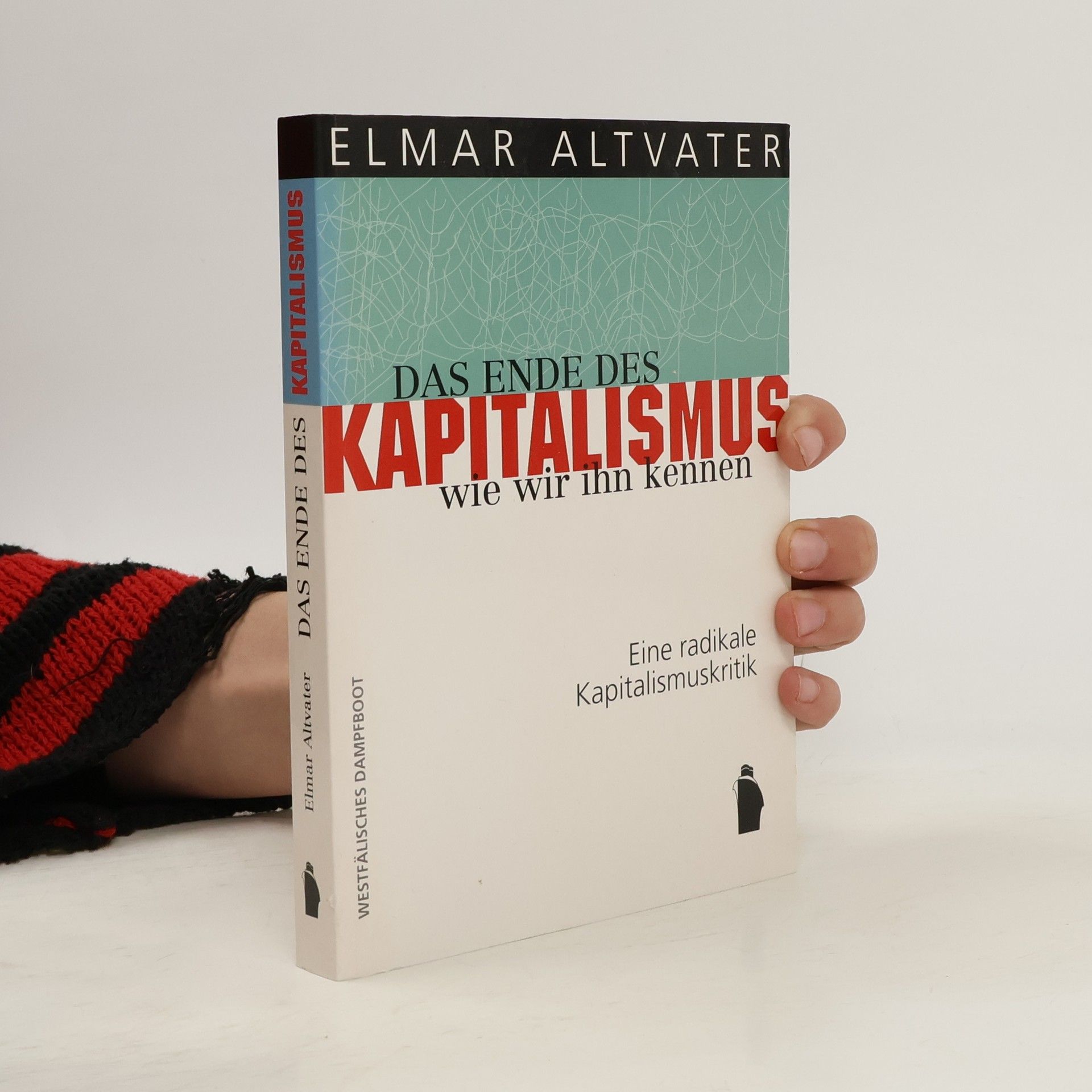
Demokratie oder Kapitalismus?: Europa in der Krise
- 288 Seiten
- 11 Lesestunden
Weil Kapitalismus sich ändern muss
- 137 Seiten
- 5 Lesestunden
Die Kritik am Kapitalismus hat spätestens mit der Finanz- und Wirtschaftskrise eine Renaissance erfahren. Gibt es Grenzen des ökonomischen Wachstums? Sind kontrollierte Kapitalmärkte, ein gerechteres Steuersystem oder die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens darauf gerechte Antworten? Diese und andere Fragen diskutieren die Sozialwissenschaftler Hartmut Rosa und Stephan Lessenich, die Währungsexpertin Margrit Kennedy und der Politiker Theo Waigel. Eingeleitet werden die Interviews mit einem Kommentar des Politikwissenschaftlers und Kapitalismuskritikers Elmar Altvater.
Exit: mit Links aus der Krise
- 283 Seiten
- 10 Lesestunden
Seit dem Crash von Lehman Brothers im September 2008 hat sich die Welt radikal verändert. Was als Finanzkrise begann, hat sich längst zu einer Staats- und Demokratiekrise ausgeweitet. Wie aber ist dieser Krise zu begegnen? Wie sehen wirksame politische Alternativen zum realexistierenden Kapitalismus aus? Mit 'Blätter'-Beiträgen von: Elmar Altvater, Samir Amin, Colin Crouch, Tim Jackson, Tony Judt, Claus Leggewie, Birgit Mahnkopf, Robert Misik, Antonio Negri, Kate Pickett, Harald Welzer u. v. a.
Der große Krach oder die Jahrhundertkrise von Wirtschaft und Finanzen, von Politik und Natur
- 261 Seiten
- 10 Lesestunden
Den einen ist sie die schwerste Finanz- und Wirtschaftskrise in der Geschichte des Kapitalismus, anderen gilt sie inzwischen nur noch als fast schon überwundene „Rezession“, nach der man wieder das tun kann, was man vor der Krise getan hat und wodurch diese bewirkt wurde. Die CDU-FDP-Bundesregierung signalisiert, wie es geht: Die Banken unterstützen, den Reichen Steuern ersparen, Arme belasten. Elmar Altvater bezieht sich zwar präzise auf die empirisch sichtbaren Verlaufsweisen dieser „Finanzmarktkrise“ und den politischen Umgang mit ihr, aber er gibt sich nicht mit dem Augenschein zufrieden. In Kenntnis der bisherigen Literatur, die sich allzu häufig mit der reinen Abschilderung von Phänomenen begnügte, entschlüsselt er in bekannt souveräner Weise die Ursachen dieser Krise. Diese umfasst sehr viel mehr als nur den Finanzsektor oder die Finanzspekulationen, sie betrifft in ihren Auswirkungen Arbeit und Geld, Energie, Klima und Ernährung und kommt letztlich aus dem Zentrum heutiger Gesellschaften.
Krisen Analysen
- 145 Seiten
- 6 Lesestunden
Konkurrenz für das Empire
Die Zukunft der Europäischen Union in der globalisierten Welt
- 304 Seiten
- 11 Lesestunden
Libro usado en buenas condiciones, por su antiguedad podria contener señales normales de uso
Das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen
Eine radikale Kapitalismuskritik
- 240 Seiten
- 9 Lesestunden
Anders als der reale Sozialismus bricht der Kapitalismus nicht zusammen - es sei denn durch „äußere Anstöße von extremer Heftigkeit“ und eine „glaubwürdige Alternative im Innern“. Dieser Einschätzung des französischen Historikers Fernand Braudel folgt Elmar Altvater in seinem nunmehr in siebter Auflage erschienenen Buch. Die Dynamik der modernen Gesellschaften verdankt sich der „Dreifaltigkeit“ von europäischer Rationalität der Weltbeherrschung, kapitalistischen sozialen Formen und fossilen Energien. Dies ist die Grundlage der „geo-ökonomischen“ Globalisierung und des „geopolitischen“ neuen Imperialismus, einer Allianz von marktgläubigem Neoliberalismus und auf militärische Macht setzendem Neokonservativismus. Doch ist der Kapitalismus nicht stabil und krisenfrei. Die Finanzkrisen der vergangenen Jahrzehnte sind für wachsende Ungleichheit, ja für Armut und Elend in der Welt verantwortlich. Dass die Begrenztheit von fossiler und nuklearer Energie ein äußerer Anstoß von besonderer Heftigkeit ist, haben die Hurrikane Katrina und Rita zu Bewusstsein gebracht: Eine kapitalistische Gesellschaft ohne Öl versinkt im Chaos. Im Innern der Gesellschaft reifen aber „glaubwürdige Alternativen“ heran: Die Ansätze einer „solidarischen Ökonomie“ und ökologisch nachhaltigen Gesellschaft. Der Kapitalismus, wie wir ihn kennen, gerät an ein Ende.
Globale Ungleichheiten
- 316 Seiten
- 12 Lesestunden
In diesem Band sollen die unterschiedlichen Weisen untersucht werden, in denen soziale Ungleichheiten in den Medien und den sich verändernden Formen der Alltagskultur kodiert und reproduziert werden. Zugleich soll es aber auch um die verschiedenen Formen der Subversion solcher Mechanismen gehen, wie etwa den Versuchen oppositioneller Bewegungen sich für ihre politische Arbeit Aspekte der globalen Kulturindustrie kritisch anzueignen. Inhalt: - Kapitalismus(kritik) und Ungleichheit - Ein Nachruf von Theotonio dos Santos - Das eindundzwanzigste Jahrhundert wird ein Asiatisches sein - Über die Gründe global zunehmender Armut und Ungleichheit -- oder warum der "Matthäus Effekt" (dem der hat, dem wird gegeben) vorherrscht - Von der Ungleichheit des globalen Naturverbrauchs - Die Rolle des internationalen Finanzsystems bei der Inwertsetzung, Zerstörung und Umverteilung der natürlichen Ressourcen des Südens - Wie nationale Souveränität zu Markte getragen wird - Die Europäische Union: eine neue Supermacht mit imperialen Ambitionen? - Auf dem Weg zur finalen Krise des Kapitalismus? Weltsystemtheoretische Beiträge zur neuen Debatte um Imperialismus - Was für eine Europäische Verfassung? - Gegen diesen EU Verfassungsvertrag - Die Wiederkehr des Verdrängten am Beispiel des Ekels. Zum Betrachten der Folterbilder aus Abu Ghraib.
Peripherer Kapitalismus in Europa
- 162 Seiten
- 6 Lesestunden