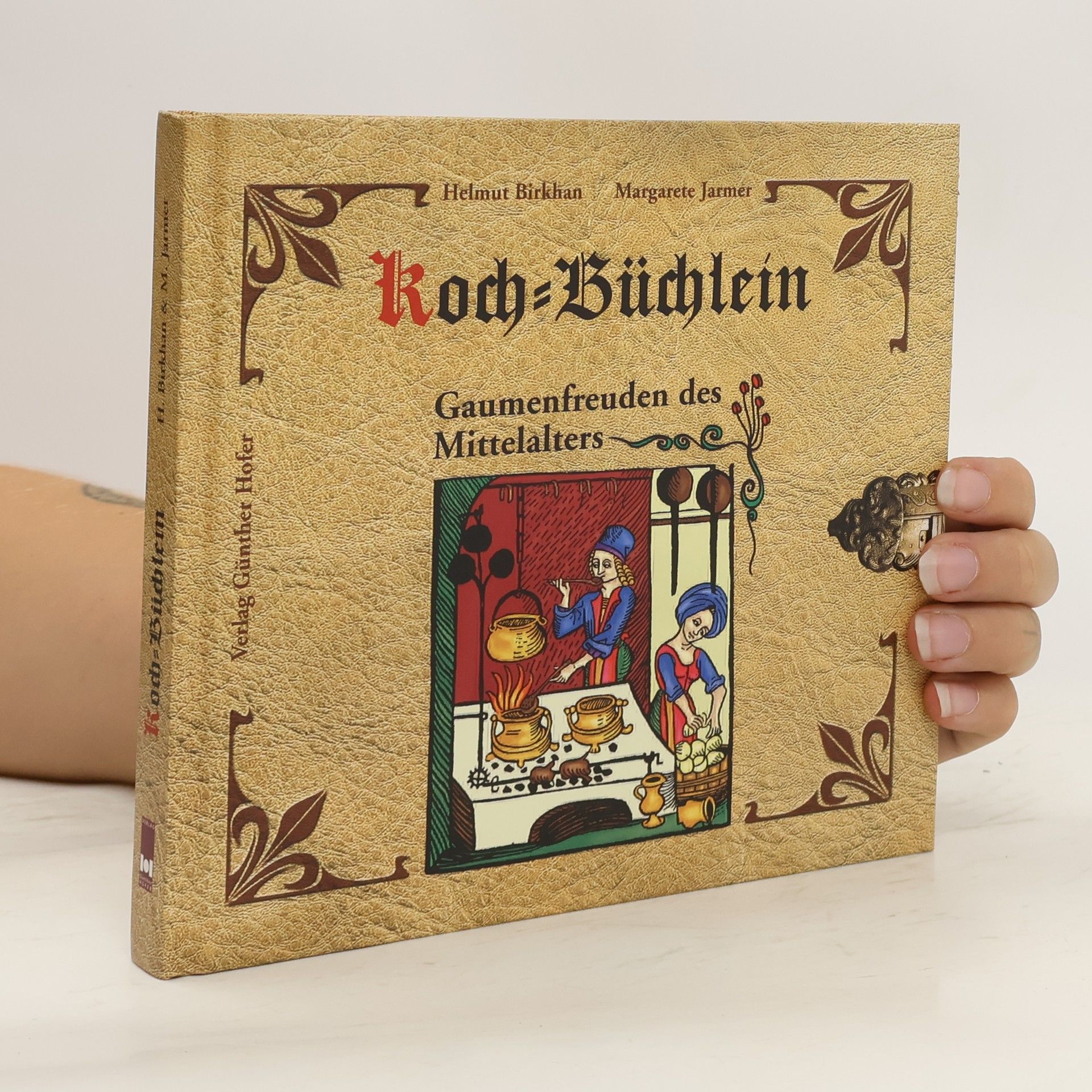Mit diesem Werk legt Helmut Birkhan, Professor an der Universität Wien, ein großes Standardwerk über die altkeltische Kultur vor, das Keltenforscher ebenso interessieren wird wie Keltenfreunde. Es weicht so umstrittenen Fragen wie jenen nach der Herkunft der Kelten und dem keltischen Matriarchat nicht aus und behandelt alle Bereiche der keltischen Kultur in einer umfassenden Gesamtdarstellung.
Helmut Birkhan Bücher


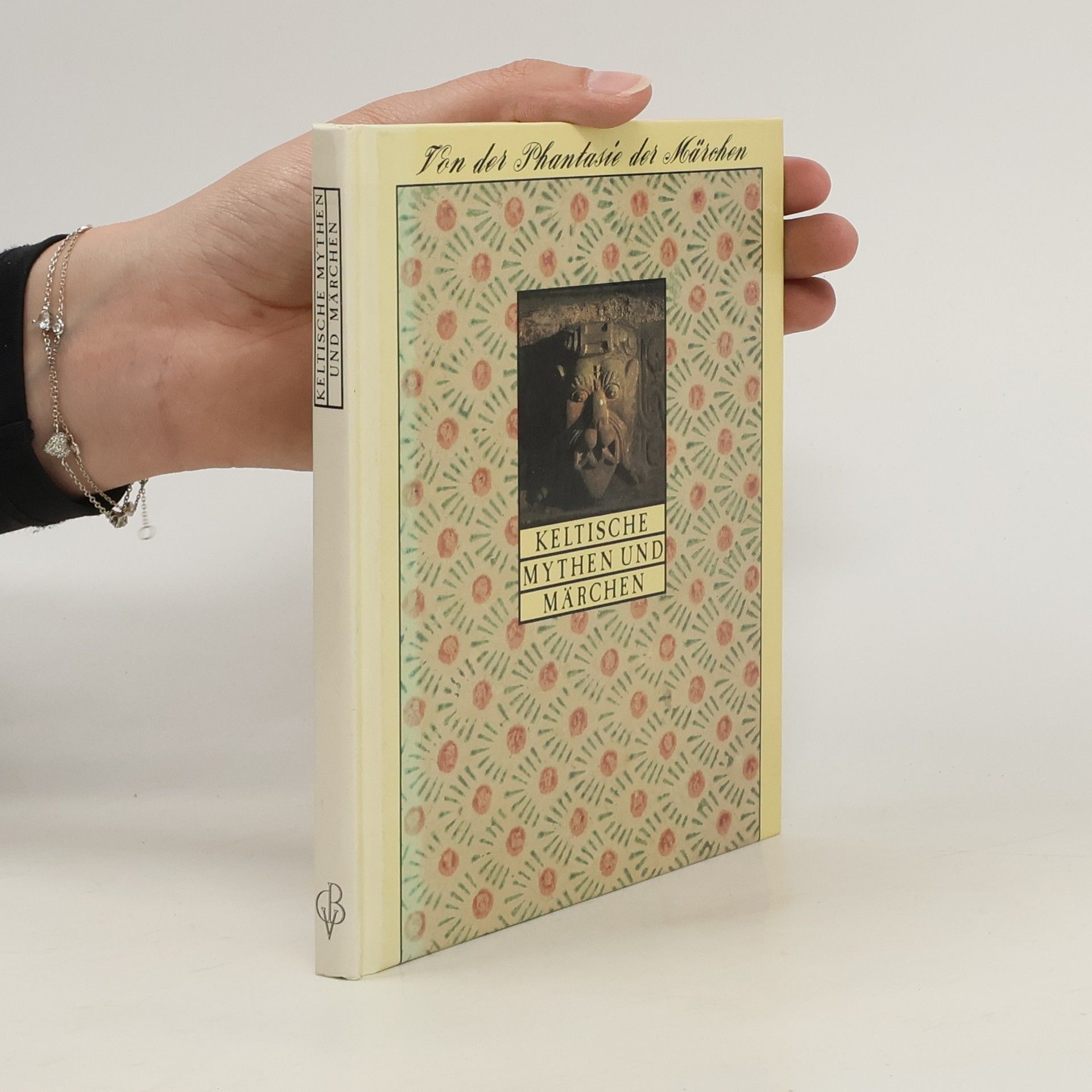

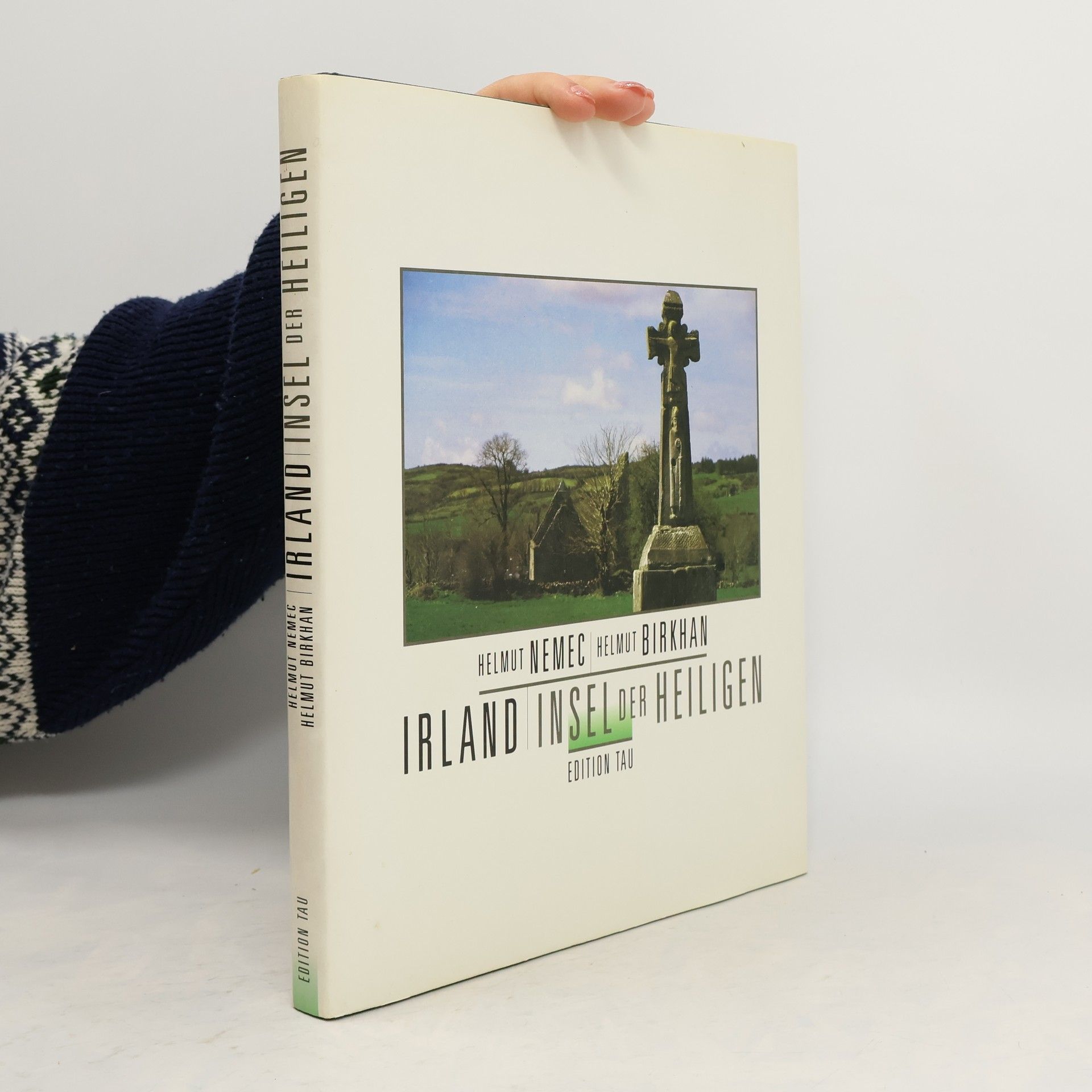
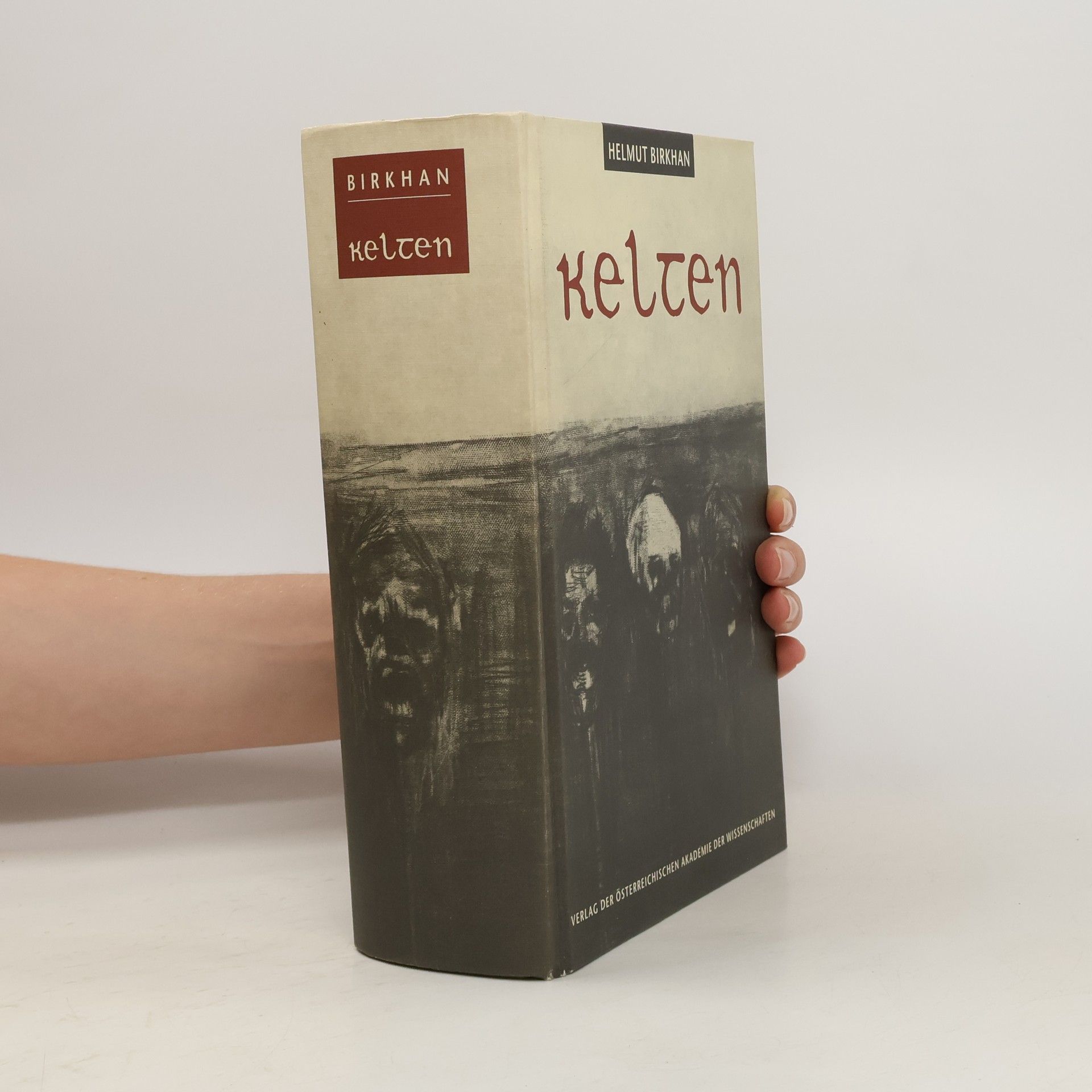
Hrsg. von Helmut Birkhan, mit 16 Farbphotographien von Helmut Nemec. Das Buch umfasst 96 Seiten und thematisiert die Phantasie der Märchen.
Die Kelten gelten heute oft als ebenso geheimnisvolles Barbarenvolk Alteuropas, das man gerne als die eigenen Ahnen ansieht. Sehr oft verbindet man sie auch mit einem ganz speziellen, angeblich sehr naturnahen Geheimwissen. Das Buch untersucht die allfälligen kulturellen und historischen Spuren dieses Geheimwissens, dessen Träger im Altertum der Priesterstand der Druiden war. Als das Druidentum mit der Christianisierung obsolet wurde, erscheinen vor allem die Barden als Verwalter geheimen Wissens, das sich besonders in Wales geradezu zu einer Art Bardenideologie und -theologie entwickelte. Diese leben bis heute in nationalwalisischen Veranstaltungen, bei denen dann auch wieder »Druiden« als historistische Reminiszenz auftreten, aber auch in bestimmten Freimaurerorden weiter.
Kindheit in Wien
Weltkriegs- und Nachkriegszeit aus Kindersicht
Die Stimmen verstummen zunehmend, die noch von der Kindheit in den 1940ern und 1950ern erzählen können. In seinen Kindheitserinnerungen nimmt uns Helmut Birkhan, langjähriger Mittelalterforscher an der Universität Wien, erfahrener Autor und sprachkundiger Erzähler, mit auf eine Zeitreise in diese verblassende Welt im Innersten Österreichs. Kindheit in Wien ist mehr als ein Erinnerungsbuch, es ist ein buntes Gemälde der Lebenswelt unserer Großeltern, ganz ohne Wehmut und Idyllenton, dafür voller Sachkenntnis und Phantasie. Wenn Birkhan den Staub von lange vergessenen Begriffen bläst, dann erwachen der Kohlenklau zu neuem Leben und der Fetzentandler, die Stosuppe, der Fleckerlwalzer und das Ramasuri.
Magie im Mittelalter
- 204 Seiten
- 8 Lesestunden
Mal durch einen Heilzauber – der uns in diesem Fall in den Merseburger Zaubersprüchen erhalten geblieben ist –, mal durch einen Wetter- oder Schadenszauber, aber auch mit Hilfe noch ganz anderer magischer Methoden haben die Menschen im Mittelalter und der frühen Neuzeit versucht, ihr eigenes Leben, ihre Mitmenschen und ihre Welt zu beeinflussen. Helmut Birkhan hat ein spannendes Buch über magische Praxis und ihre Denkvoraussetzungen geschrieben, in dem er anhand zahlreicher konkreter Beispiele die Welt der Zauberer und Hexen wieder lebendig werden lässt und auch die Einstellung, Ängste und Reaktionen ihrer Zeitgenossen beschreibt.