Religion im Spannungsfeld zwischen Glauben und Wissen
Eine interkulturelle und interreligiöse Perspektive

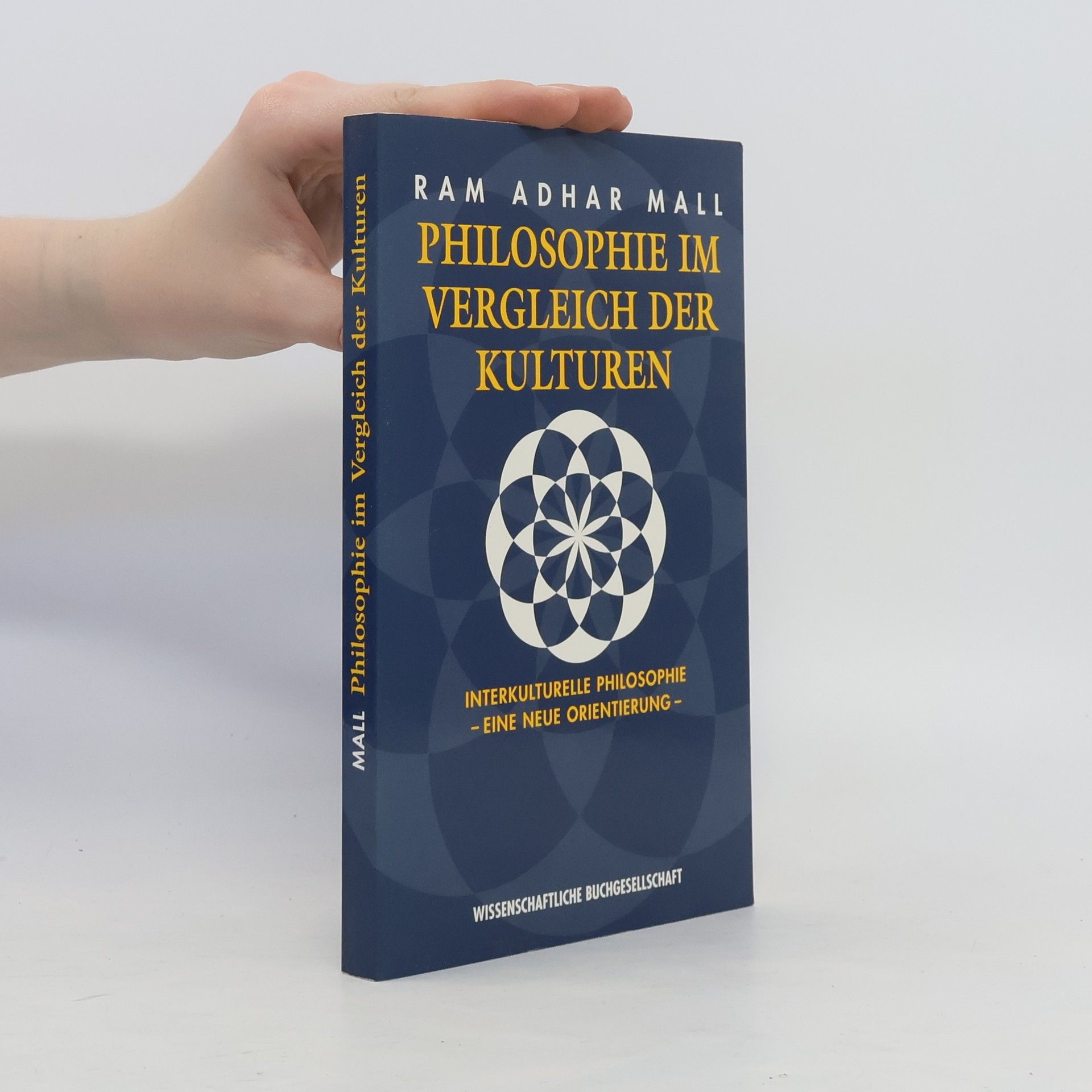
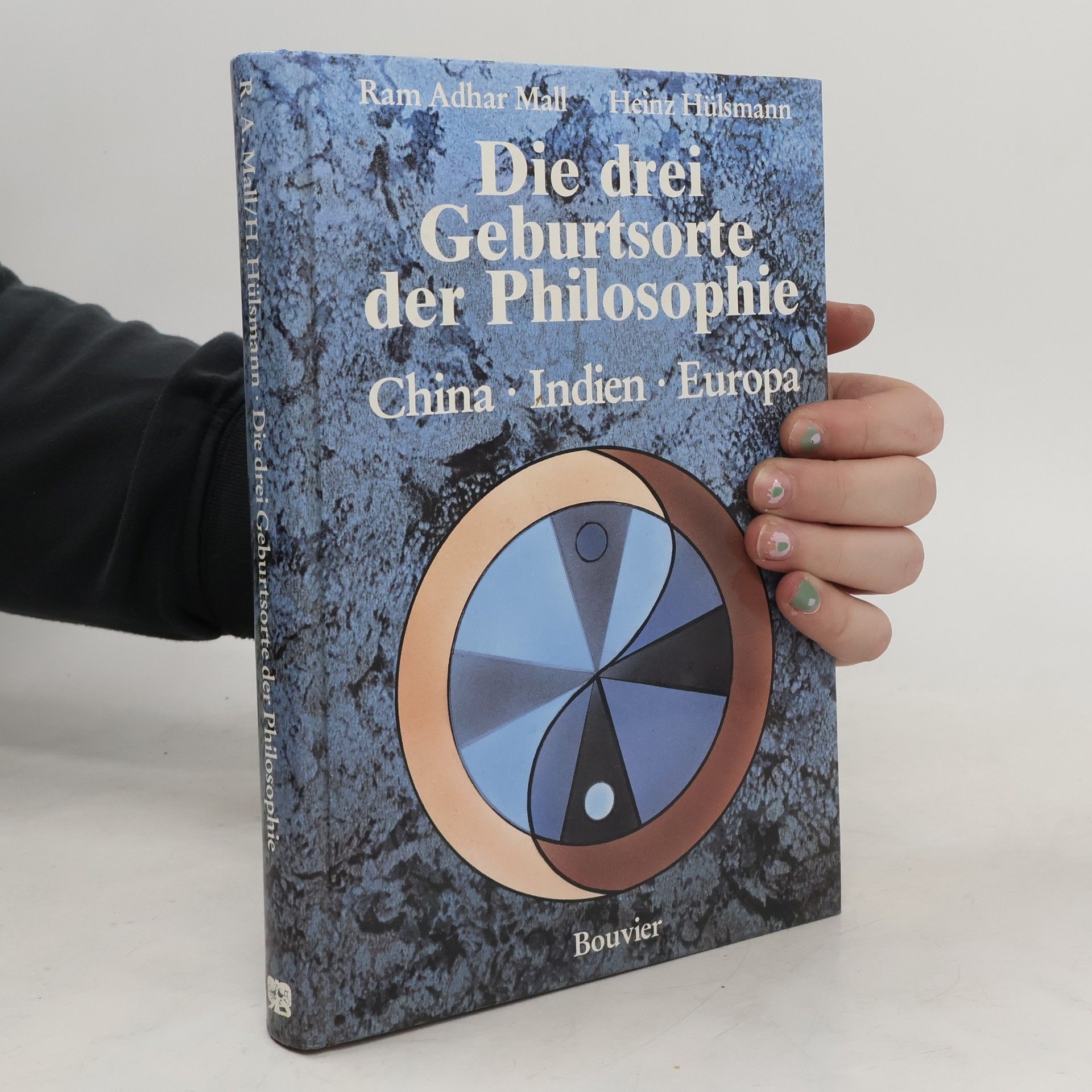


Eine interkulturelle und interreligiöse Perspektive
Eine interkulturell-philosophisch-autobiographische Reise
Ein Gang durch die Philosophiegeschichte zeigt eine starke Verknüpfung von Menschenbild und Geschichtsbild. Letztlich sind jedoch Mensch und Geschichte im großen Haushalt der Natur verankert. Lediglich die abendländische Tradition gibt dem Menschen und der Geschichte bis heute eine absolute Vorrangstellung und Eigenstellung gegenüber der Natur. In diesem Buch legt Ram Adhar Mall den Entwurf einer Neuorientierung von Anthropologie und Geschichtsphilosophie vor.