Hans Mathias Kepplinger Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

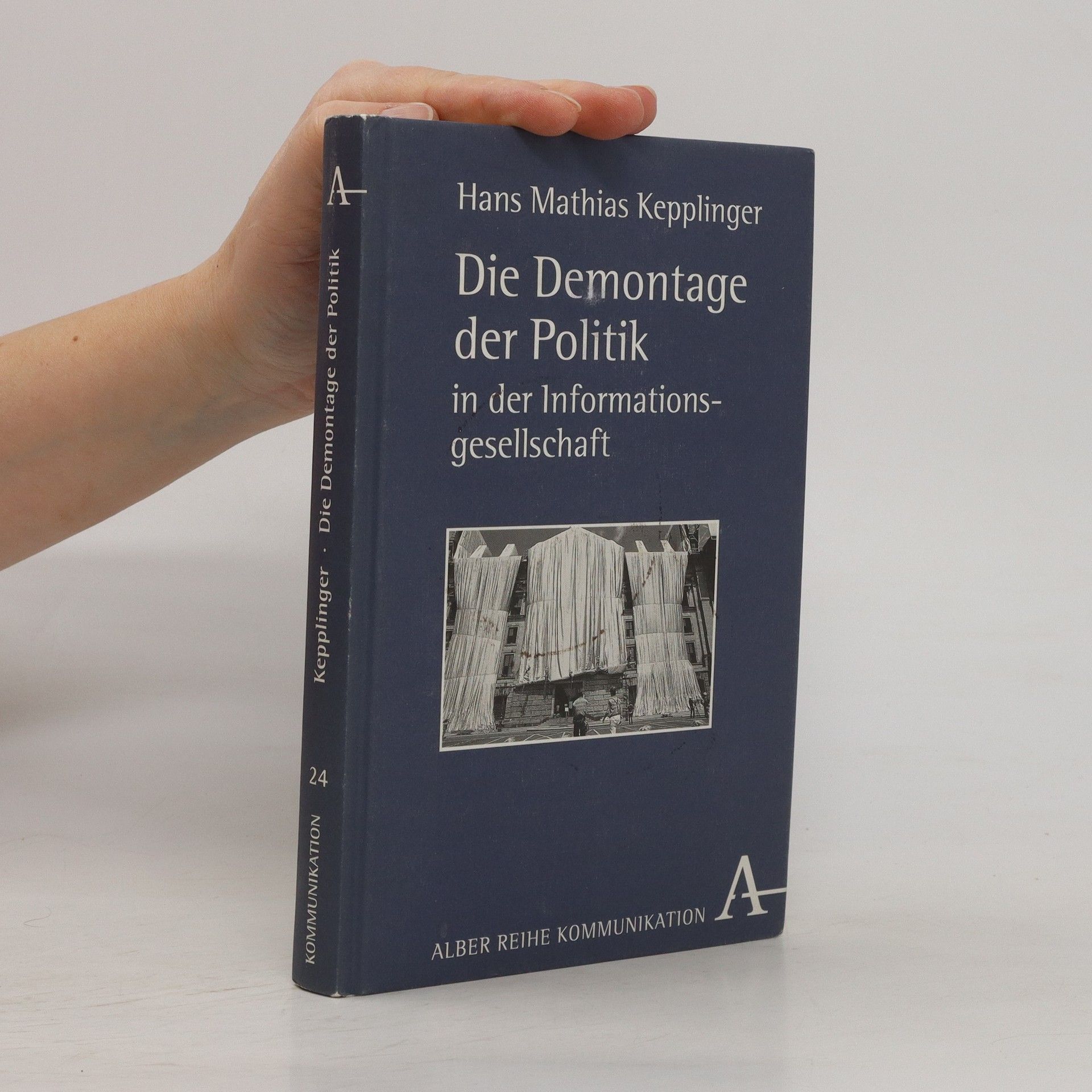
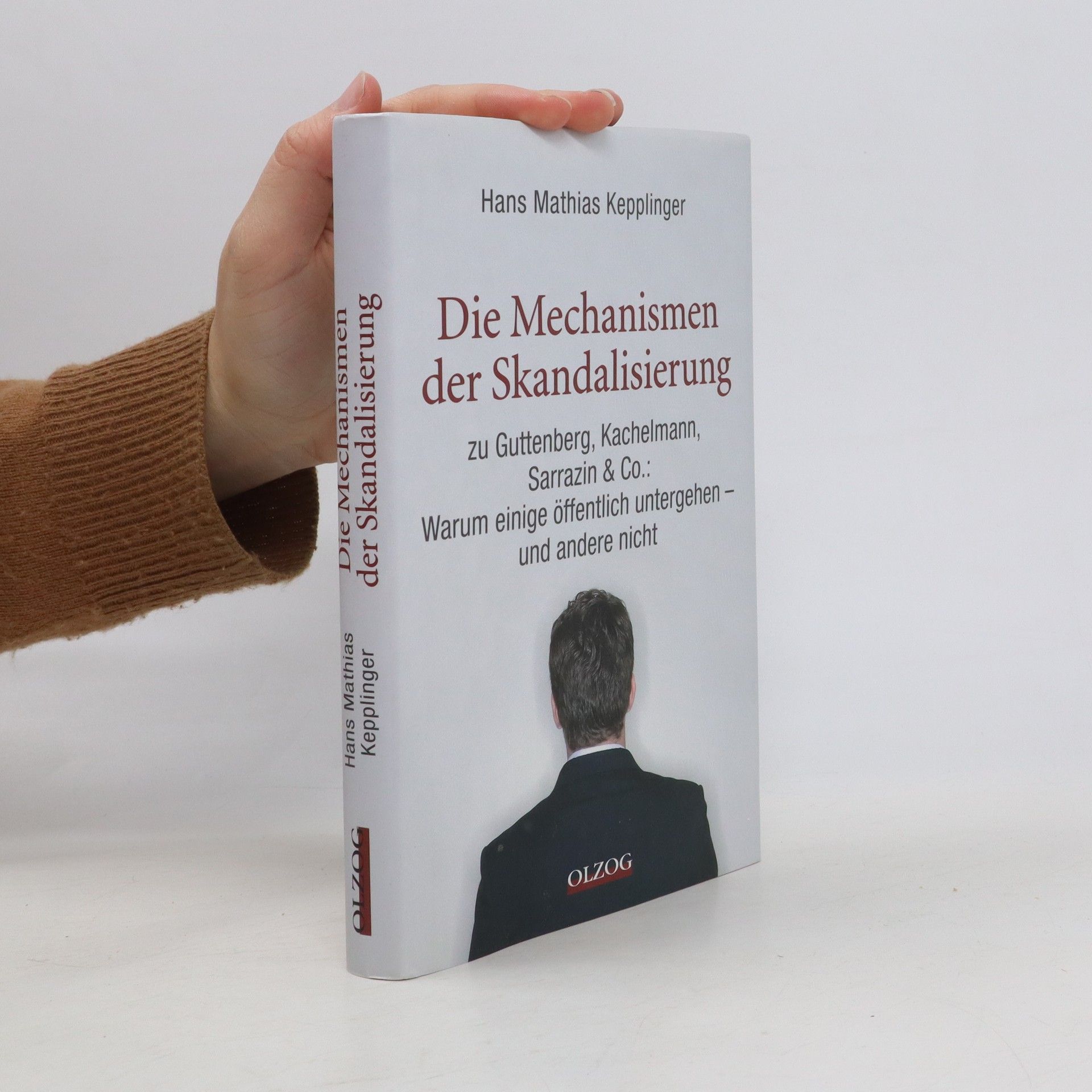

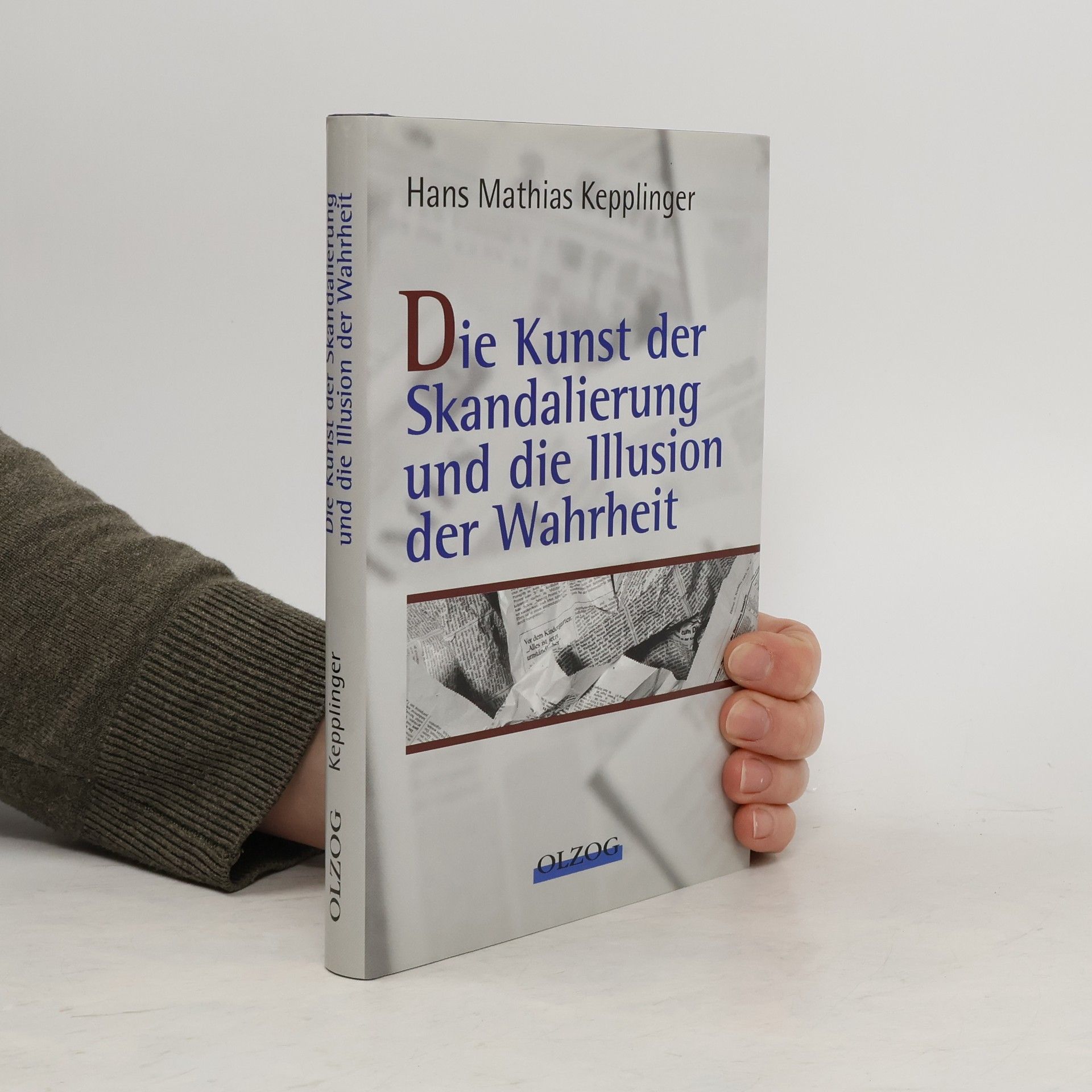
Die Mechanismen der Skandalisierung
- 223 Seiten
- 8 Lesestunden
Was unterscheidet einen Skandal von einem Missstand und warum gibt es die größten Skandale in Ländern mit den geringsten Missständen? Wie werden kleine Missstände zu großen Skandalen und warum gehen einige Skandalisierte öffentlich unter, während andere sich erfolgreich behaupten? Warum betrachten sich alle Skandalisierten auch dann als Opfer, wenn sie zugeben, was man ihnen vorwirft? Woran erkennt man, ob Skandale nützlich oder schädlich sind? Und ganz Worauf beruht in Skandalen die Macht der Medien und wie gehen sie damit um?Antworten liefern repräsentative Analysen von mehreren tausend Skandalberichten in Presse, Hörfunk und Fernsehen sowie systematische Befragungen von weit über eintausend Journalisten, Politikern, Juristen, Managern und Vertretern von Interessengruppen. Ihr Ergebnis ist eine empirisch fundierte Skandaltheorie. Sie bildet die Grundlage von anschaulichen Fallstudien zur Skandalisierung von prominenten Personen, darunter Bundespräsident Christian Wulff und Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst; bedeutenden Unternehmen, darunter VW und Shell; wichtigen Technologien, darunter die Kernenergie und Dieselmotoren sowie erfolgreichen Produkten, darunter das G36 und Glyphosat.
Rechte Leute von links
Gewaltkult und Innerlichkeit.