Hermann Sturm Bücher

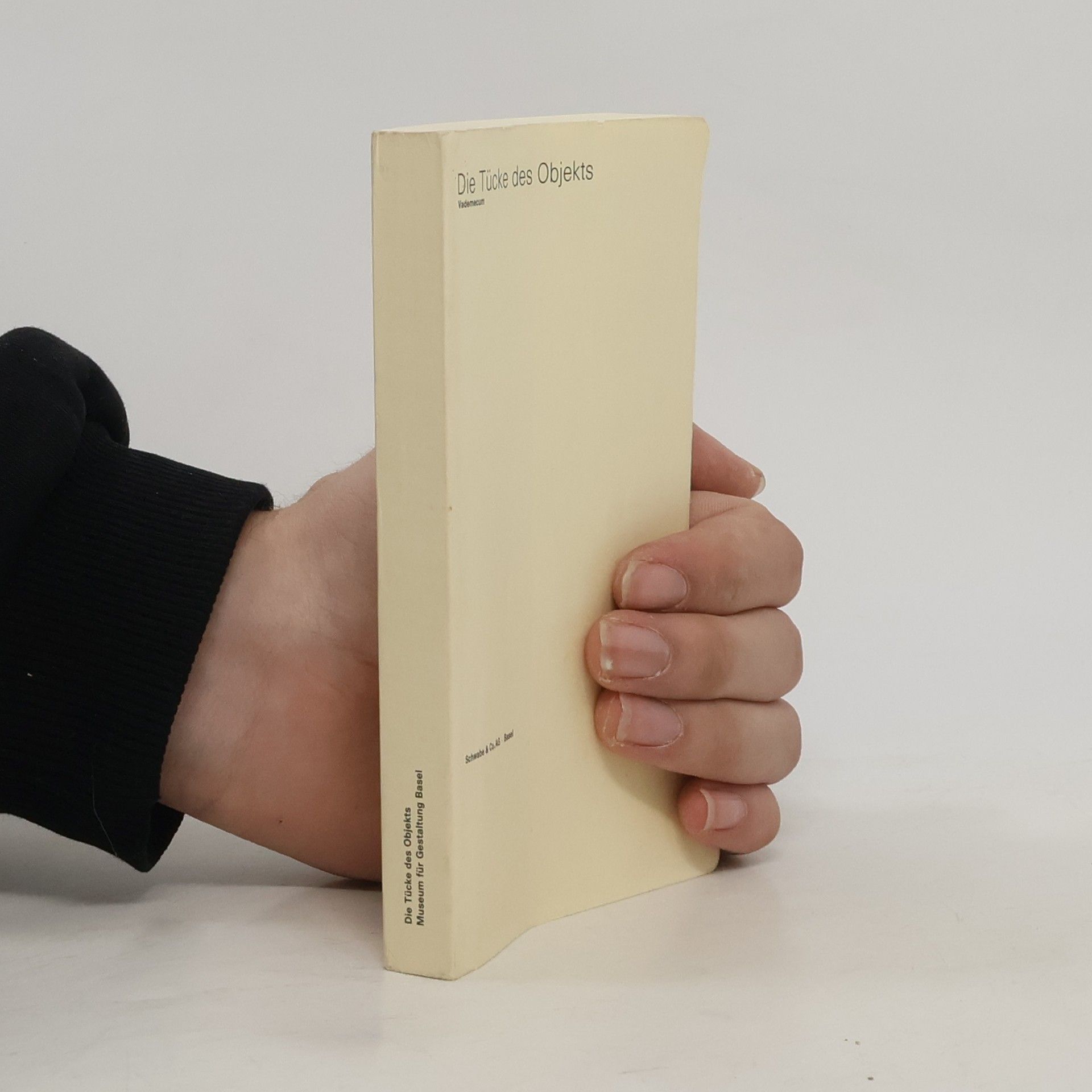

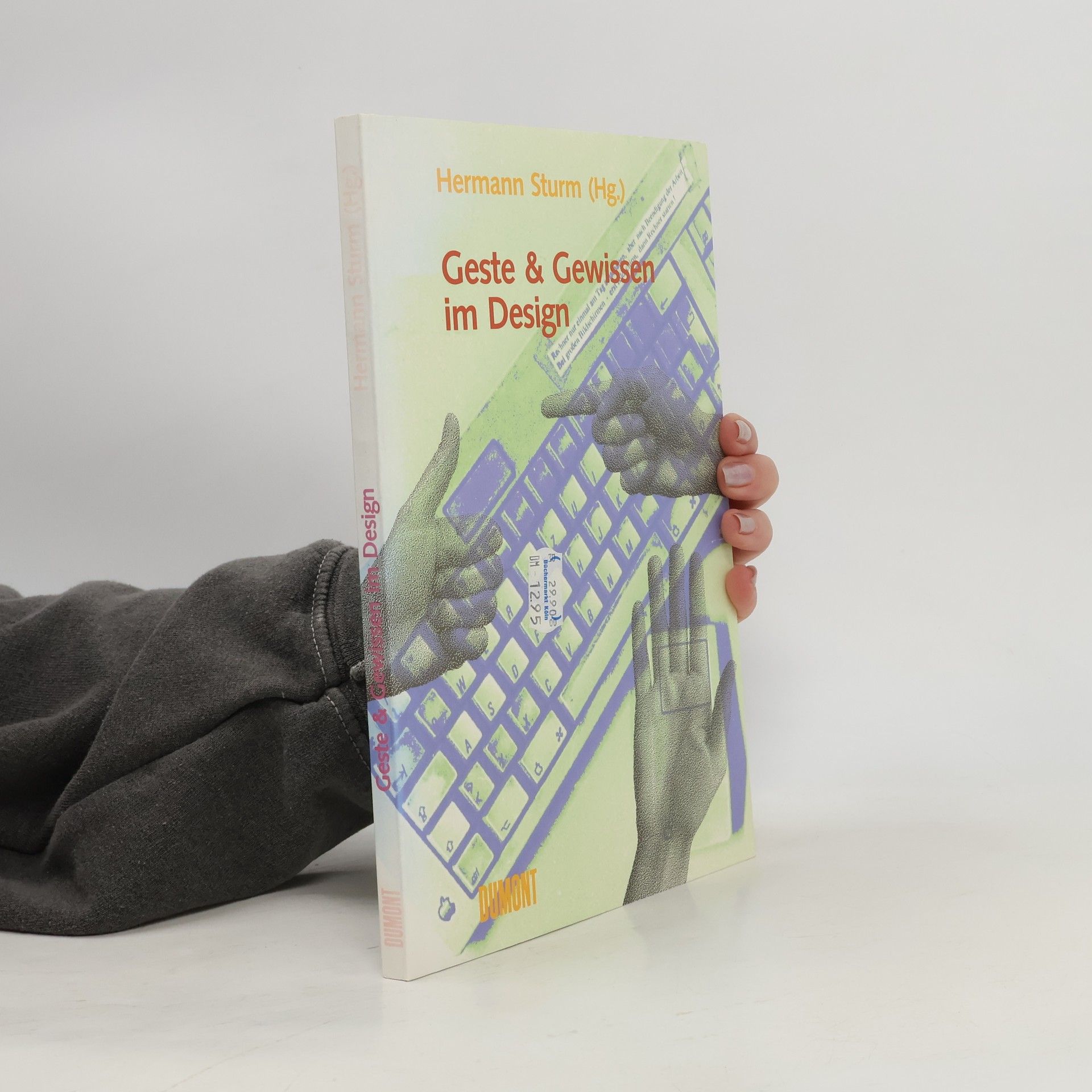

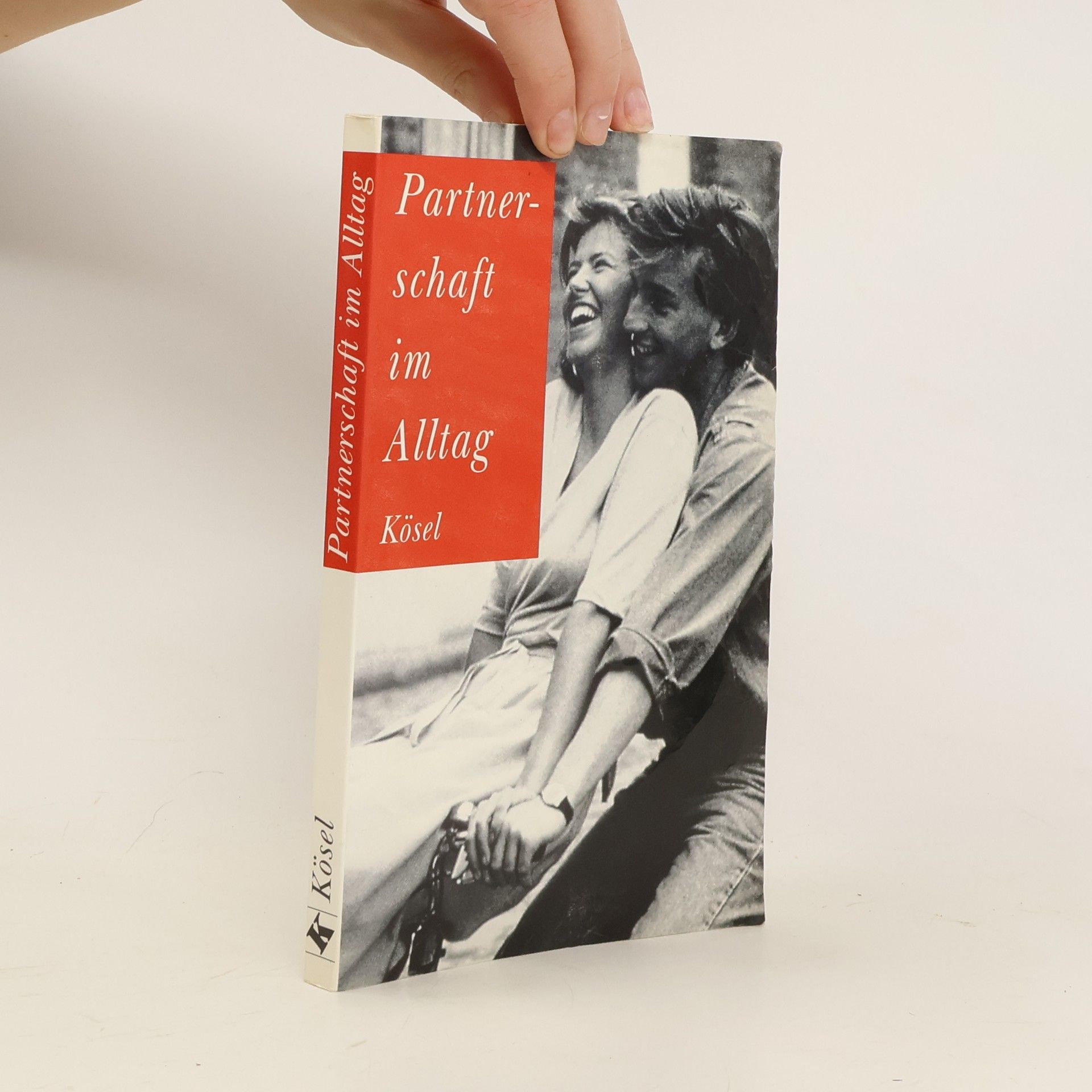
Industriearchitektur als Kathedrale der Arbeit
- 208 Seiten
- 8 Lesestunden
Beschreibt man Bauten der Industriearchitektur als „Kathedralen der Arbeit“, so ergibt sich auch die Frage nach den Ursachen für den inflationären Gebrauch der Wortverbindungen mit „Kathedrale“ in der Gegenwart. Die Karriere des Begriffs „Kathedrale der Arbeit“ ist eine Folge der Ästhetisierung und kulturellen Nobilitierung von Industriebauten. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war der mit dem Begriff „Kathedrale der Arbeit“ verbundene Inhalt pathetisch überhöht in einer Verbindung von Kunst und Religion auf eine utopische Zukunft gerichtet. Heute wird die vergangene Welt des Industriezeitalters nicht selten als Mythos funktionalisiert. Die Beschäftigung mit Erscheinungsformen von Bauten der Industrie als „Kathedralen der Arbeit“ im historischen Überblick rückt einen zweiten historischer Komplex ins Blickfeld, der, mit ideal-utopischen Vorstellungen aufgeladen, in der Architektur-Diskussion parallel dazu geführt wird: „Volkshaus“ - „Haus der Andacht“ - „Palast der Arbeit“, um nur einige zu nennen. Das Spannungsfeld dieser Begriffe gibt den Rahmen ab für die Betrachtung und Analyse von Bildern und Texten.
Die Tücke des Objekts
- 600 Seiten
- 21 Lesestunden
Design - Schnittpunkt - Essen
- 368 Seiten
- 13 Lesestunden