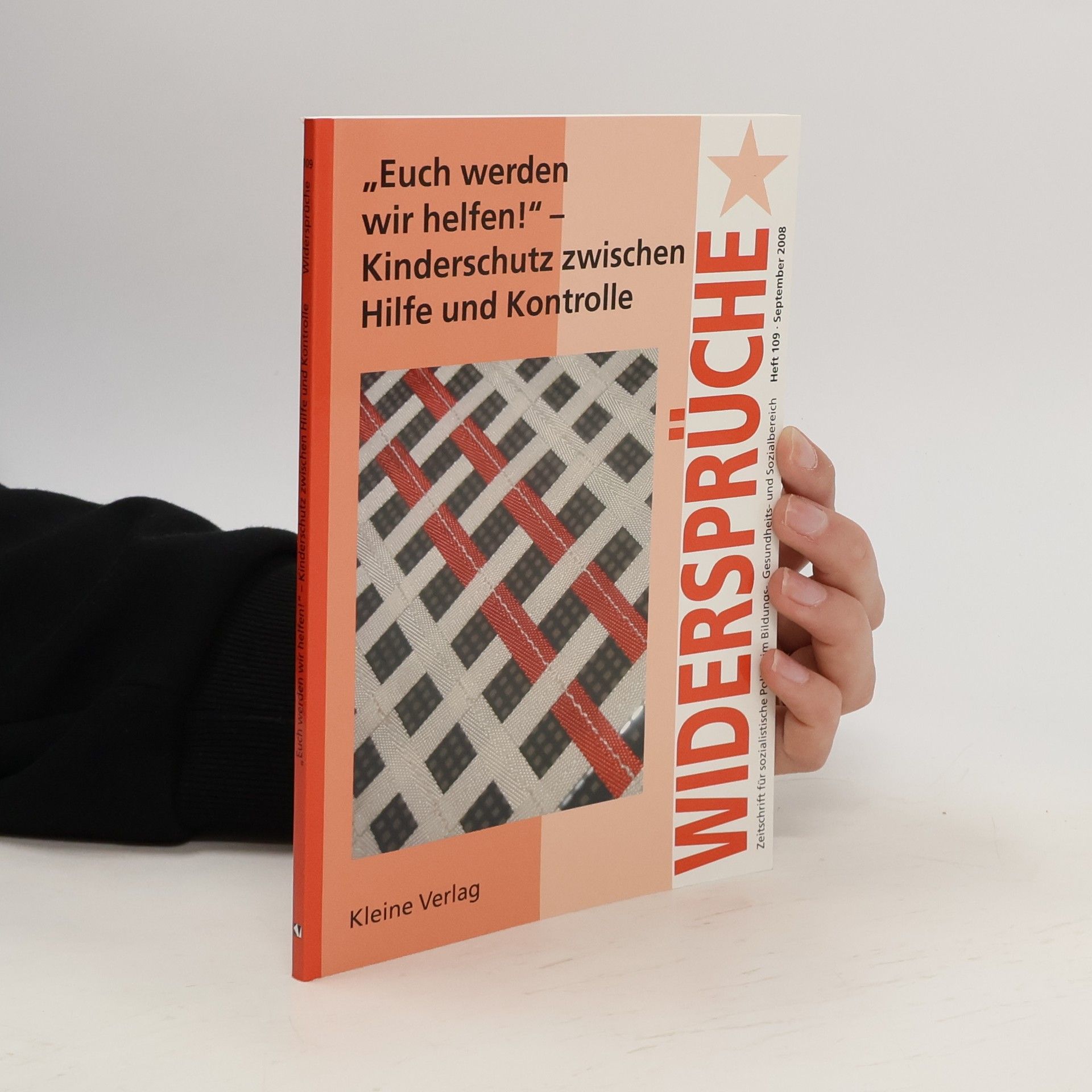Soziale Arbeit der Kirchen im NS-Staat
Zustimmung, Übereinstimmung, Mit-Täterschaft
- 400 Seiten
- 14 Lesestunden
Die Analyse beleuchtet die Verstrickungen der kirchlichen Sozialen Arbeit in die NS-Bevölkerungspolitik, gestützt auf Quellen aus der NS-Zeit. Manfred Kappeler thematisiert die Kontinuitäten im Denken und Handeln, die diese Beteiligungen ermöglichten, und hebt die Rolle klassifizierender Denkweisen hervor. Zudem wird die ambivalente Haltung der Kirchen zum Widerstand ihrer Mitarbeiter:innen sowie die nachträglichen Legendenbildungen behandelt, mit denen kirchliche Verantwortliche ihre Rolle während des Nationalsozialismus relativieren und sich als Opfer stilisieren wollten.