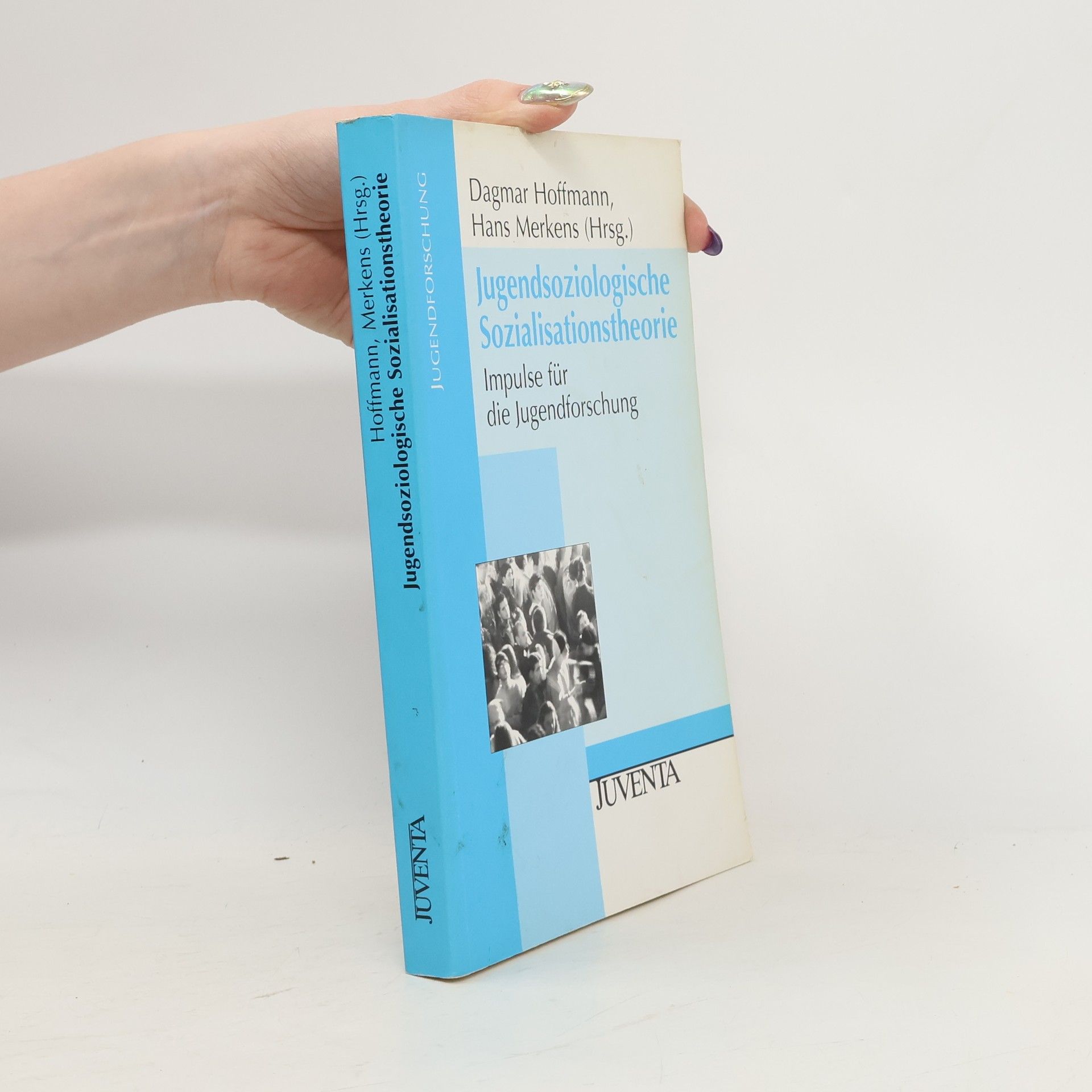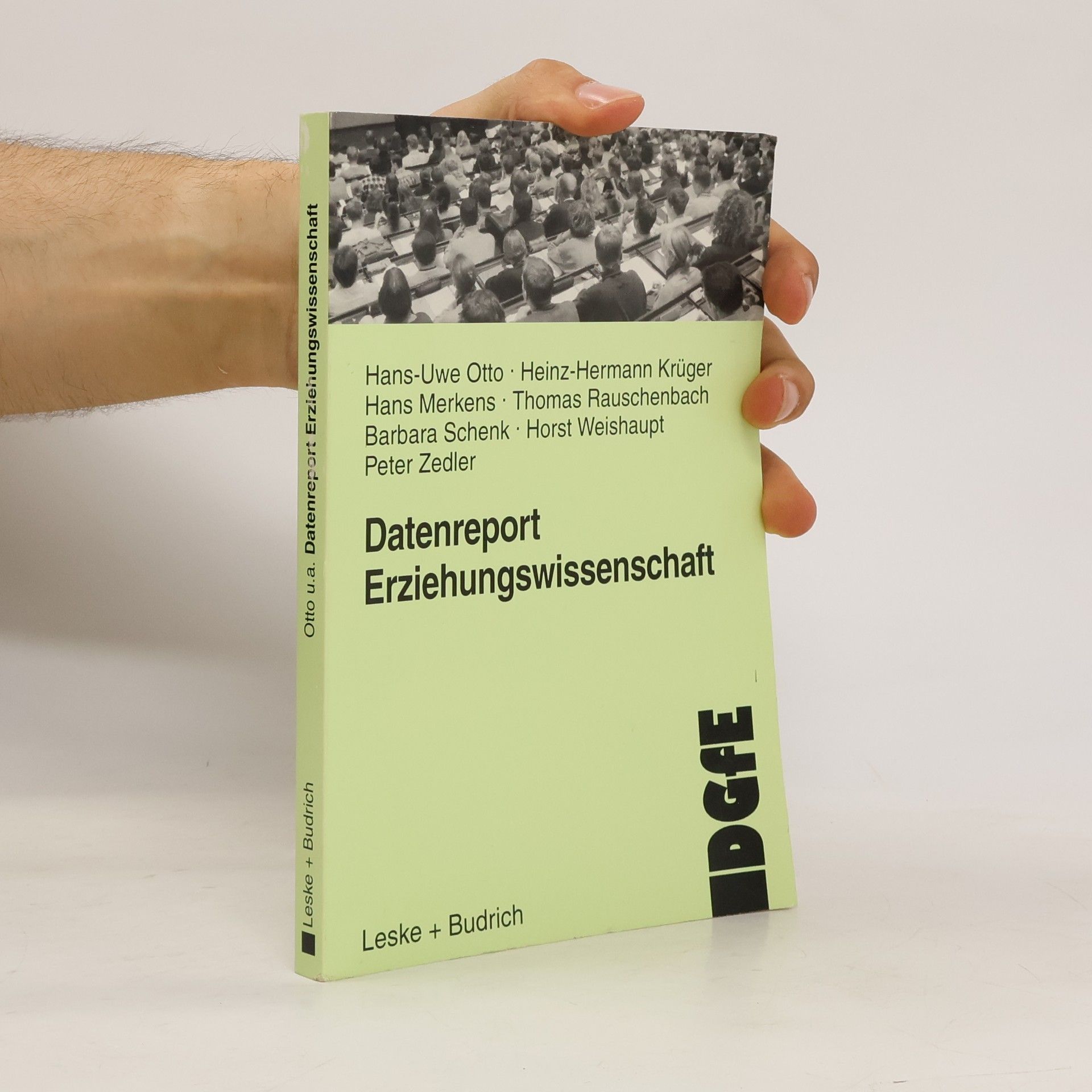Pädagogische Institutionen
Pädagogisches Handeln im Spannungsfeld von Individualisierung und Organisation - Lehrbuch
- 304 Seiten
- 11 Lesestunden
Wird in pädagogischen Institutionen pädagogisches Handeln organisiert? Diese Frage bildet den Ausgangspunkt der Einführung, die einen Einblick in die Vielfalt der Institutionen, deren Ziel 'Erziehung' und 'Bildung' ist, gibt. Die Differenz pädagogischer Institutionen zu anderen wird dadurch bestimmt, dass die unterschiedlichen Aufgaben, die in diesen Institutionen erfüllt werden, beschrieben Eltern und Familien agieren anders als Schule, Schulaufsicht und Erziehungswissenschaft. In diesem Kontext wird auf die Merkmale des Organisierens sowie der Professionalität verwiesen, die als bestimmend für das Handeln in pädagogischen Institutionen angesehen werden. Soziologische und betriebswirtschaftliche Organisationstheorien werden vorgestellt und auf ihre Verwertung in pädagogischen Institutionskontexten untersucht.