Die Zukunft der literarischen Kultur wird davon mitgeprägt, welchen Gebrauch Kinder und Jugendliche des Medienzeitalters von ihr machen. Literarische Sozialisation lenkt den Blick auf kinderliterarische Praktiken und jugendliche Lektüregewohnheiten. Es gilt zu erforschen, welchen Einfluss diese Prägung auf den Umgang mit Literatur im Erwachsenenalter haben wird. Die Neuauflage ist um ein Kapitel zur Pisa-Studie erweitert.
Hartmut Eggert Bücher
31. Mai 1937

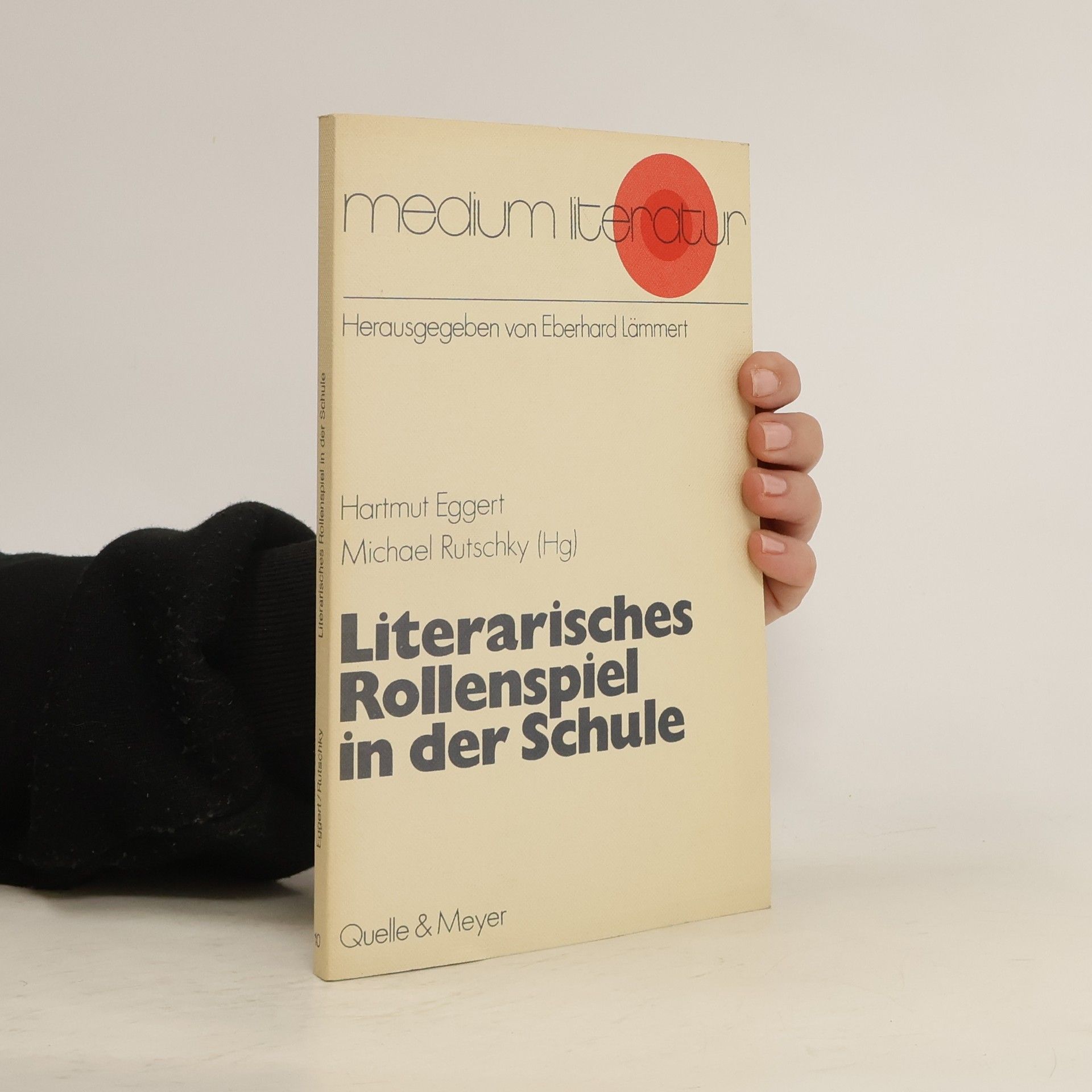
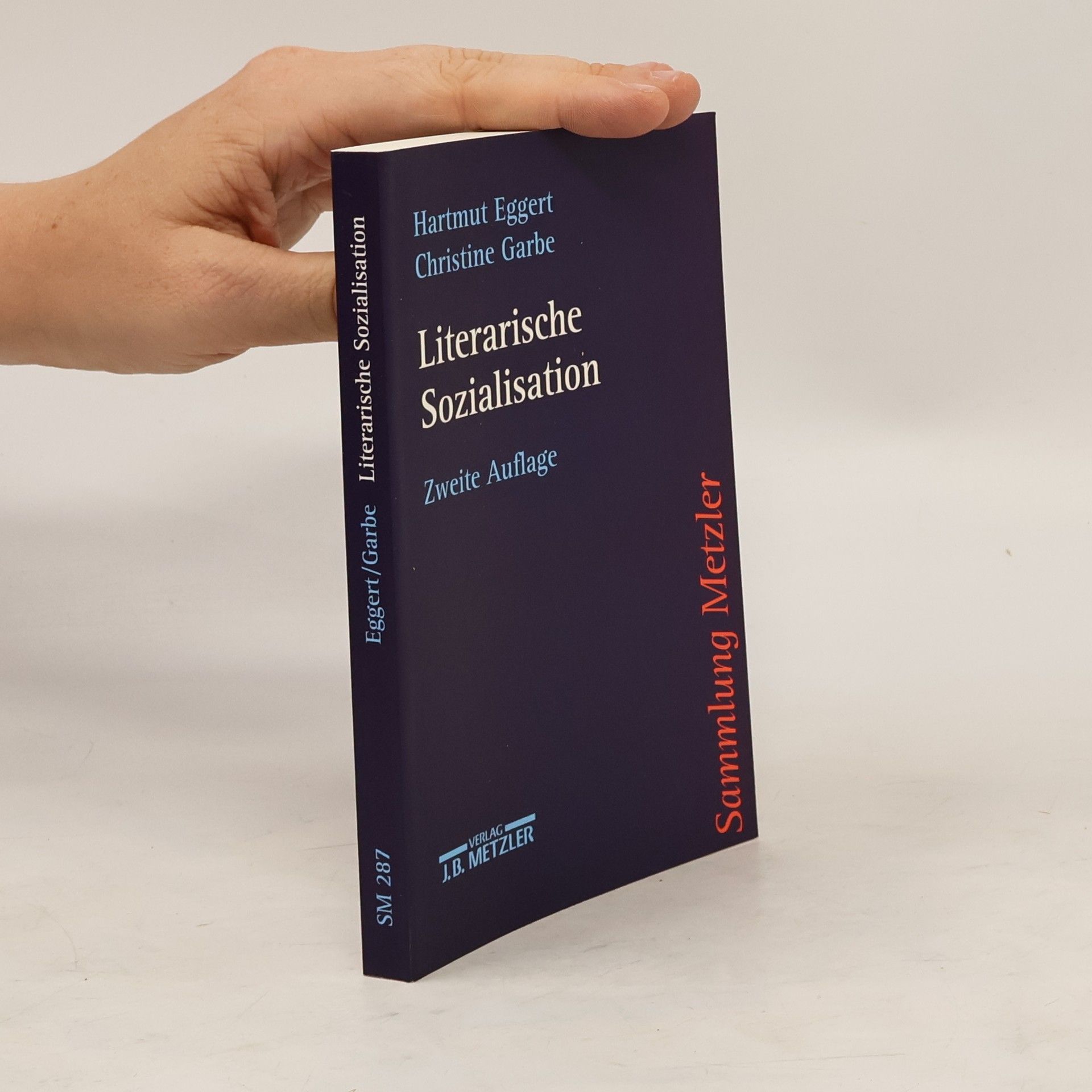
Der Deutschunterricht - 3/81: Nachkriegszeit als literarische Epoche
Themen und Strukturen westdeutscher Nachkriegsliteratur - Jahrgang 33
- 111 Seiten
- 4 Lesestunden