Der ehrgeizige Plan eines Wasserwegs von Münster über die Niederlande bis zur Nordsee blieb unvollendet. Heute bietet der Max-Clemens-Kanal vor allem eines: Wandervergnügen in wunderschöner Natur! Verschiedene Fuß- und Radwanderrouten geben dem nur noch als Bodendenkmal existierenden Kanal wieder ein Gesicht. Der Weg nimmt seinen Ausgangspunkt am ehemaligen Hafen in der Nähe des Zwingers in Münster, führt über die Wienburg mit ihrem Barockgarten nach Kinderhaus und zur Hölzernen Schleuse aus dem Jahr 1740. Auf Steinfurter Gebiet geht der Wanderweg weiter über die Steinerne Schleuse und Clemenshafen bis zu seinem Endpunkt Maxhafen in der Nähe von Wettringen. Die gesamte Strecke kann natürlich auch in umgekehrter Richtung von Wettringen nach Münster gegangen bzw. gefahren werden. Zahlreiche Traditionsgaststätten laden unterwegs zum Verweilen ein.
Elmar Lange Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
30. September 1943
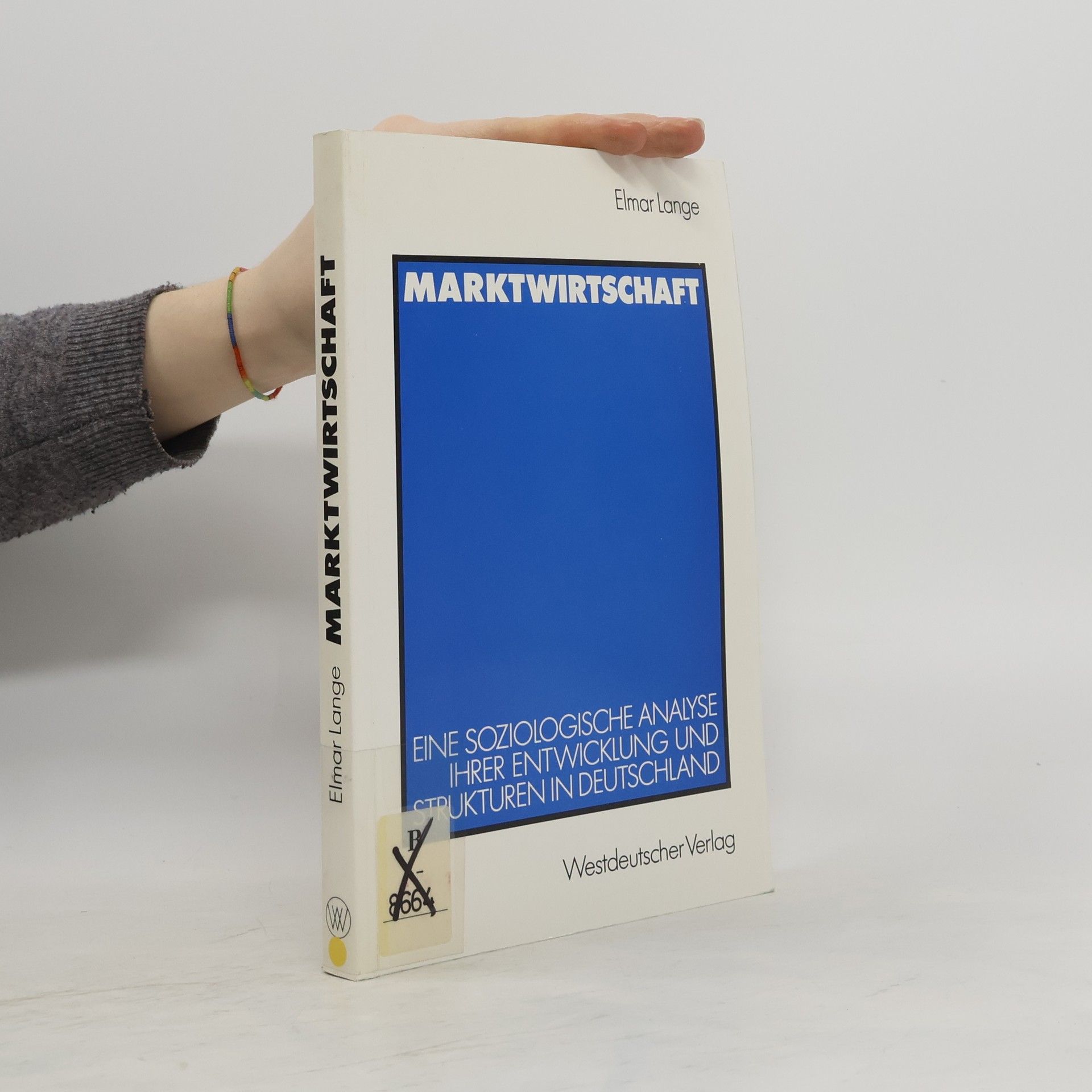

Marktwirtschaft
Eine soziologische Analyse ihrer Entwicklung und Strukturen in Deutschland
- 299 Seiten
- 11 Lesestunden
Das Buch ist eine Einführung in die soziologische Analyse der Marktwirtschaft in Deutschland. Nach der Einleitung und einem Abriß des wirtschaftssoziologischen Denkens wird die Entwicklung der Marktwirtschaft in Deutschland seit der Industrialisierung nachgezeichnet, eine systematische Analyse der Produktion in Industriebetrieben, der Distribution von Gütern und Arbeitskraft auf Märkten und des Konsumprozesses in privaten Haushalten schließt sich an.Im Zentrum des gesamten Werkes steht die Frage nach der Steuerung der Marktwirtschaft und damit die Frage nach dem Verhältnis vonStaat und Wirtschaft.