Wie nennen wir unser Kind? Leon oder Luca, Anna oder Nicole? Woher kommt der Name Frauke? Ist Heilwig ein männlicher oder ein weiblicher Vorname? Seit langem ist »Reclams Namenbuch« ein verlässlicher Ratgeber und Helfer bei der Beantwortung dieser und ähnlicher Fragen. Das ideale Geschenk für werdende Eltern!
Friedhelm Debus Bücher




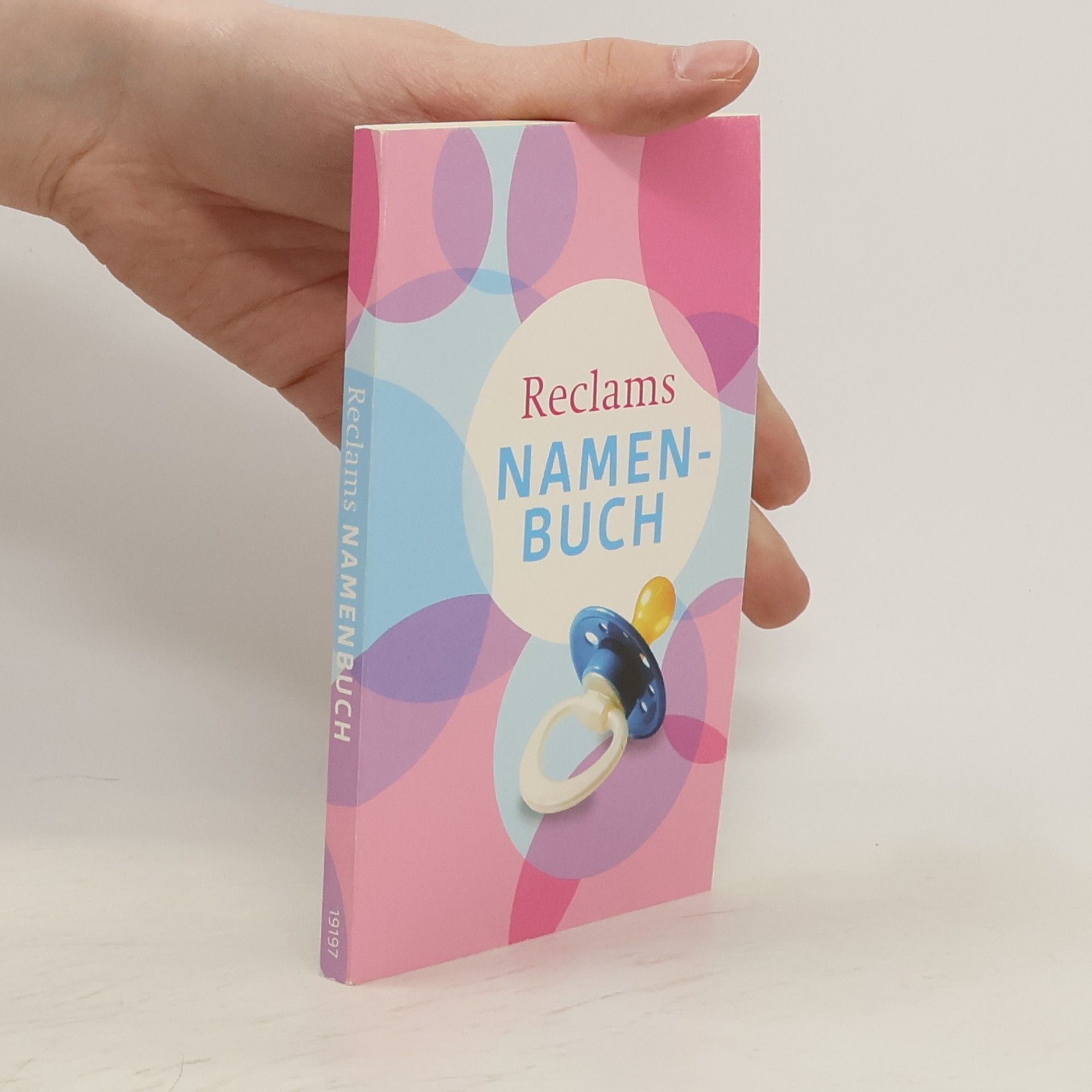
Deutsch als Wissenschaftssprache im 20. Jahrhundert
- 314 Seiten
- 11 Lesestunden
Jeder Mensch trägt einen bzw. mehrere (Eigen-)Namen, er ist umgeben von einer bunten Namenwelt. Neben den bereits bestehenden Namen kommen stetig neue hinzu. Doch was „bedeuten“ alle diese Namen? Welche Motive spielen und spielten bei der Namengebung eine Rolle, und wie werden Namen im Alltag gebraucht? Das vorliegende Werk widmet sich anhand zahlreicher Beispiele systematisch diesem Bereich, nachdem grundsätzliche Fragen z. B. zur umstrittenen Namenklassifikation und -terminologie diskutiert wurden. Im zentralen Kapitel geht es synchronisch und diachronisch um die verschiedenen Namenarten, im einzelnen um die Personennamen (Vor-, Familien-, Stammes-, Völker-, Ländernamen bis hin zu den Pseudonymen); es geht um die Ortsnamen (Siedlungs-, Flur-, Landschaftsnamen), Tier-, Institutions- und Warennamen. Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Behandlung der literarischen Namen. Zahlreiche Abbildungen, Karten, Tabellen und Beispiele, hervorgehobene Zentralbegriffe im Text, Zusammenfassungen und weiterführende Literaturangaben geben nützliche Hilfen. Der Band bietet Studenten wie auch namenkundlich Interessierten und Forschenden verschiedener Fachrichtungen nicht nur eine theoretisch und praktisch orientierte Einführung in eine weit verzweigte Disziplin, sondern es werden auch Anregungen für weitergehende Untersuchungen gegeben.
Namen in deutschen literarischen Texten des Mittelalters
- 353 Seiten
- 13 Lesestunden
Beiträge zur Namenforschung: Beihefte - Neue Folge: Romania - Germania
- 61 Seiten
- 3 Lesestunden