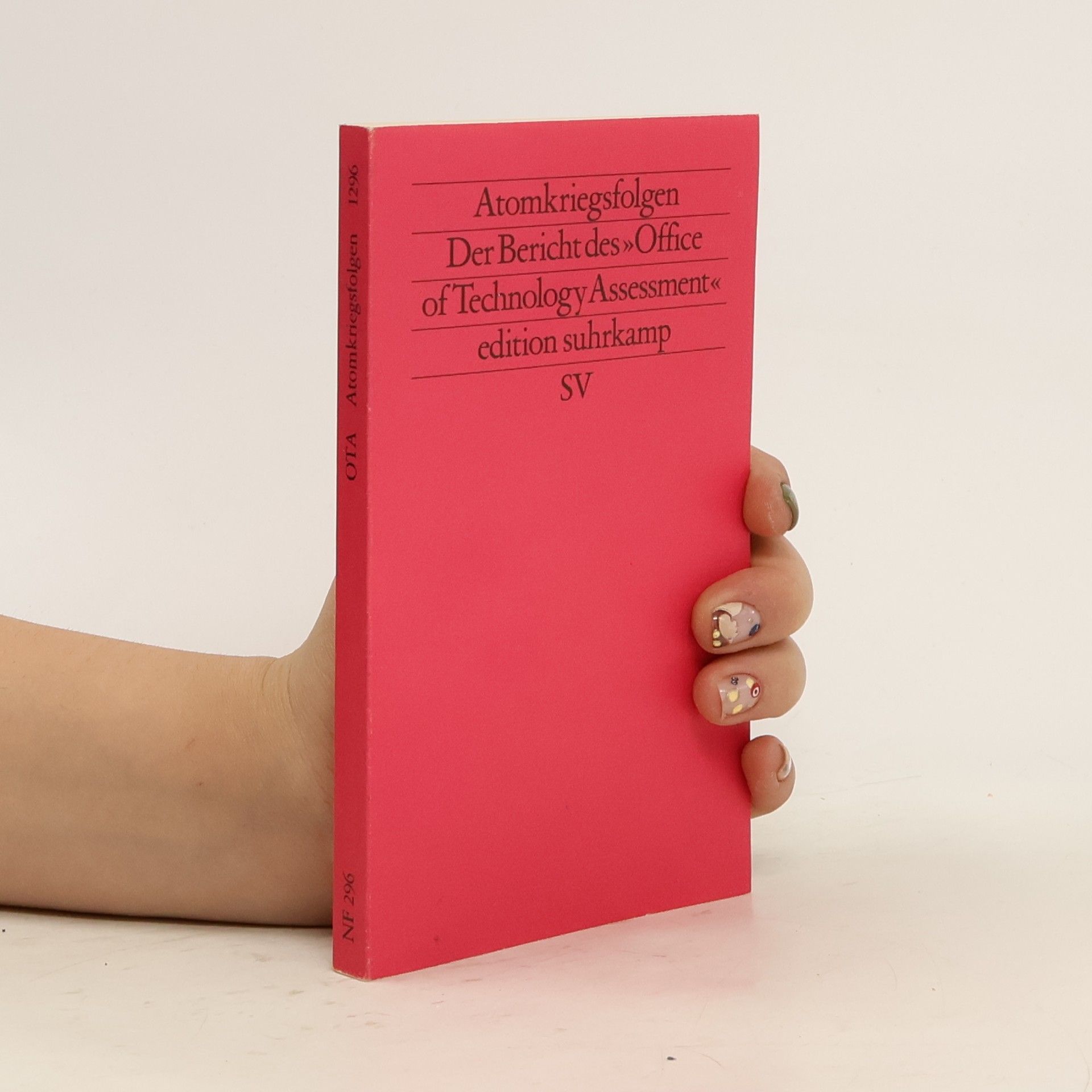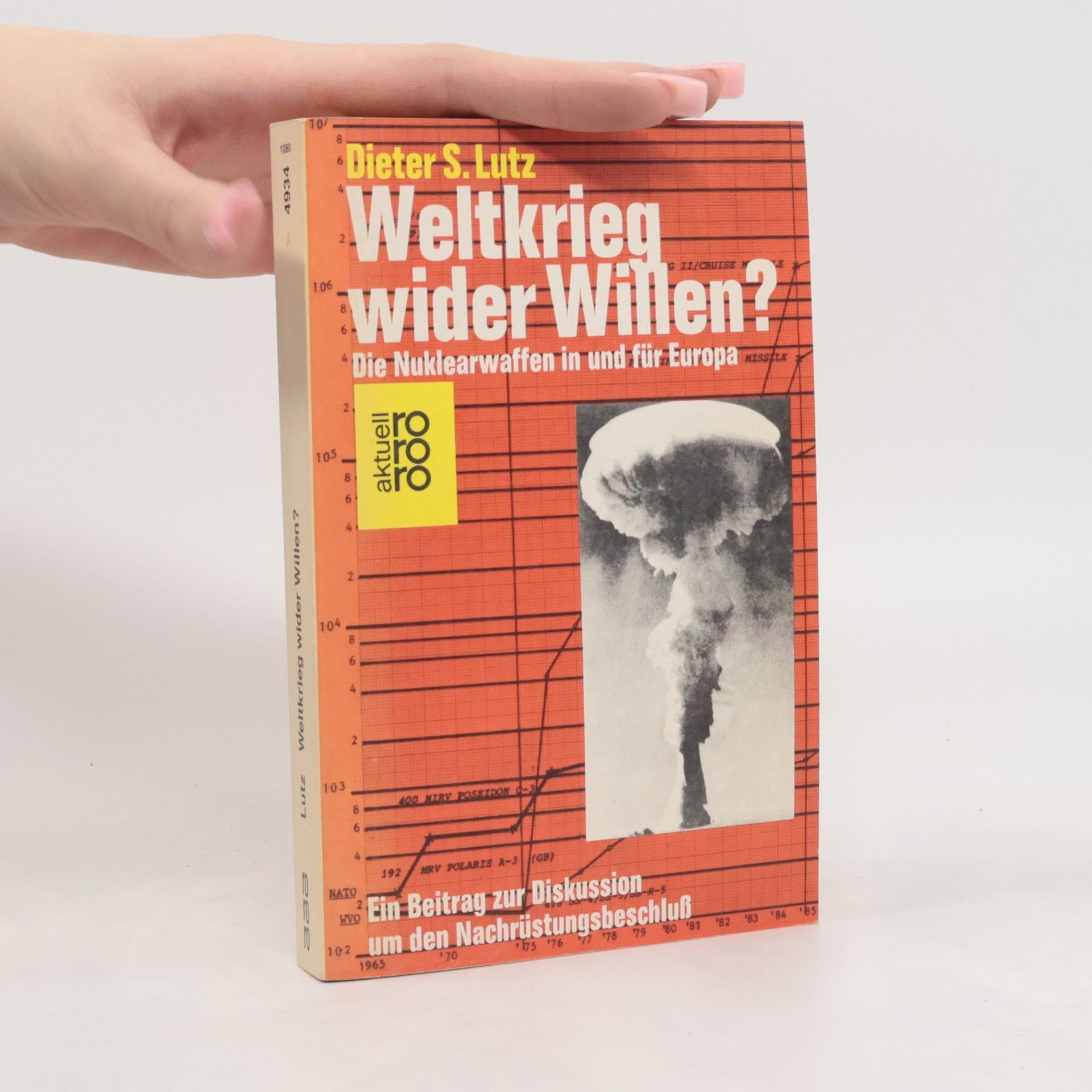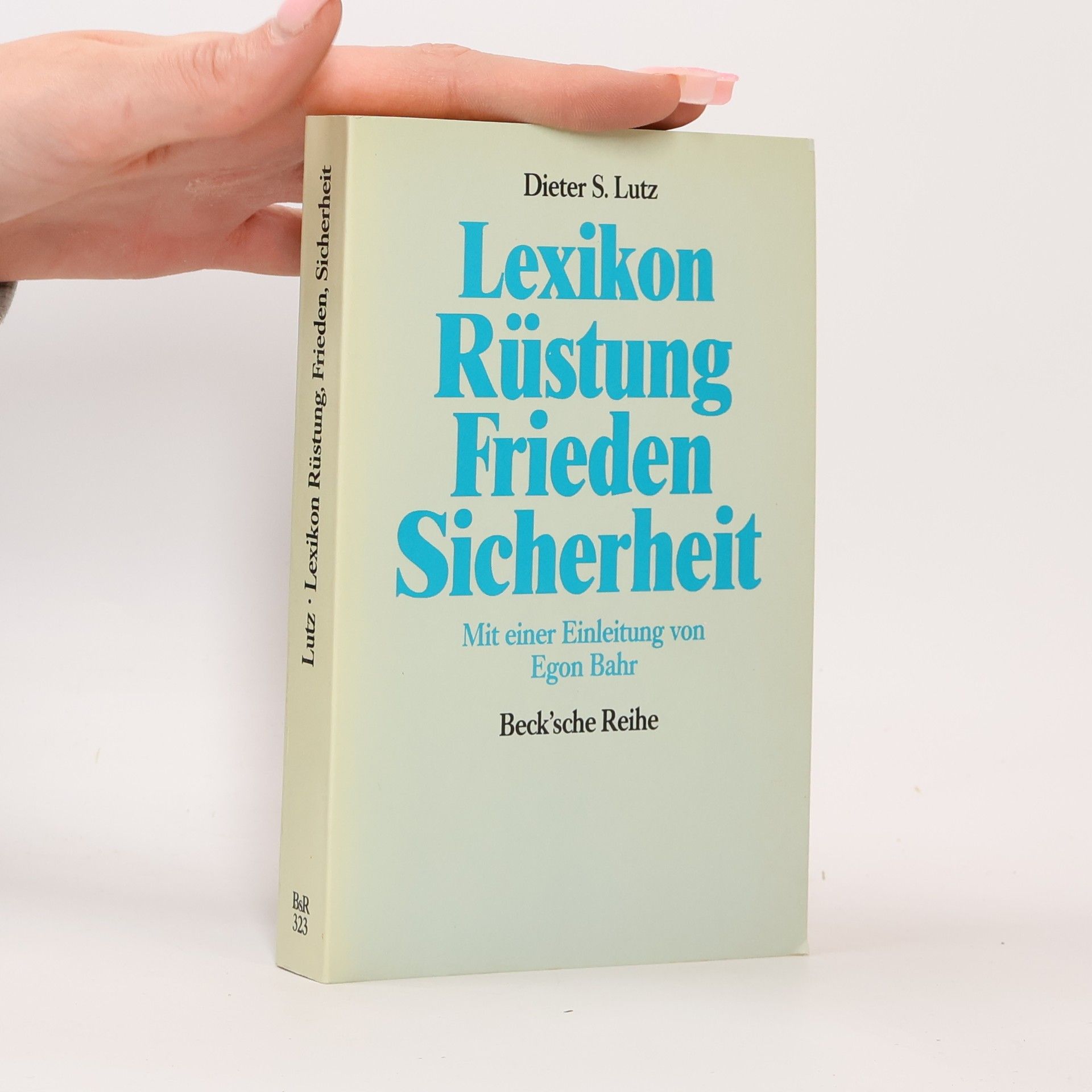Der Krieg im Kosovo und das Versagen der Politik
- 468 Seiten
- 17 Lesestunden
1999 beteiligte sich die Bundesrepublik Deutschland an den Luftschlägen der NATO über dem Kosovo und gegen Jugoslawien – ohne Mandat der Vereinten Nationen, gegen Verfassungs- und Völkerrecht. Folgt man den Aussagen der politischen Akteure und Entscheidungsträger der NATO, so handelte es sich bei der Entscheidung der Allianz, einen Luftkrieg gegen Jugoslawien ohne UN-Mandat zu führen, um einen Ausnahmefall, keineswegs um einen Präzedenzfall. Aber war die Entscheidung wirklich erforderlich? War der Krieg tatsächlich unabwendbar? Und welche Lehren können aus ihm gezogen werden? Der Sammelband gibt zu diesen spannenden Fragen Diskussionsbeiträge wieder, wie sie im zeitlichen Umfeld vor, während und unmittelbar nach dem Kosovo-Krieg vorgetragen wurden. Er schließt mit konstruktiven Vorschlägen und Empfehlungen an die Politik. Der Band versteht sich als eine Initiative zur Fortführung der dringend notwendigen Diskussion des Kosovo-Krieges und seiner Lehren wie auch der grundsätzlichen Prävention friedensgefährdender Konflikte.