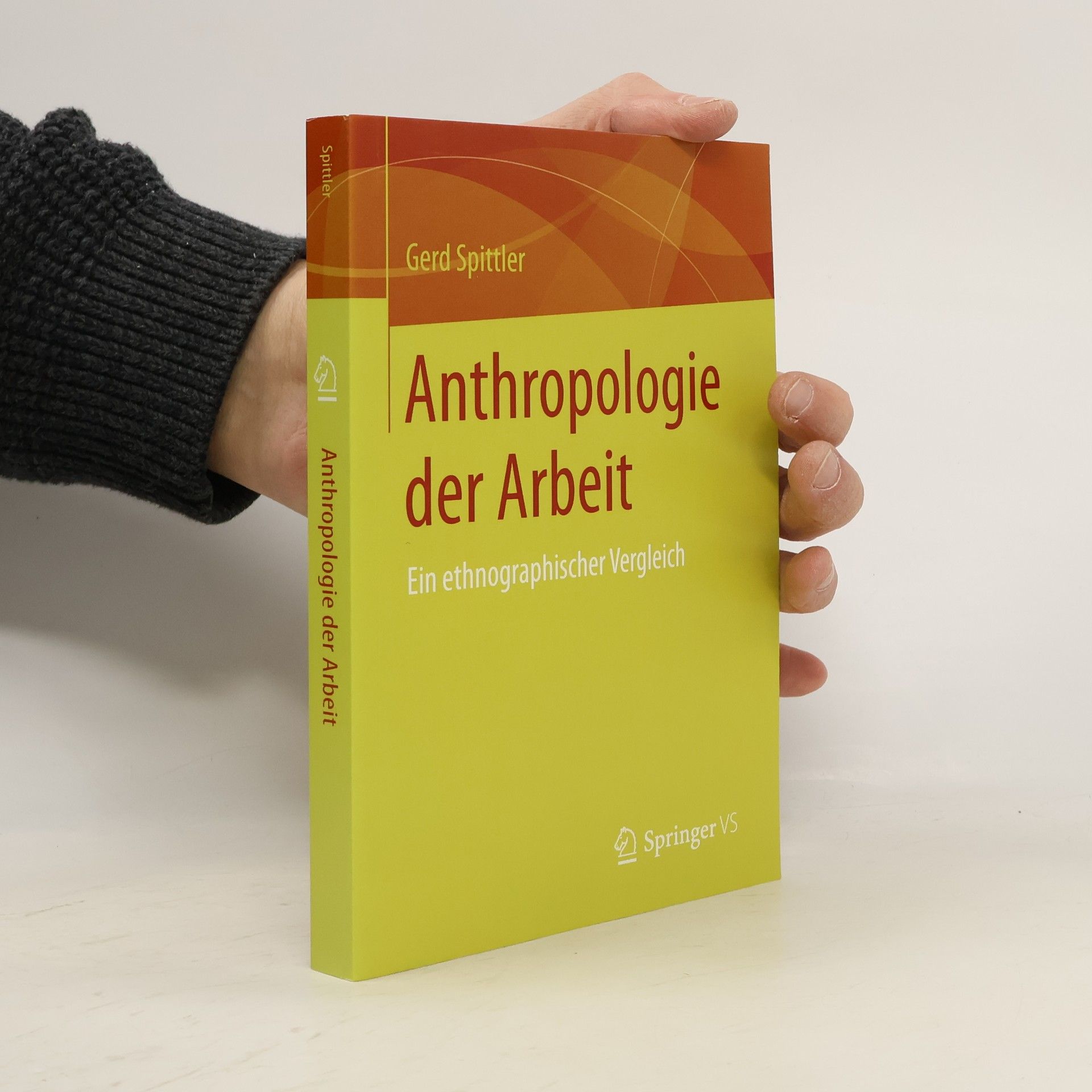Leben mit wenigen Dingen
Der Umgang der Kel Ewey Tuareg mit ihren Requisiten
Ein Tuareg in Timia besitzt ca. 130 Gegenstände, ein Student in Bayreuth 3100. Für die meisten Menschen im „reichen“ Norden steht außer Zweifel, dass die Tuareg arme Leute sind, bereit für die Migration ins reiche Europa. Gerd Spittler untersucht dagegen detailliert, welche Gegenstände („Requisiten“) die Tuareg besitzen, wie sie damit umgehen und wie sie sie bewerten. Armut und Reichtum stellten sich hier anders dar als aus der Sicht der Europäer. Die meisten Dinge sind lange in Gebrauch. Sie werden nicht entsorgt, wenn sie nicht mehr neu sind, sondern bleiben auch abgenutzt in Verwendung, werden geflickt und oft in anderen Funktionen benutzt. Die Darstellung wird vertieft durch 300 Fotos des Autors. Grundlage für diese Untersuchung ist eine Feldforschung bei den Kel Ewey Tuareg der Oase Timia über einen Zeitraum von 30 Jahren.