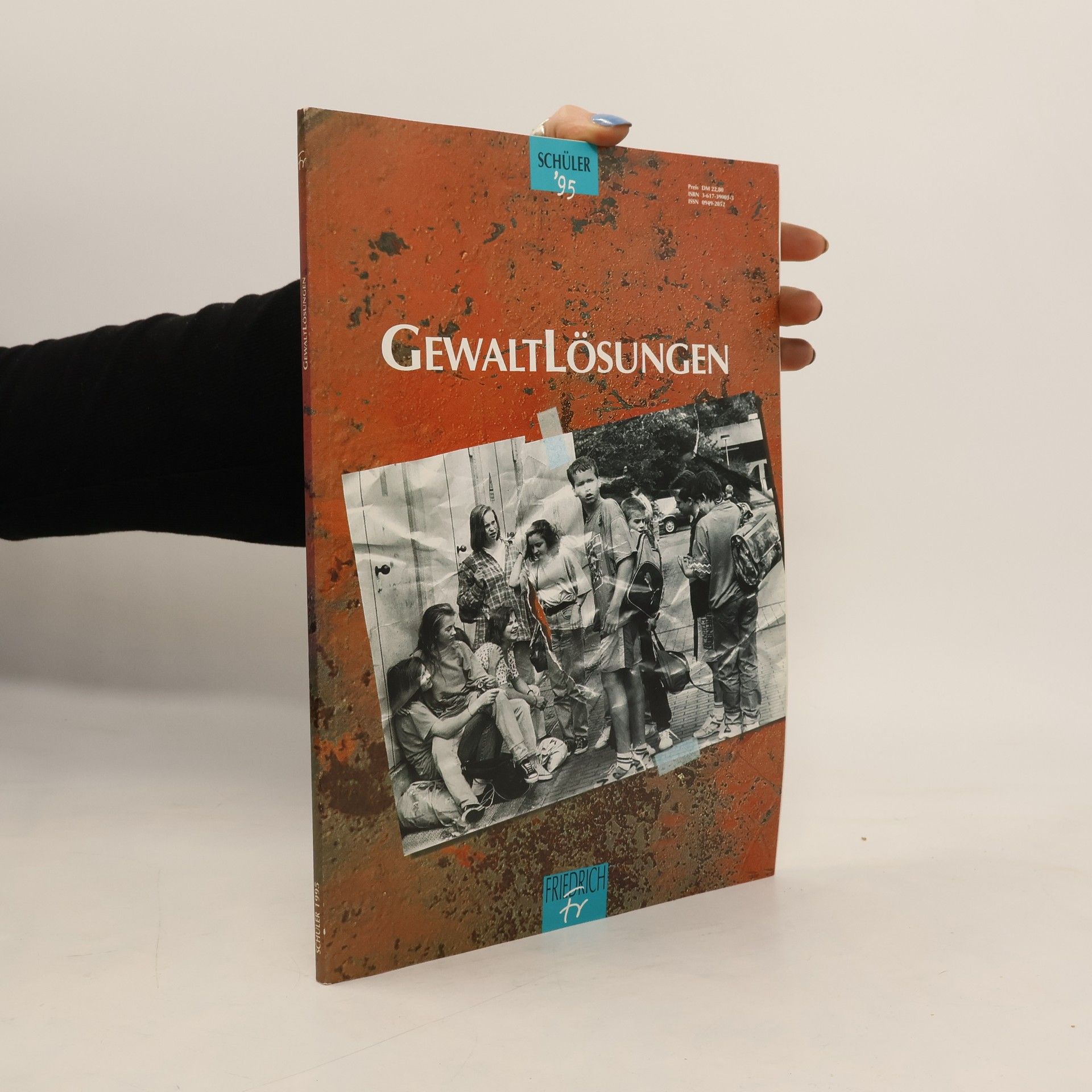Nicht nur durch den Rechtsanspruch nimmt die gesellschaftliche und bildungspolitische Bedeutung von Ganztagsschulen weiter zu. Dennoch wird deren Qualität bis heute oftmals zu wenig berücksichtigt. Was guten Ganztag ausmacht, wird in diesem Band anhand von Beiträgen aus Praxis und Wissenschaft zu den Themen individuelle Fachförderung, Persönlichkeitsentwicklung und Förderung von sozialen Kompetenzen sowie Organisations- und Professionsentwicklung herausgearbeitet.
Klaus-Jürgen Tillmann Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

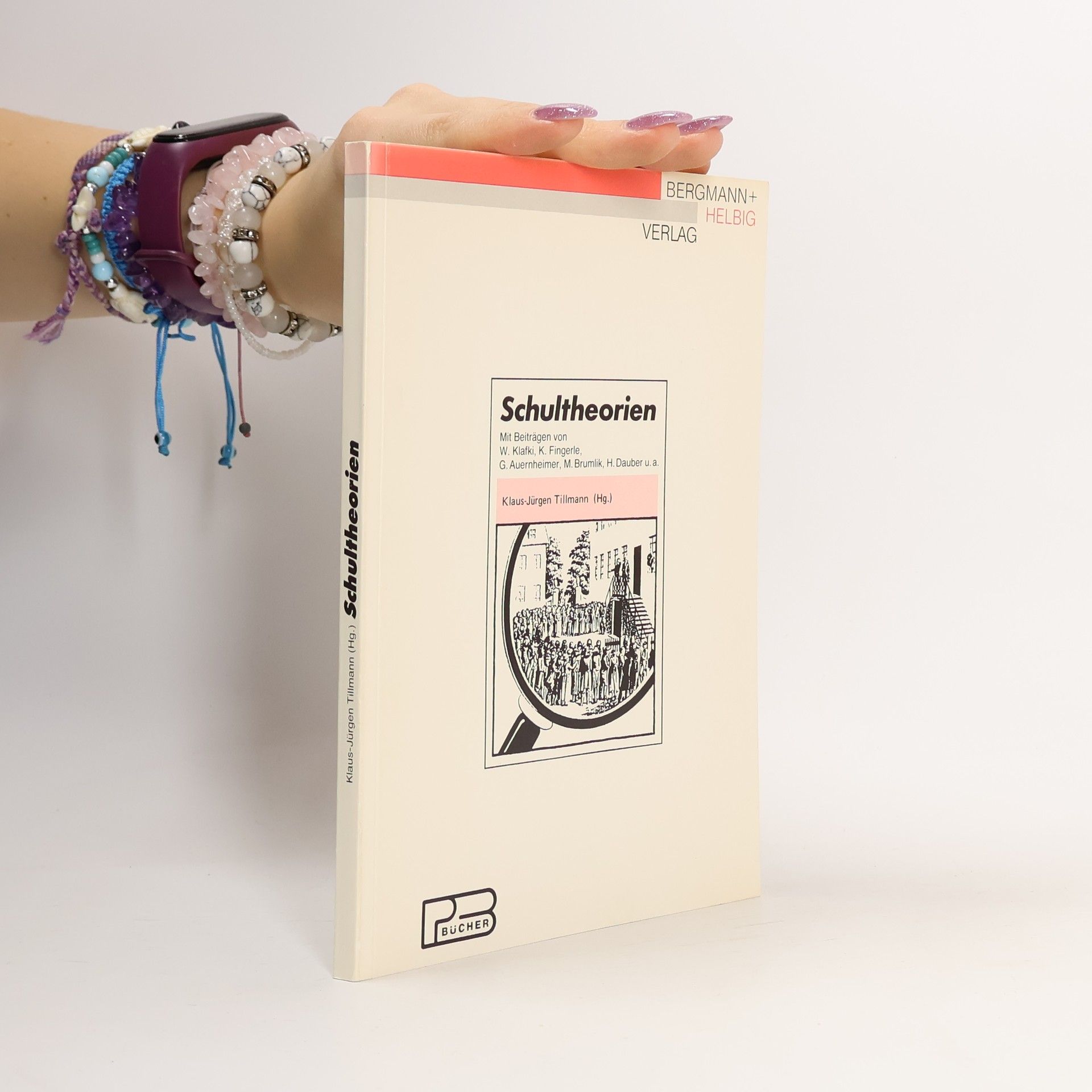
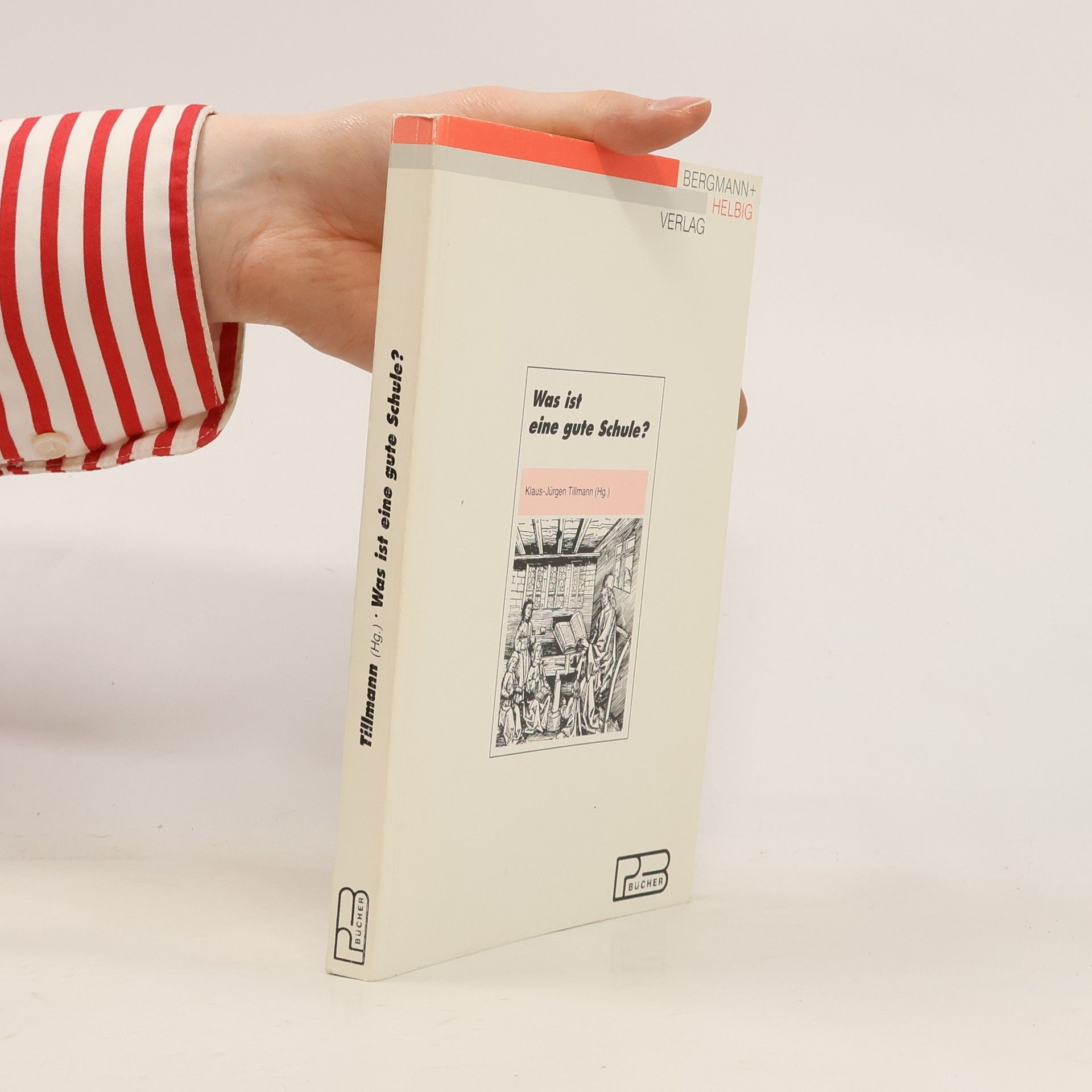

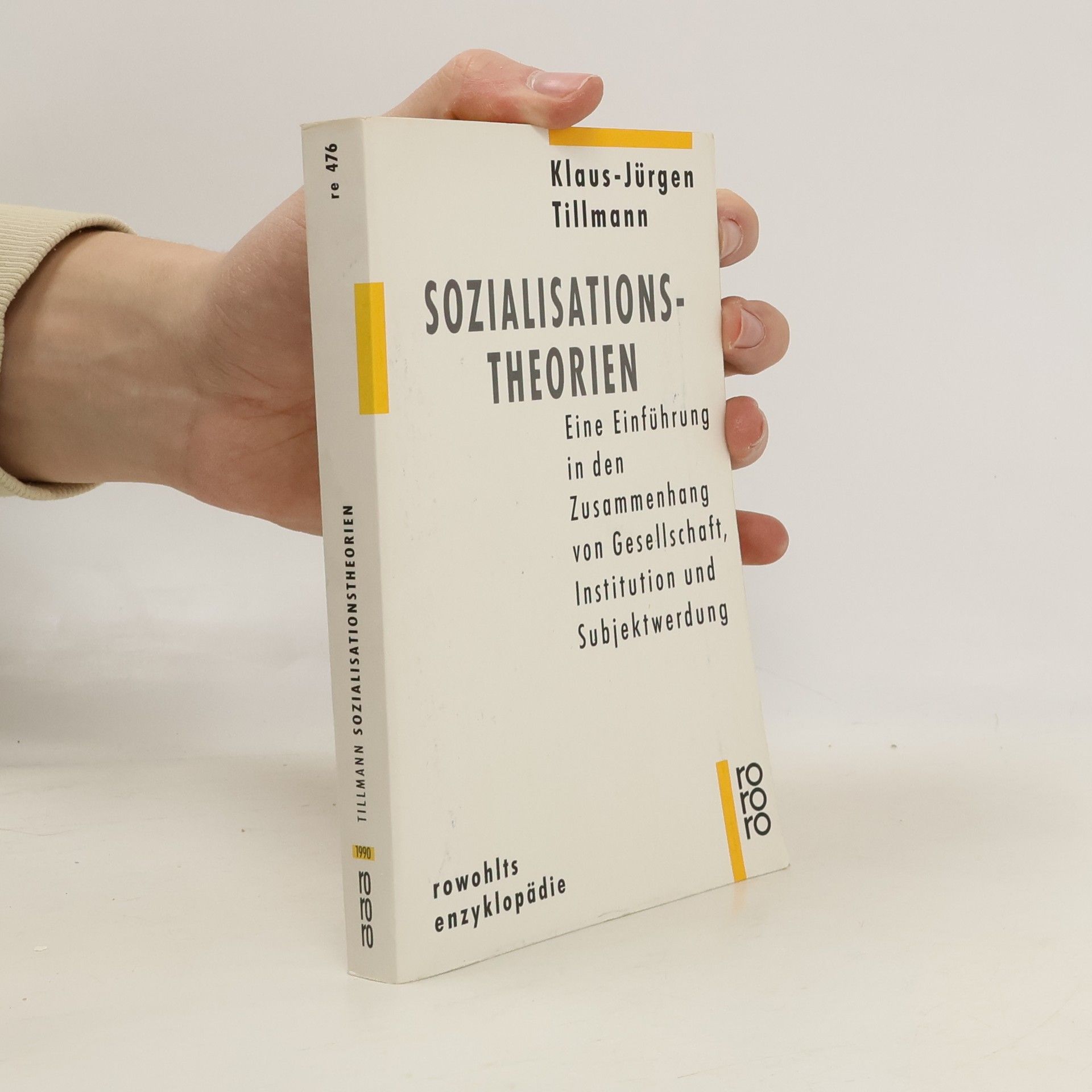
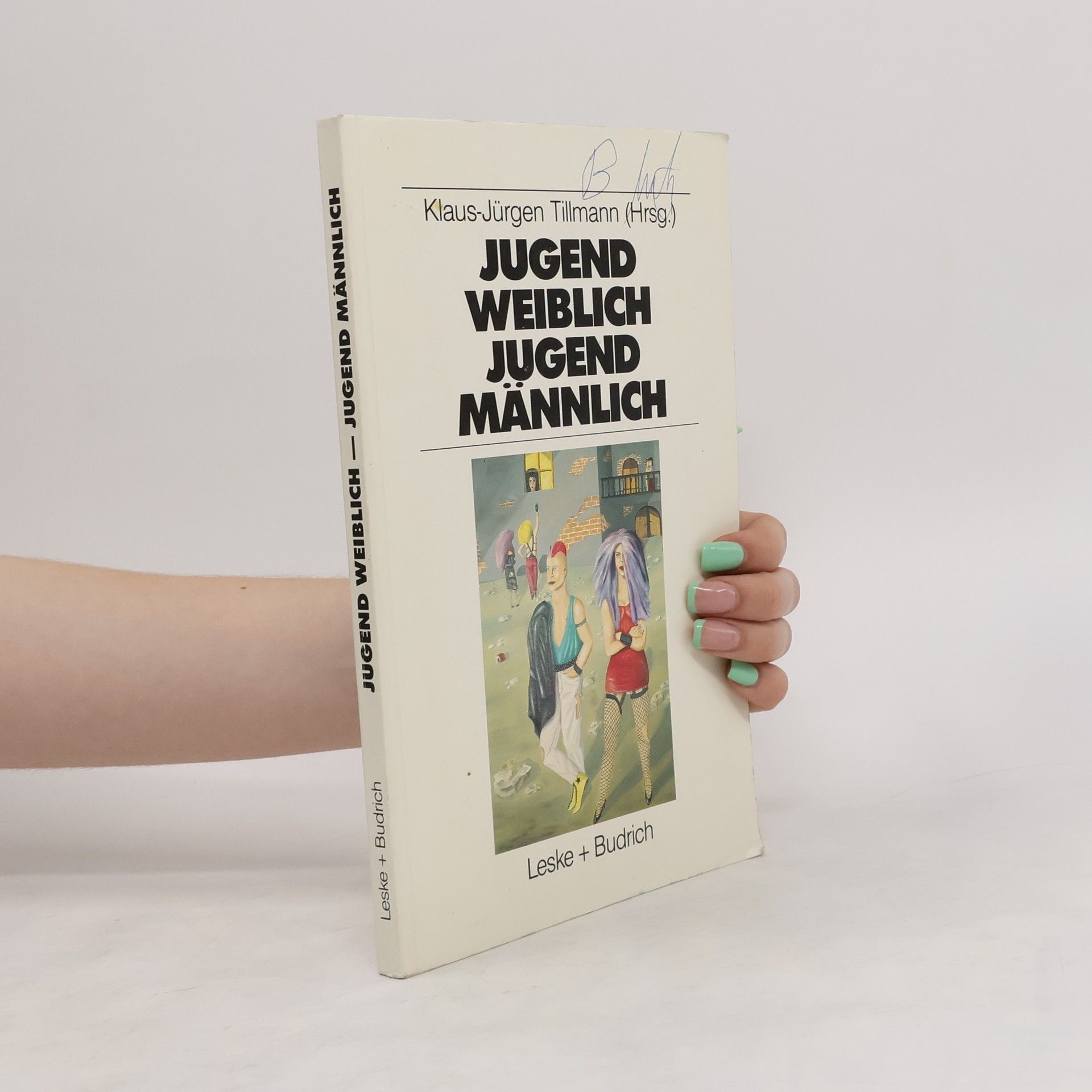
PISA 2000 - die Länder der Bundesrepublik Deutschland im Vergleich
- 254 Seiten
- 9 Lesestunden
Mit dem Ländervergleich zu , PISA 2000' liefert das Deutsche PISA-Konsortium vergleichende Analysen von Schulleistungen in den einzelnen Ländern der Bundesrepublik. Untersuchungsgegenstand ist das Niveau der Lesekompetenz sowie der mathematischen und naturwissenschaftlichen Grundbildung von Jugendlichen im nationalen Vergleich und sein Platz im internationalen Leistungsspektrum. Zur Einordnung der Ergebnisse werden die unterschiedlich hohen Anteile an Jugendlichen aus Migrationsfamilien, die unterschiedliche Sozialstruktur der Länder und die soziale Herkunft der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler berücksichtigt. Die Analysen stehen im Zusammenhang von Bildungspolitischen Bemühungen, die Gleichwertigkeit der schulischen Ausbildung und die Durchlässigkeit der Bildungssysteme in den verschiedenen Bundesländern zu sichern und die Vergleichbarkeit ihrer Schulabschlüsse zu gewährleisten.
Schüler '95: Gewaltlösungen
- 128 Seiten
- 5 Lesestunden
Stimmt eigentlich der weit verbreitete Eindruck, dass Kinder und Jugendliche auch in der Schule vermehrt zu Gewaltlösungen greifen? Dieser Frage gehen die Autoren sorgsam nach. Dabei sind sie kritisch sowohl gegenüber Sensationsmeldungen als auch gegenüber Verharmlosungen. Lehrerinnen, Lehrer und Schulpsychologen berichten ihre Erfahrungen genauso wie Schülerinnen und Schüler, Hausmeister kommen ebenso zu Wort wie Pädagogik-Professoren. Fazit: Diese unterschiedlichen Perspektiven zusammengenommen sind am ehesten geeignet, der Realität in den Schulen möglichst nahe zu kommen.
Während Politiker immer neue Sparprogramme erfinden, wachsen die pädagogischen Anforderungen an die Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer kontinuierlich. Derartige Widersprüche der Schulentwicklung werden aufgezeigt, zugleich wird nach schul- und gesellschaftstheoretischen Erklärungen gesucht: Welche Konsequenzen haben die gesellschaftlichen Umbrüche der 80er Jahre für die Lehrerarbeit? Welche Reformerfahrungen der 70er Jahre sind heute noch von Bedeutung? „Nicht auf bessere Zeiten warten!“ ist der trotzige, bewusst optimistische Vorschlag eines reformengagierten Schulpädagogen angesichts schwieriger werdender Verhältnisse.
InhaltsverzeichnisEinführung.I. Bestandsaufnahme.1. „Spielbubis“ und „eingebildete Weiber“ — 13- bis 16jährige in Schule und peer-group.2. „Fehlgeleitete Machos“ und „frühreife Lolitas“ — Geschlechtstypische Unterschiede der Jugenddevianz.3. Söhne und Töchter in bundesdeutschen Familien — Mehr Kontinuität als Wandel?.II. Forschungsberichte.4. „Heiraten — das kann ich mir noch nicht vorstellen“ — Das psychosoziale Moratorium bei Jungen und Mädchen in der Oberstufe.5. Soviel Mutter wie möglich — soviel Beruf wie nötig — Identität und Lebenspläne von jungen Bankkauffrauen.6. Jungen und Mädchen in der DDR der 80er Jahre.7. Arbeitslose Mädchen in der Weimarer Republik — Zur Geschichte weiblicher Jugend.III. Theoriediskussion.8. Abschied von der Kindheit — Jugend und Geschlecht in psychoanalytischer Sicht.9. Interaktionsforschung und Geschlechtersozialisation — Zur Kritik schulischer Interaktionsstudien.10. Habitus, Lebenslage und Geschlecht — Über Sozioanalyse und Geschlechtersozialisation.
Konkrete Entwürfe einer schüler- und lehrerfreundlichen Schule sind genauso notwendig wie die Darstellung erprobter Schritte dorthin. Die Themen: Eigenschaften und Merkmale einer guten Schule (Fend, Winkel, Bohnsack, Haenisch). Einfluss von Lehrerinnen und Lehrern auf die Schulqualität; es geht u. a. um Lehrerkooperation (Roeder), Unterricht (Helmke) und Lehrerfortbildung (Priebe). Konkrete Beispiele von Schulen, die sich auf den Weg zu einer guten, besseren Schule gemacht haben (Heller/Scheufele, Wein, Riegel, Schulz/ Tillmann, Klaßen).
Klaus-Jürgen Tillmann, geb. 1944, promovierte 1974 an der PH Dortmund zum Dr. paed. Er war Professor für Schulpädagogik an der Universität Hamburg (1979-1990) und Gründungsdirektor des «Pädagogischen Landesinstituts Brandenburg» (1991/92). Von 1993 bis zu seiner Emeritierung 2008 arbeitete er als Professor für Schulpädagogik und Wissenschaftlicher Leiter der «Laborschule» an der Universität Bielefeld. Arbeits- und Forschungsschwerpunkte: Schulreformentwicklung, Sozialisation in Schule und Jugend, Schul- und Unterrichtstheorien.
Es geht um die institutionellen Bedingungen von Schule und um das Verhältnis zwischen Schule und Gesellschaft. Die Autoren: W. Klafki: geistes-wissenschaftliche Konzepte; K. Fingerle: strukturell-funktionale Schultheorien; G. Auernheimer: marxistische Ansätze; M. Brumlik und H. G. Holtappels: Schultheoretische Überlegungen aus interaktionistischer Sicht; M. und G. Muck: Beiträge der Psychoanalyse zu einer Theorie der Schule; H. Dauber: radikale Schulkritik von Freinet und Illich; K.-J. Tillmann: Gegenstand und Geschichte der Schultheorie.
Rororo Sachbuch: Bildung für das Jahr 2000
Bilanz der Reform, Zukunft der Schule
- 188 Seiten
- 7 Lesestunden
German