Wie verhalten sich Sprache und Erfahrung zu einander? Sind die Fragen nach den »Grenzen der Sprache« und den »Grenzen der Sprachlosigkeit« einander entgegengesetzt, gehen sie aufeinander zu? Was geschieht an dem Ort, an dem diese Fragen aufeinandertreffen – wenn sie es tun? Hat der Unterschied der Fragestellung einen historischen Index, also zu je anderen Zeitpunkten unterschiedliche Bewertungen von Schweigen und Kommunikation? Wie sich in den Aufsätzen, die in diesem Band versammelt sind, zeigt, können zwischen den Grenzen der Sprache und den Grenzen der Sprachlosigkeit ganze Denkwelten entstehen. Mit Beiträgen von: Aleida Assmann, Rainer Forst, Carl Friedrich Gethmann, Albrecht von Kalnein, Thomas Kempf, Joseph Leo Koerner, Vivian Liska, Florian Meinel, Igor Narskij, Erik Schilling, Arbogast Schmitt, Melani Schröter
Carl Friedrich Gethmann Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
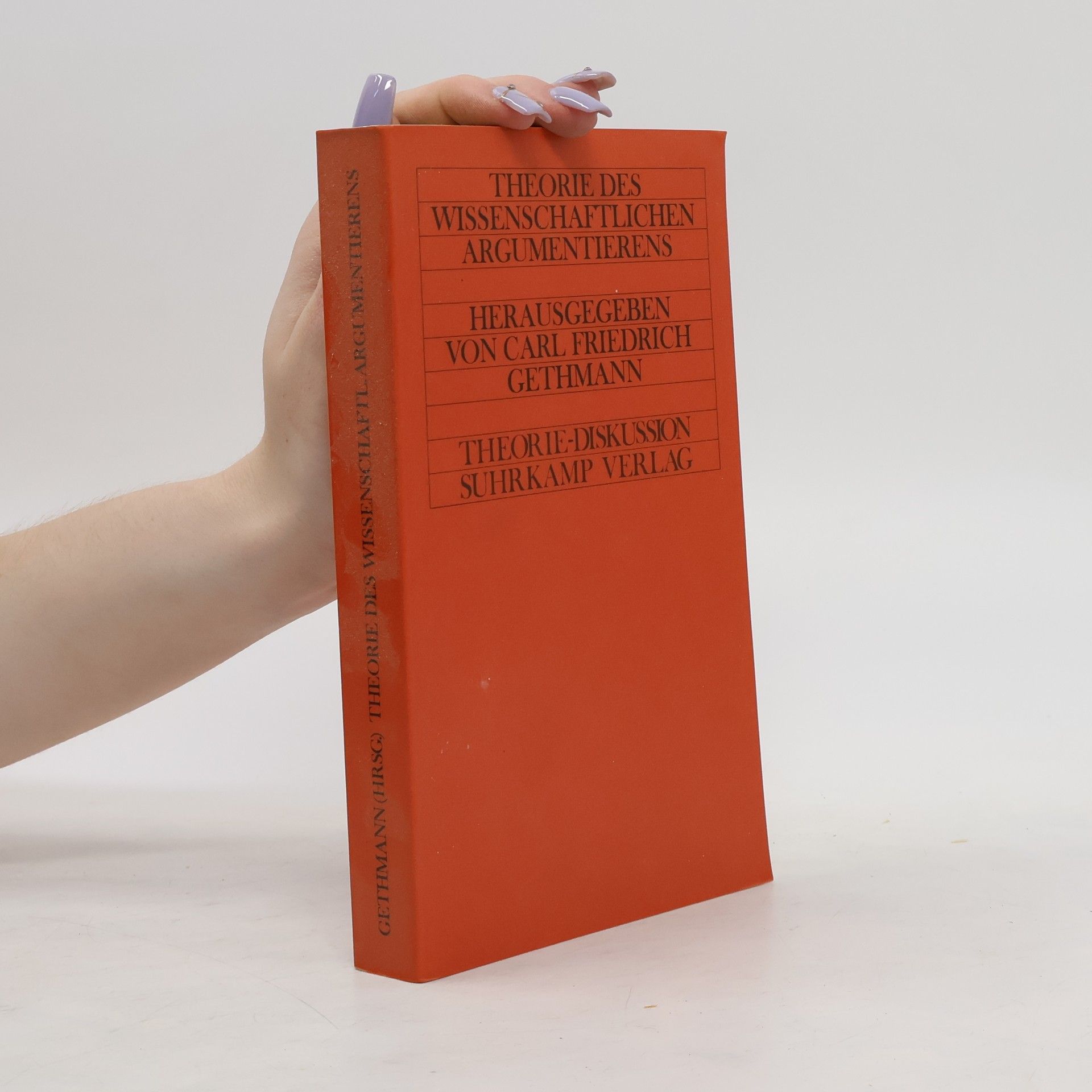
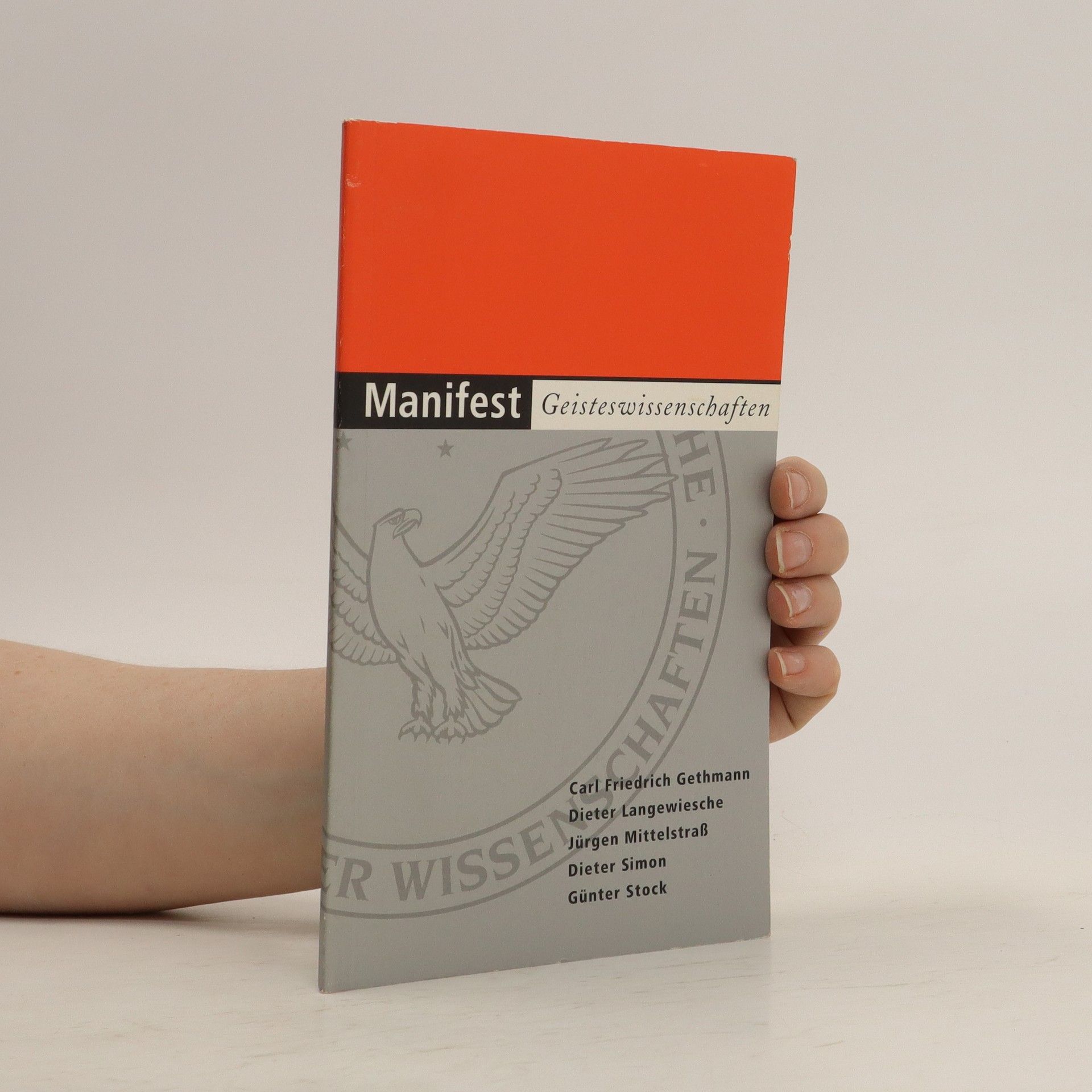



Konstruktive Ethik
Einführung und Grundlegung
Das Buch bietet einen systematischen Gesamtentwurf der Allgemeinen Ethik und damit für den interessierten Leser einen Zugang zu den wichtigsten Fragestellungen der Disziplin Ethik. Dazu werden im Anschluß an eine systematische und historische Einleitung propädeutische Fragen behandelt und die bekannten drei Paradigmen ethischer Reflexion (Tugendethik, Nutzenethik und Verpflichtungsethik) in Orientierung an den klassischen Texten dargestellt. Darauf aufbauend wird die mögliche Komplementarität dieser Paradigmen im Sinne eines Filtermodells sukzessiver ethischer Urteilsbildung entwickelt. Das Buch zeigt, ausgehend von den sprachphilosophischen und wissenschaftsphilosophischen Arbeiten der Erlanger Schule, darüber hinaus, daß moralische Verpflichtungen und Berechtigungen mit ihren unterschiedlichen Graden von Verbindlichkeit ohne starke „realistische“ und wertphilosophische Unterstellungen rekonstruiert werden können.
Künstliche Intelligenz in der Forschung
Neue Möglichkeiten und Herausforderungen für die Wissenschaft
- 179 Seiten
- 7 Lesestunden
Dieses Buch untersucht die Realität der künstlichen Intelligenz (KI) und ihre Auswirkungen auf Forschung und Gesellschaft. Es beleuchtet Chancen und Risiken, die Ersetzbarkeit des Menschen durch KI sowie die Herausforderungen für rechtliche Rahmenbedingungen. Abschließend werden Empfehlungen für verantwortliche Akteure gegeben.
Manifest Geisteswissenschaften
- 39 Seiten
- 2 Lesestunden