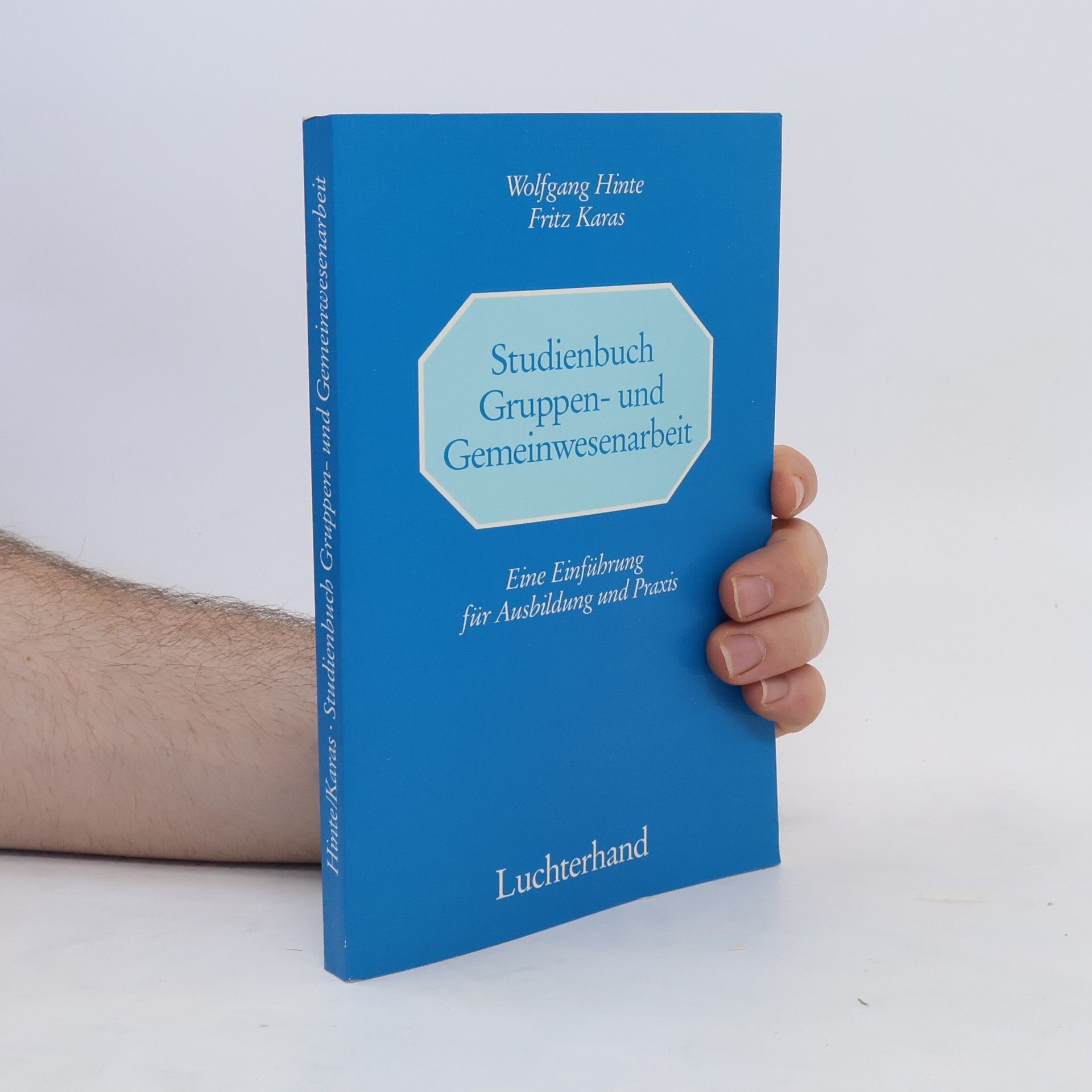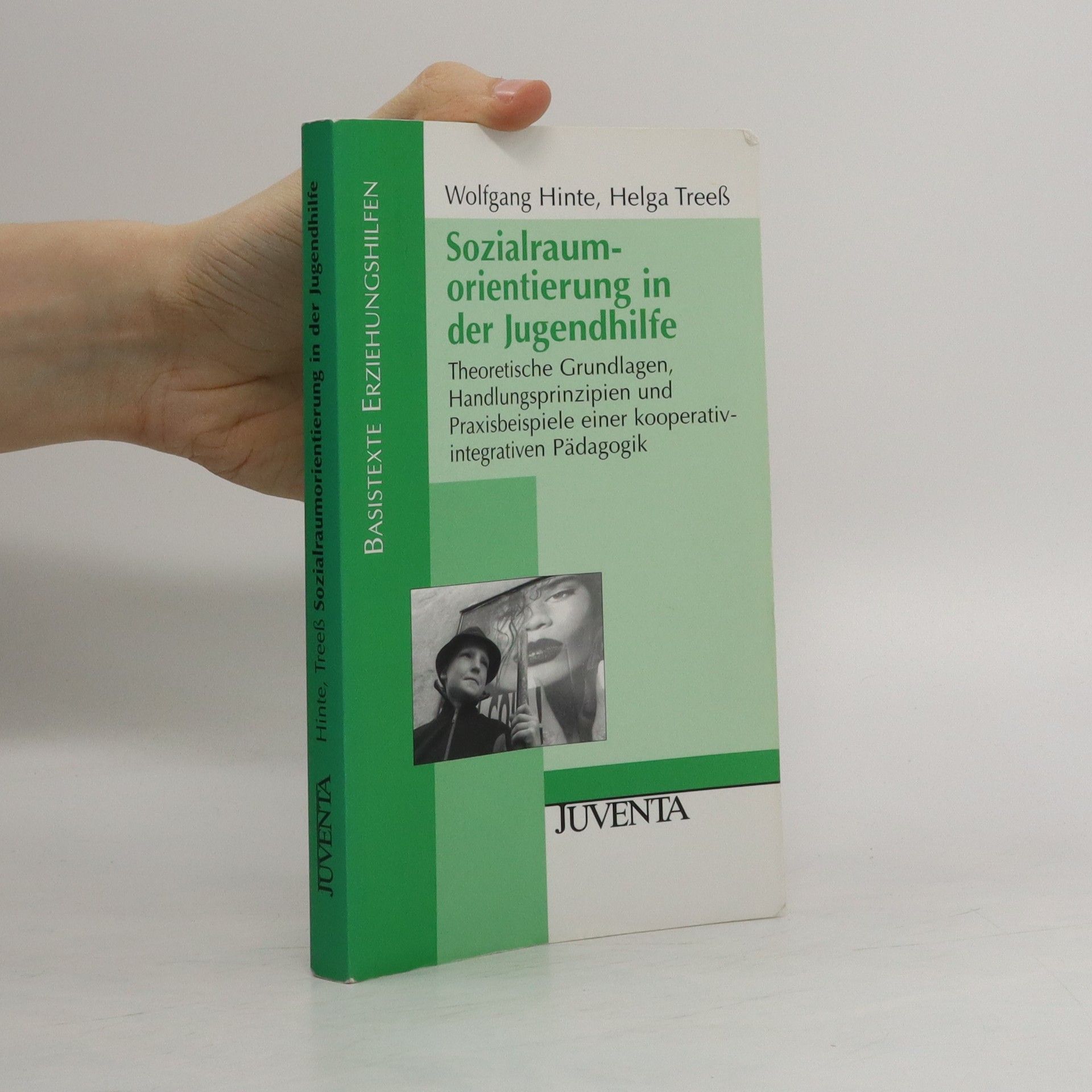Sozialraumorientierung in der Jugendhilfe
- 238 Seiten
- 9 Lesestunden
Das Fachkonzept Sozialraumorientierung findet vor allem in der Kinder- und Jugendhilfe sowie im Quartiermanagement breite Aufmerksamkeit. In zahlreichen Debatten und Praxisprojekten wird man indes mit einer recht großen Bandbreite an expliziten und impliziten Definitionen von Sozialraumorientierung konfrontiert.