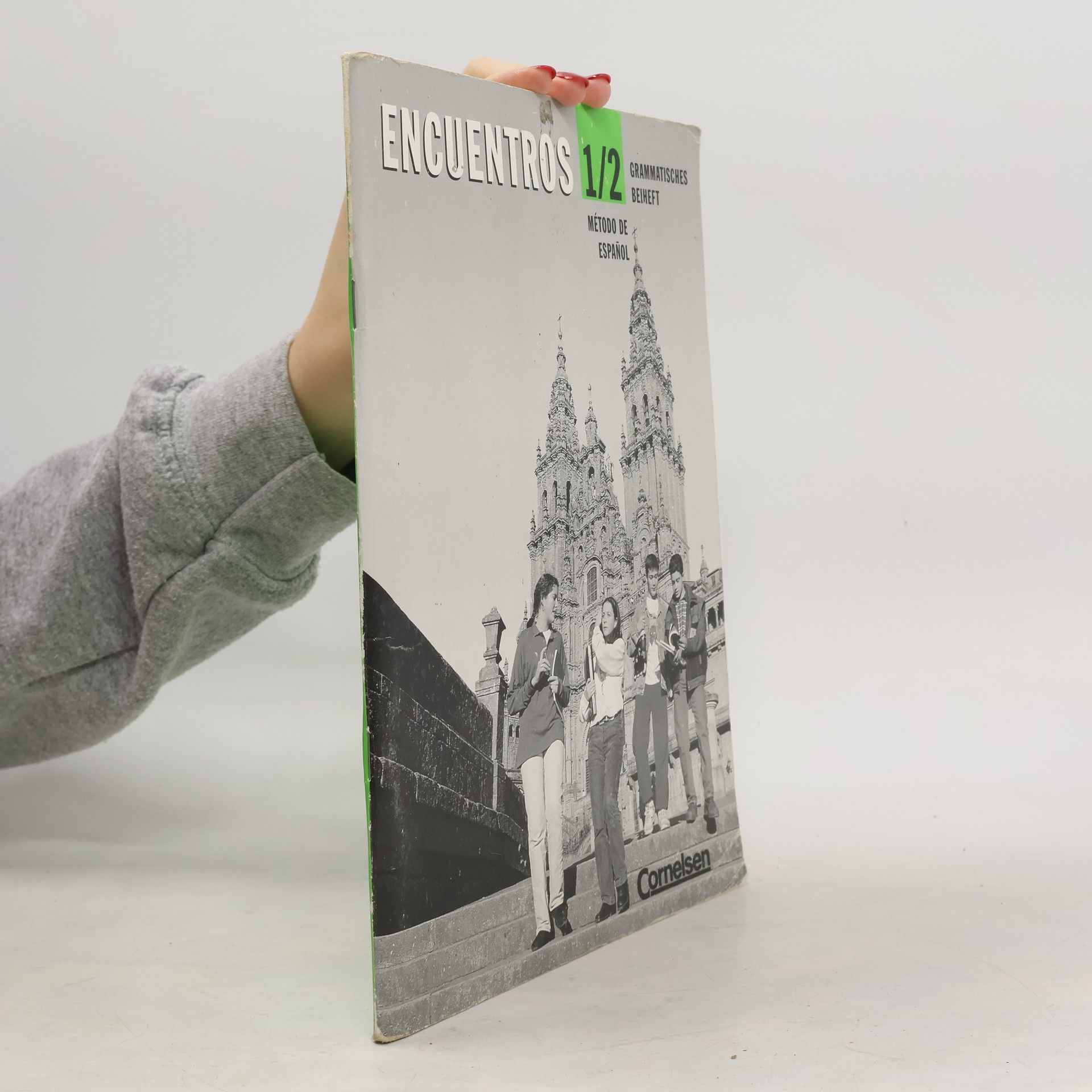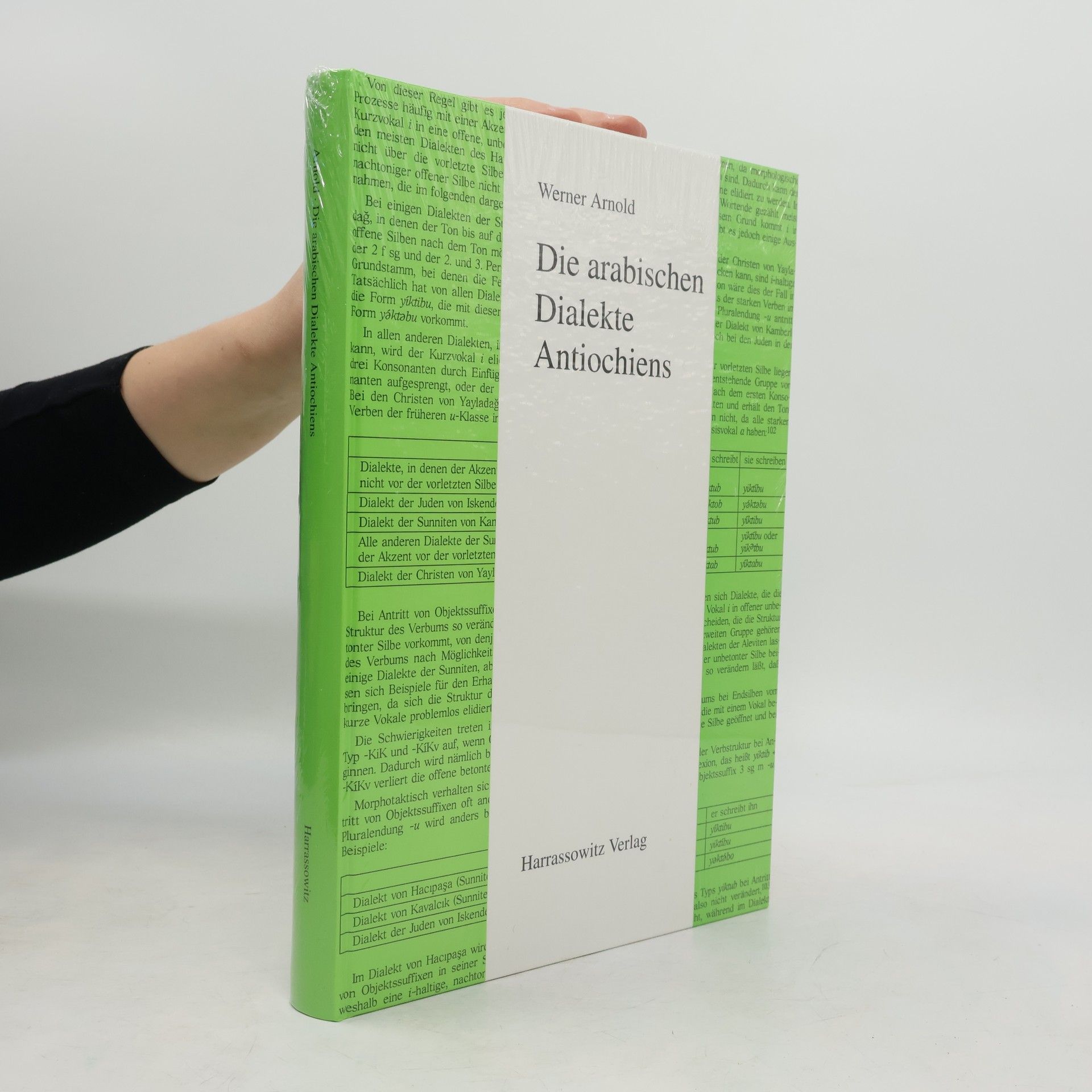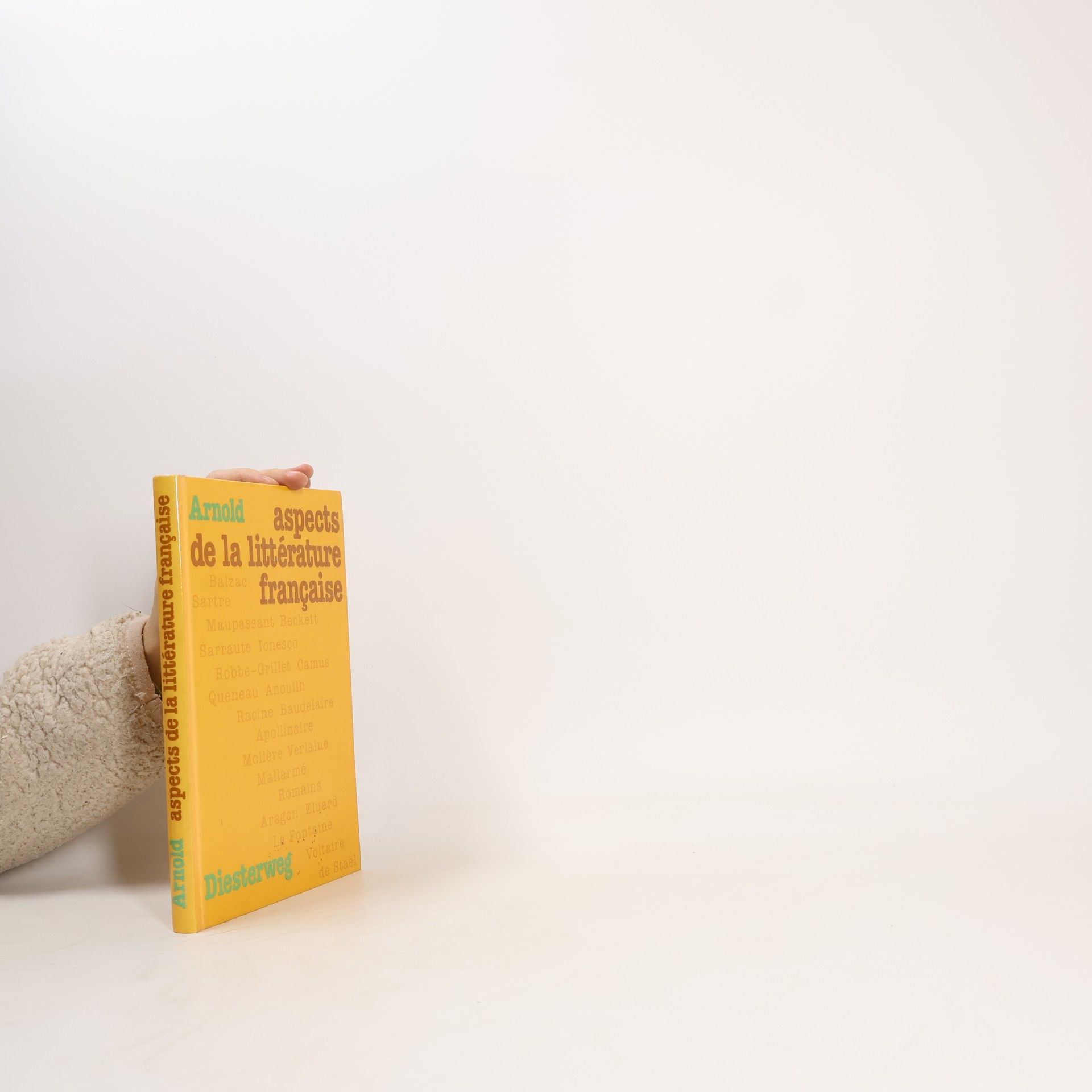Juden in der arabischen Welt - Blütezeit und Vertreibungen
- 28 Seiten
- 1 Lesestunde
In der europäischen und amerikanischen Öffentlichkeit ist der Eindruck entstanden, dass Islam und Judentum einen unüberbrückbaren Gegensatz bilden. Eine vertiefende geschichtliche Betrachtung bestätigt diesen Eindruck allerdings nicht. Der im 7. Jahrhundert entstandene Islam hat viele jüdische Traditionen in den Koran aufgenommen. Auch haben muslimische Herrscher jüdische Gemeinden als „Volk des Buches“ (ahl al-kitab) angesehen. Sie durften wie Christen und persische Zoroastrier ihre Religion im Gegensatz zu den Heiden behalten. Als Schutzverwandte oder „Dhimmis“ waren sie zwar nicht gleichberechtigt, doch kam es zu einem erträglichen Nebeneinander und das immerhin während 1300 Jahren vom 7. Jahrhundert bis in die 1930er Jahre. Im mittelalterlichen Andalusien, im Irak und in Ägypten entstand sogar ein fruchtbares kulturelles Miteinander: Es gab jüdische arabische Dichter, Religionsphilosophen, Rechtsexperten oder Bibelexegeten, die ihre Werke auf Arabisch und nicht nur auf Hebräisch veröffentlichten. Die tiefe Verwurzelung großer jüdischer Gemeinschaften in der arabischen Kultur und den Zusammenhang von Sprache und Religion beleuchtet Professor Werner Arnold, Semitist der Universität Heidelberg, in der neuen Ausgabe der auf dieses spannende Thema aufmerksam machenden „Donnerstagshefte“.