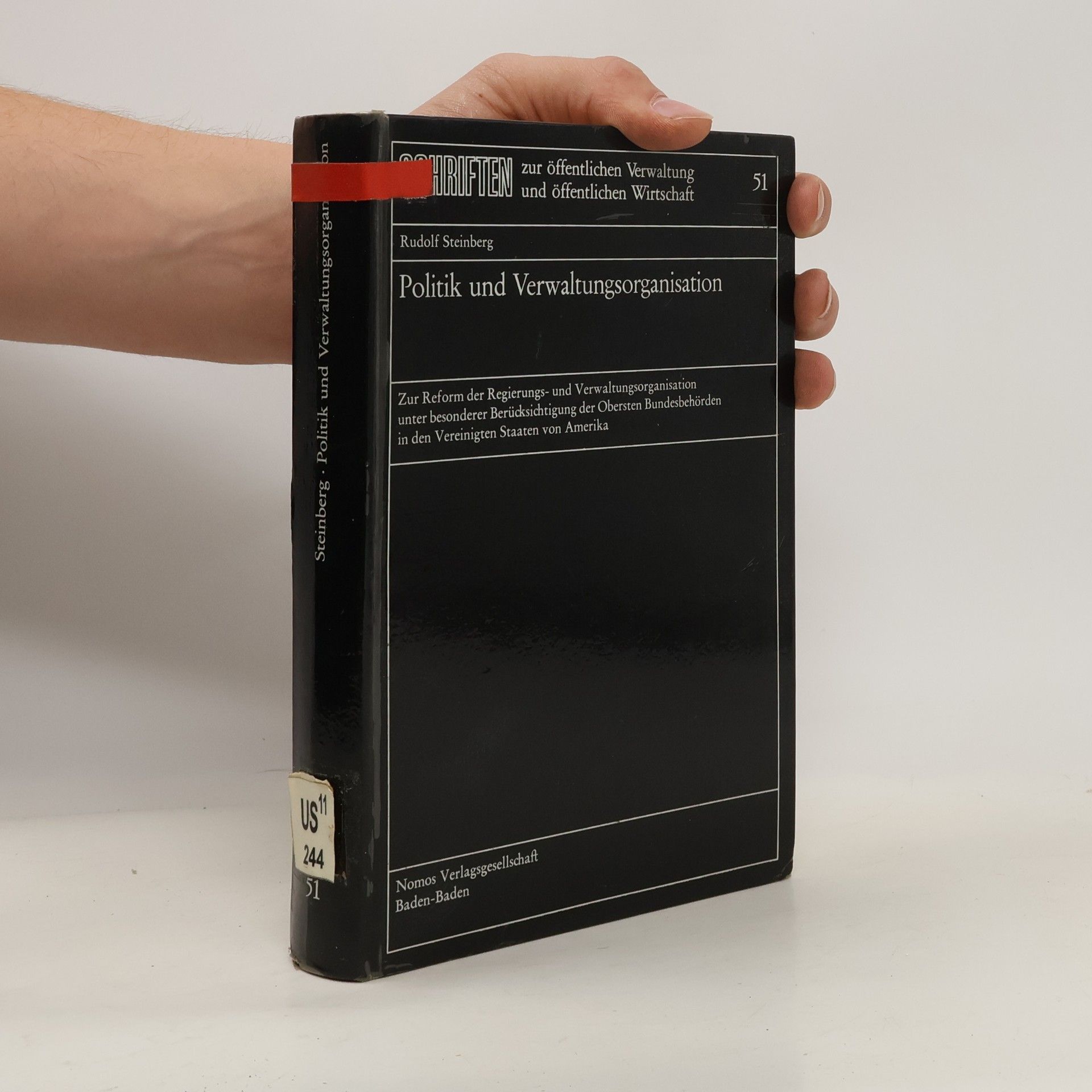Vom Staatskirchenrecht zu einem zeitgemäßen Religionsrecht
Religion in einer multireligiösen Gesellschaft
- 147 Seiten
- 6 Lesestunden
Der tiefgreifende Strukturwandel der Religion kann nicht ohne Auswirkungen auf die rechtliche Ordnung der Religionsgemeinschaften bleiben. Es werden unterschiedliche Entwicklungspfade der Kirchen beschrieben und gezeigt, welche Konsequenzen diese fur das uberkommene Staatskirchenrecht besitzen. Dafur werden die von Soziologen und Theologen gewonnenen Erkenntnisse fur die Diskussion uber die rechtliche Ordnung von Religion fruchtbar gemacht; dies stellt auch die zentralen Institute des 100 Jahre alten Staatskirchenrechts in Frage. Dabei gilt es ebenso, einen Ort fur den Islam auf Augenhohe mit den Kirchen zu finden.