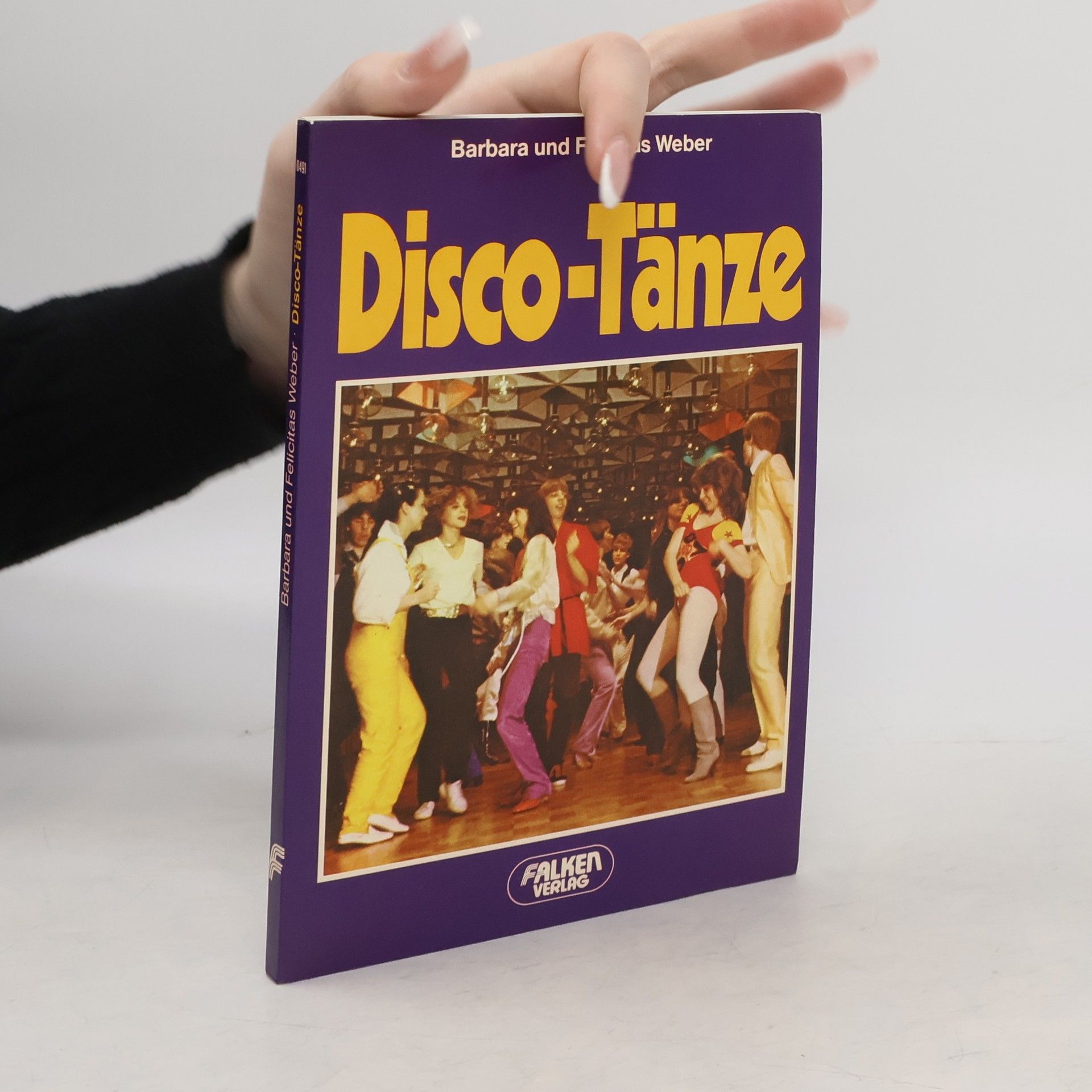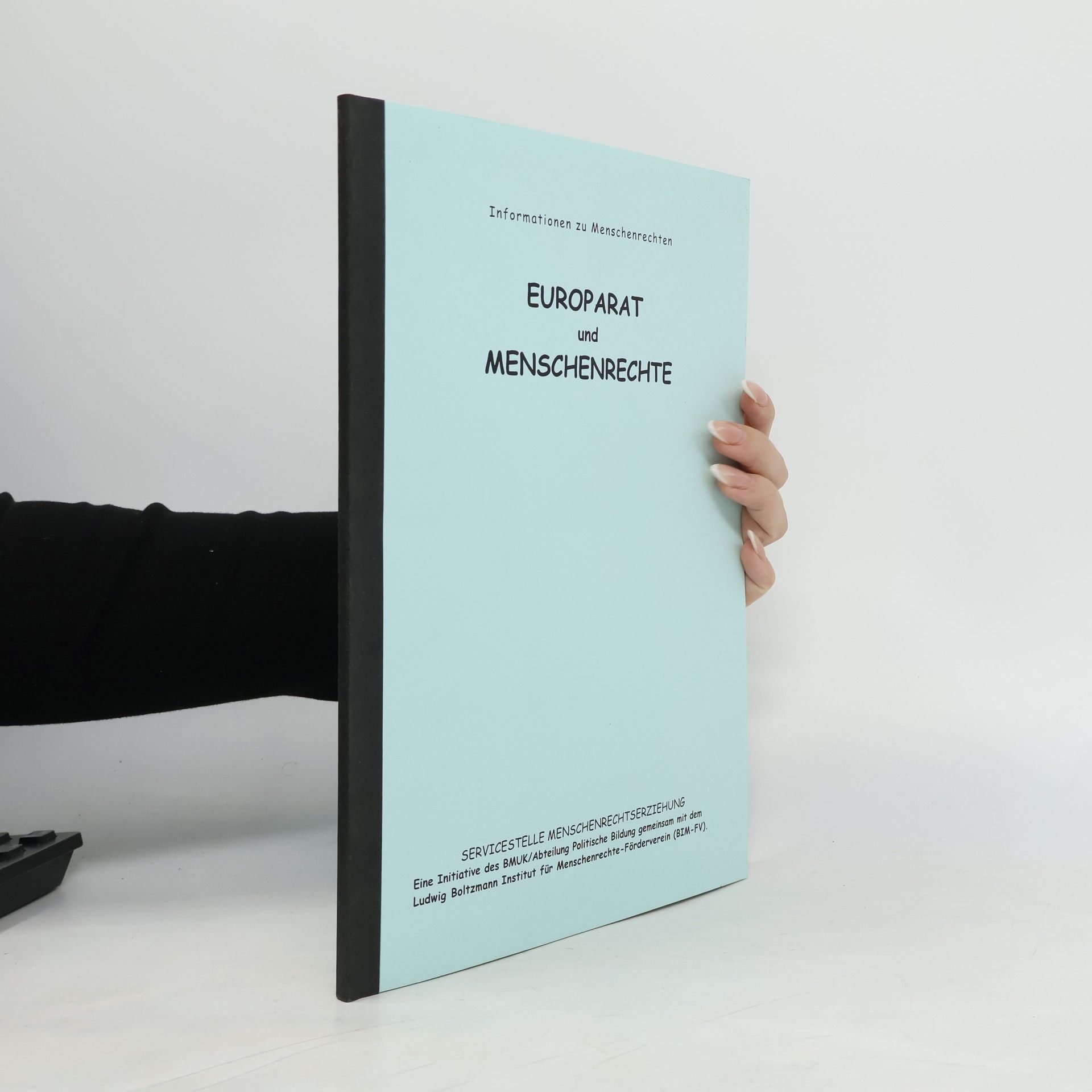Die handlichen Bände bieten klar, übersichtlich und kompakt das Basiswissen für Schüler/innen der Klassen 5 bis 10.
Barbara Weber Bücher

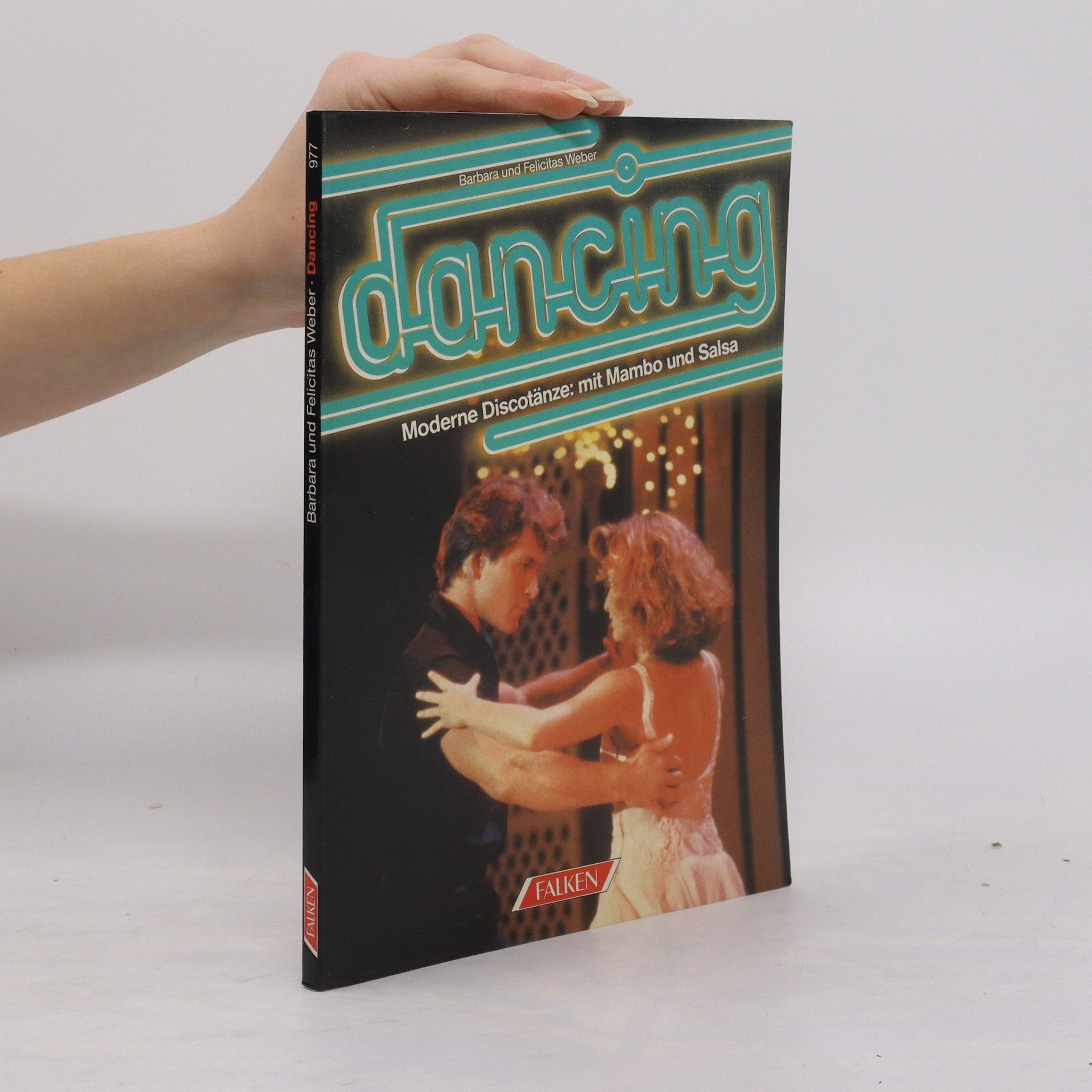
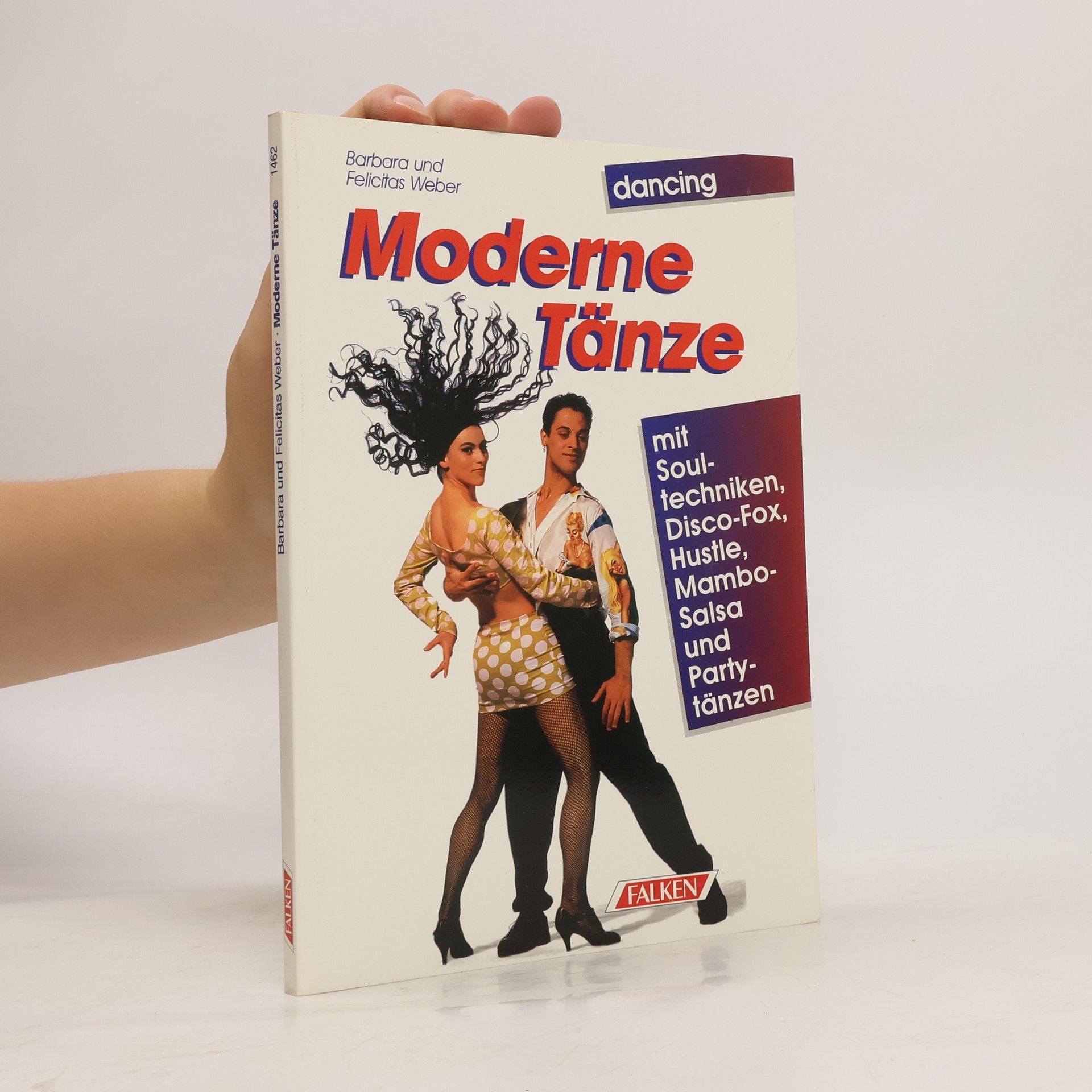
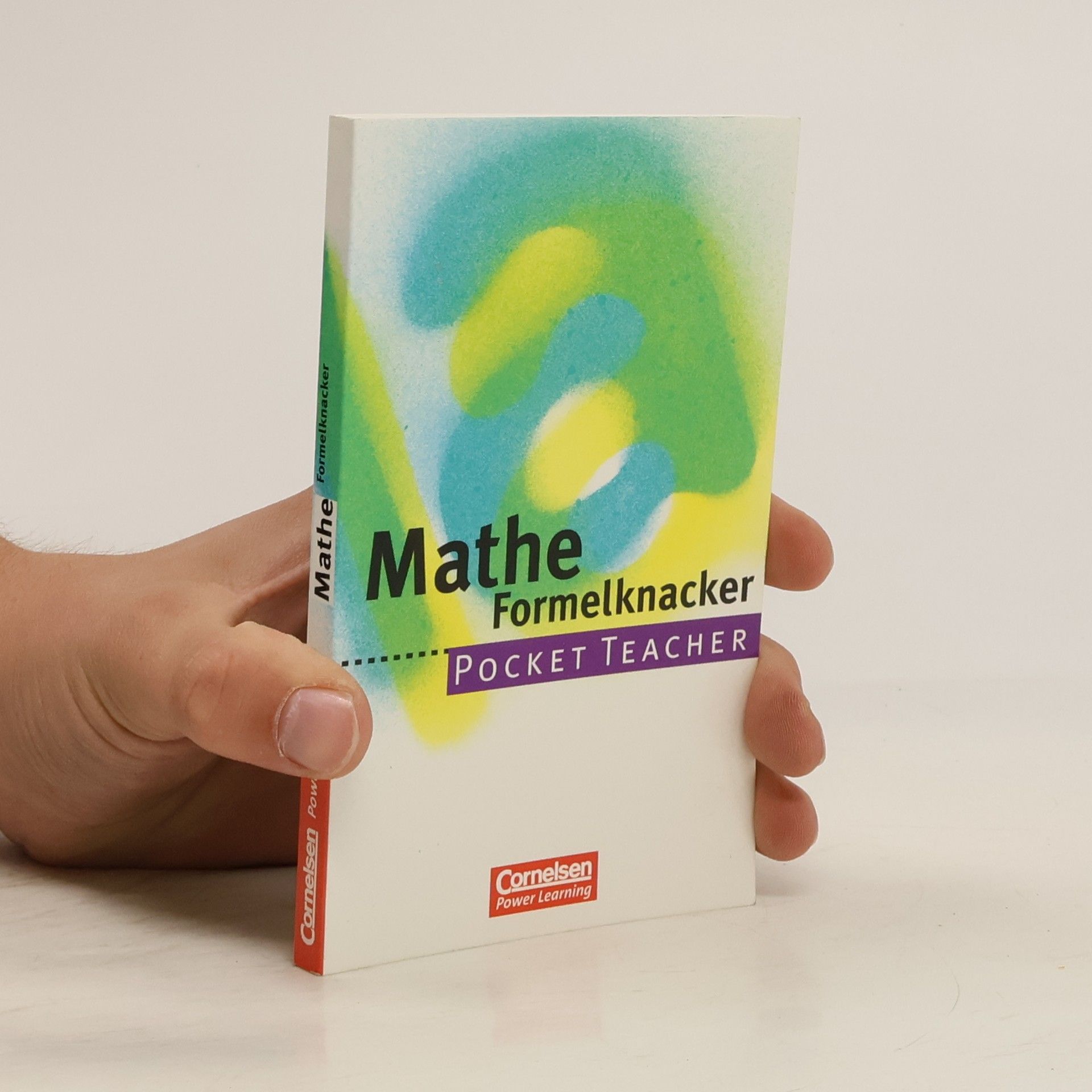

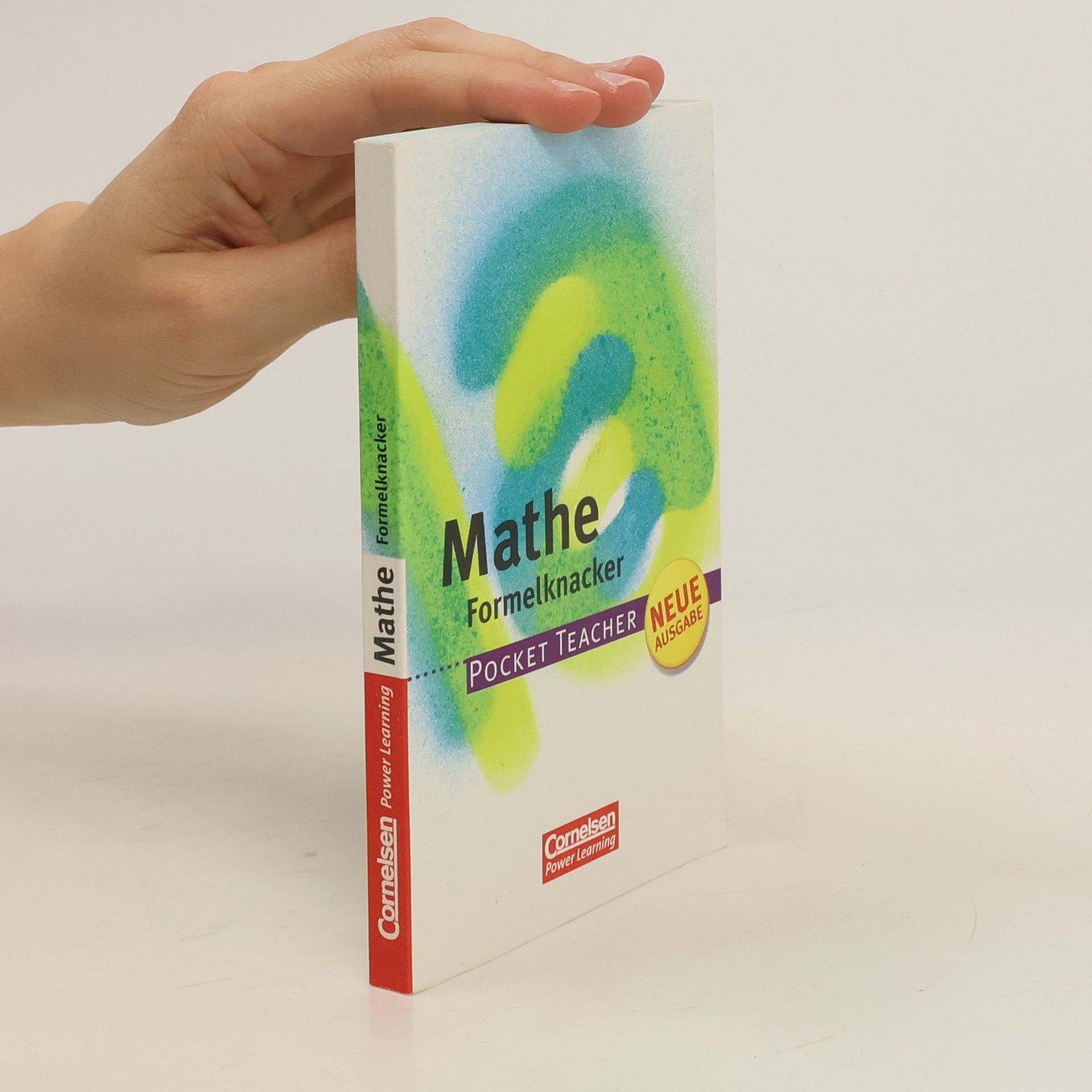
Zürich hat seine Reformation gefeiert. Im Anschluss an die Luther-Dekade in Deutschland, aber auf eigenständige Weise – aus dezidiert gesellschaftlicher Sicht. Als «Langzeit-Festival» konzipiert, wurde über einen Zeitraum von nahezu zwei Jahren ein vielfältiges Kulturprogramm realisiert, das sich mit der Reformation in Zürich und deren zentraler Figur, Huldrych Zwingli, auseinandersetzte. Die Reformation als historische Zäsur, die die Entwicklung Zürichs in hohem Masse geprägt hat und mehr denn je ambivalent wahrgenommen wird: Zwingli steht nicht nur für religiöse Erneuerung, Selbstermächtigung und politischen Mut, sondern vielen auch für moralische Rigidität und Lustfeindlichkeit, die das Zürich von heute überwunden glaubt. In der kritischen Auseinandersetzung mit der Reformation, ihren Errungenschaften und ihrem Nachhall ging es der künstlerischen Leitung, bestehend aus Barbara Weber und Martin Heller, darum, die Situation mit einem heutigen Blick zu betrachten, weiterführende Fragen zu stellen und mit einem breiten Publikum zu teilen. Das vorliegende Buch fasst in Bild und Text sämtliche Aktivitäten zum Zürcher Reformationsjubiläum anschaulich und in attraktiver Buch-Form zusammen.
Dancing
- 95 Seiten
- 4 Lesestunden
Kleine Geschichten von der Unendlichkeit des Schonen (German Edition) by Barbara Weber. 1985 hardcover published by Scherz. Text in German.
Dumont Extra: London. Extra Reiseführer
Topaktuelle Infos. Nützliche Tipps. Extra-Touren - Ausgabe '98 - Mit großer Extra-Karte!
- 96 Seiten
- 4 Lesestunden