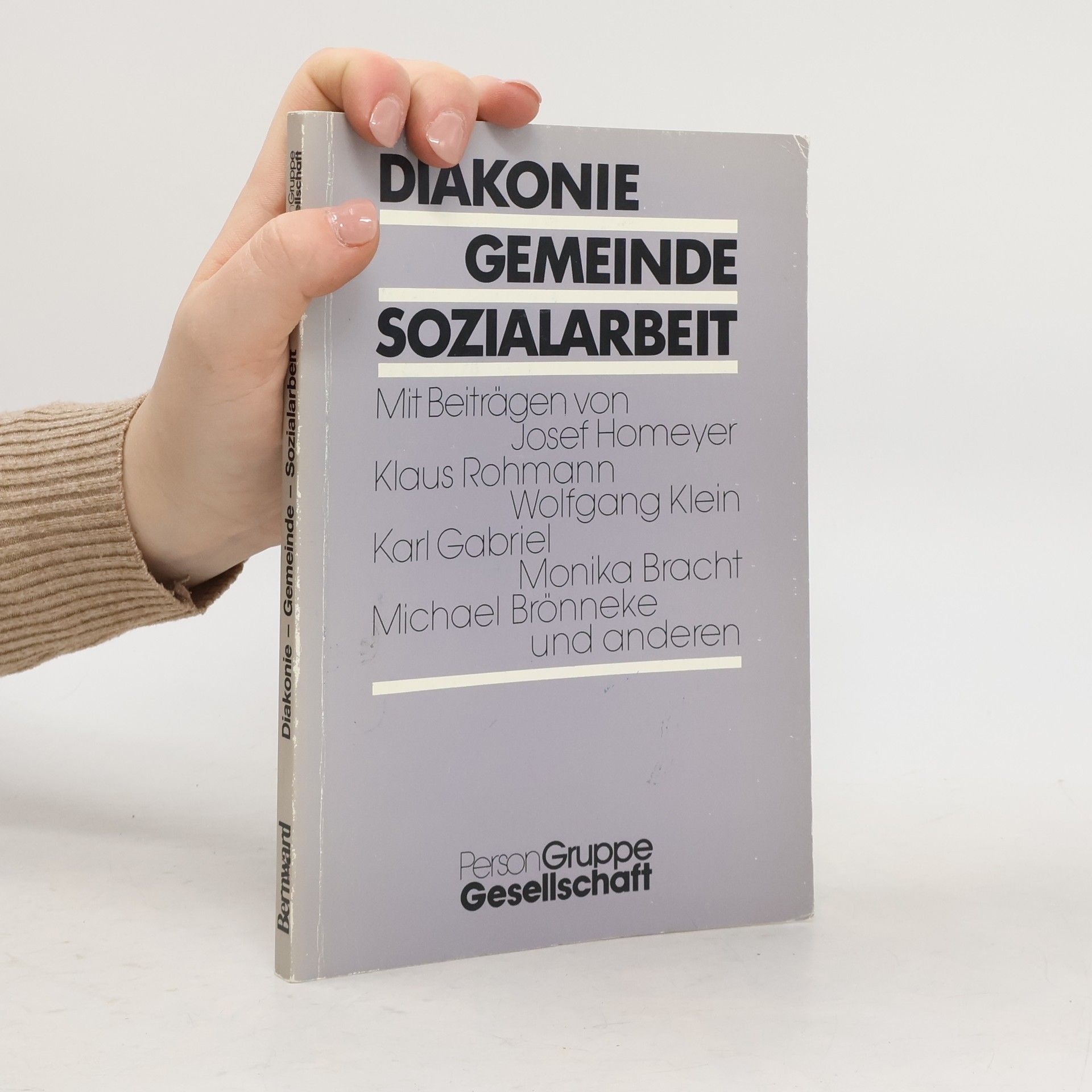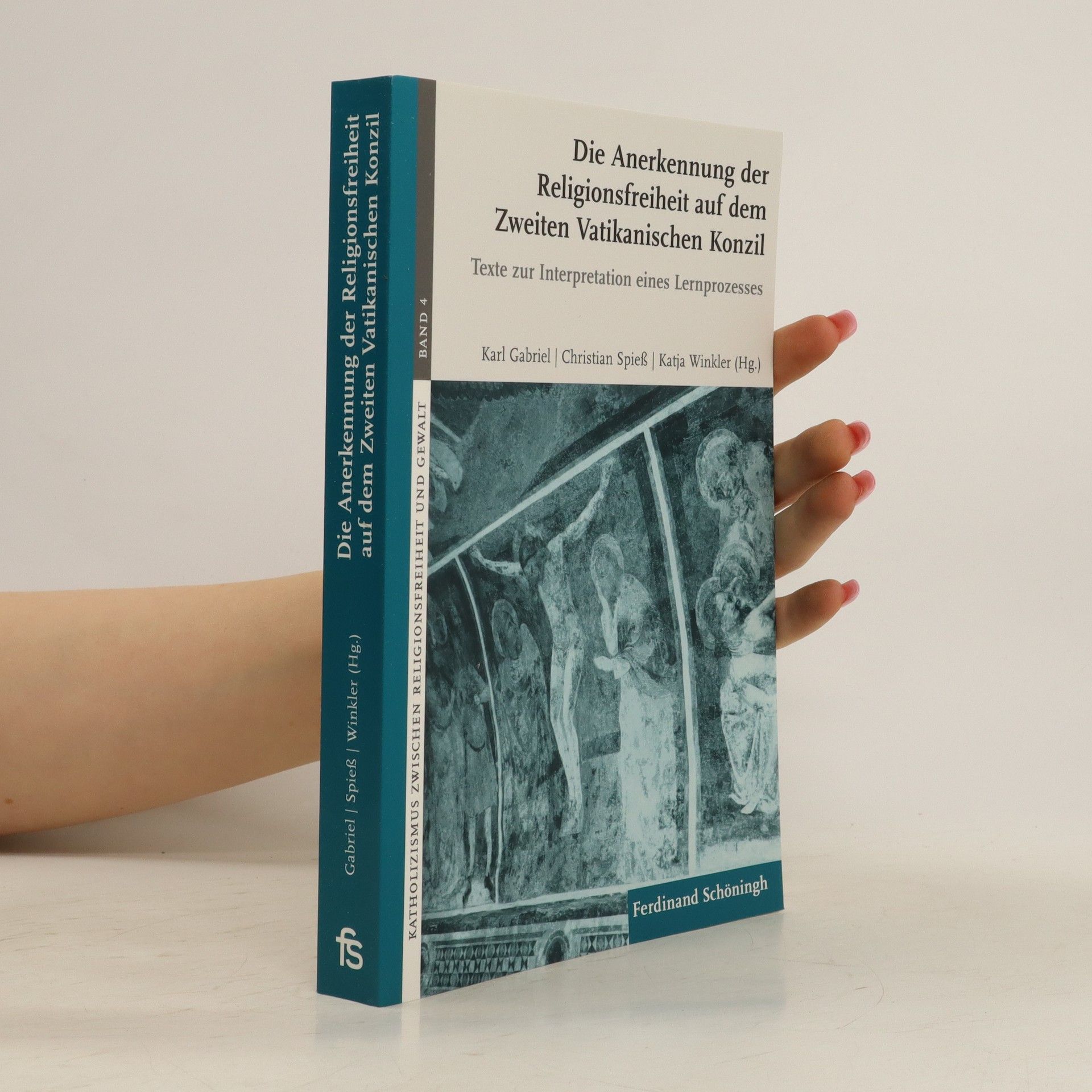Seit den 1960er Jahren ist auf dem deutschsprachigen Buchmarkt keine Zusammenstellung grundlegender religionssoziologischer Texte mehr erschienen, obwohl es in der Entwicklung des Faches bedeutende Neuansätze gibt und das Thema „Religion und Gesellschaft“ zunehmend an Aktualität gewinnt. Das Buch bietet nun seit langer Zeit wieder eine am aktuellen Diskussionsstand orientierte, schlüssige Auswahl, die von einem renommierten Herausgeber-Duo gekonnt eingeleitet und kommentiert wird.
Karl Gabriel Bücher
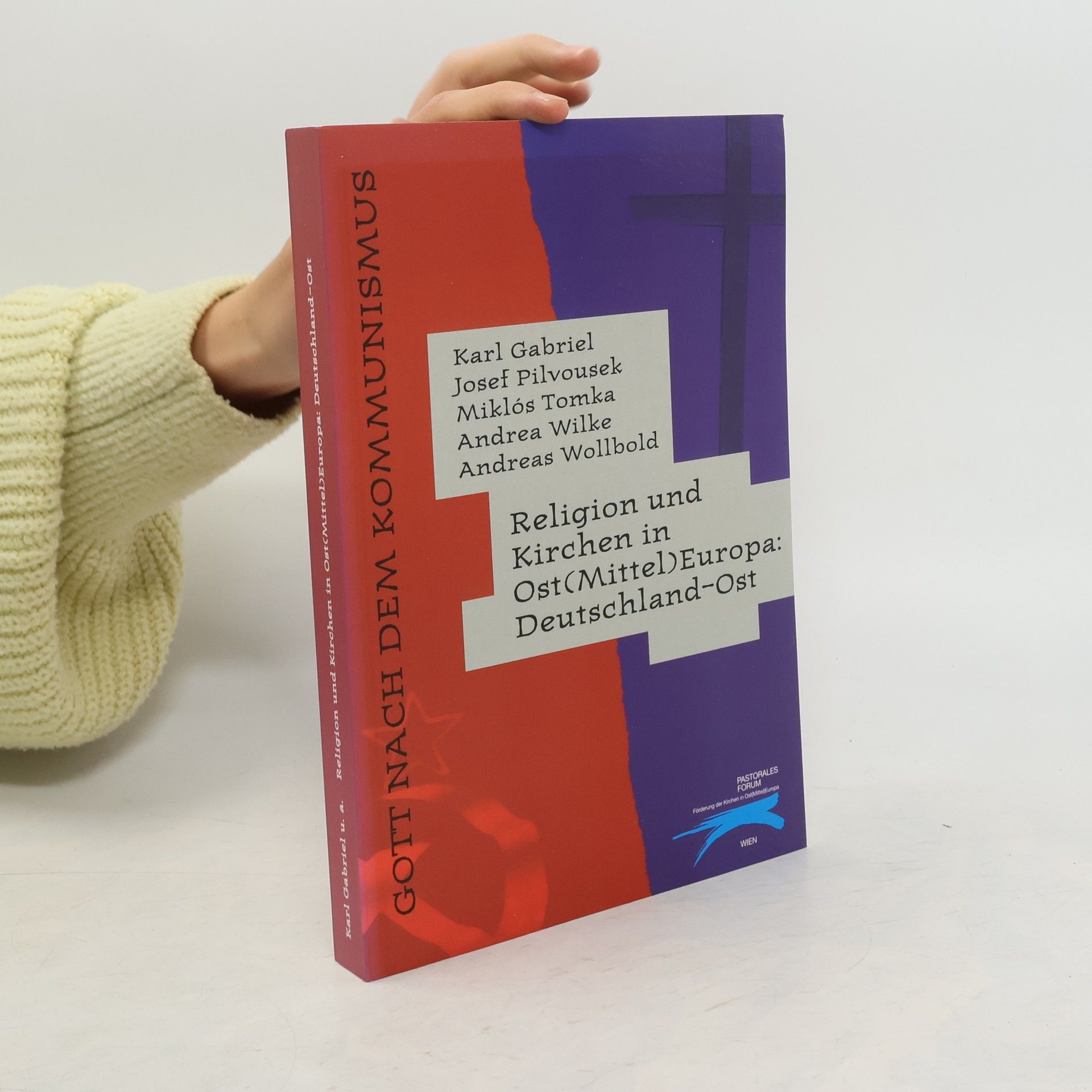



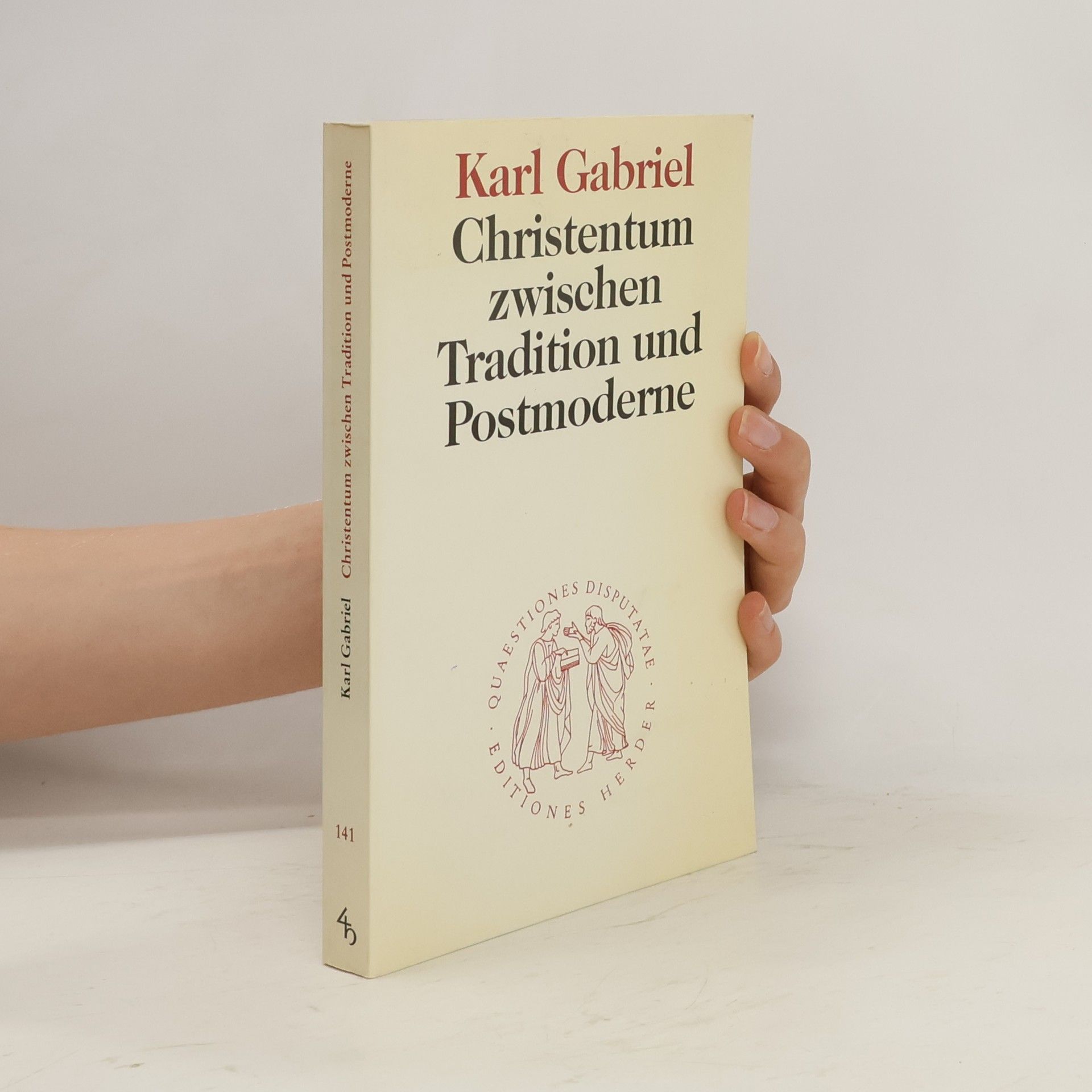

Häutungen einer umstrittenen Institution
Zur Soziologie der katholischen Kirche
Die vielen Gesichter der Religion
Religionssoziologische Analysen jenseits der Säkularisierung
Die soziale Macht des Christlichen
Religion und Wohlfahrt in Deutschland und Europa
Religion und Kirchen in Ost(Mittel)Europa
- 400 Seiten
- 14 Lesestunden
Gerade in Deutschland-Ost lässt sich bestens erkennen, wie sehr das Schicksal der Religion an das Schicksal der Kultur gebunden ist. Drei kulturelle Phasen folgten einander nahezu bruchlos und verstärkten sich gegenseitig in ihrer Wirkkraft auf die Religion: der individualisierende Kulturprotestantismus, der Nationalsozialismus und das kommunistische DDR-Regime. Die „Frucht“: Die neuen Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland zählen neben der tschechischen Republik zu den atheisierenden Regionen Europas. Neben den quantitativen Analysen zur Lage von Religion und Kirche finden sich hier auch die Forschungsergebnisse aus dem qualitativen Studienteil für diese postkommunistische Region. Die vielen religionssoziologischen und zeitgeschichtlichen Analysen bieten eine hilfreiche Grundlage für die Arbeit jener in Gesellschaft und Kirchen, die sich für das Wohl der Menschen und deren Zusammenleben in Freiheit und Solidarität engagieren.
Diakonie, Gemeinde, Sozialarbeit
- 162 Seiten
- 6 Lesestunden
Grenzfragen - 28: Religion. Entstehung - Funktion - Wesen.
- 250 Seiten
- 9 Lesestunden
Die Anerkennung der Religionsfreiheit auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil
Texte zur Interpretation eines Lernprozesses
- 287 Seiten
- 11 Lesestunden
Die Anerkennung der Religionsfreiheit auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil stellt einen historisch außergewöhnlichen Akt des Gewaltverzichts durch eine Religionsgemeinschaft dar. Vor allem mit der Erklärung »Dignitatis humanae – Über die Religionsfreiheit« verabschiedet sich die Kirche von der Vorstellung eines »katholischen Staates« und bestätigt damit lehramtlich die Trennung von Religion und Politik. Nachdem die katholische Kirche vor allem im 19. Jahrhundert und bis weit in das 20. Jahrhundert hinein bestimmte Freiheitsrechte, wie eben die Religionsfreiheit, entschieden abgelehnt und an der Idee eines konfessionellen Staates festgehalten hat, war der Schritt zu ihrer Anerkennung eine enorme Herausforderung. Ziel des Bandes ist es, den politischen Gewaltverzicht der katholischen Kirche als Lernprozess darzustellen, der – aus je unterschiedlichen Perspektiven – unterschiedlich interpretiert werden kann.