In den westlichen Ländern nimmt die Zahl derjenigen, die von der Alternativ- und Komplementärmedizin Gebrauch machen, noch immer zu. Die Umsätze dieses zweiten Gesundheitsmarktes bewegen sich in Milliardenhöhe, wobei der größte Teil der Kosten von den Nutzern aus eigener Tasche bezahlt werden. Die Frage ist allerdings, ob die zahlreichen Angebote, die von Naturheilverfahren über energetische Praktiken bis hin zu Phytopharmaka reichen, das halten, was sie versprechen. Dieses Buch versucht, einen selbst für Fachleute undurchschaubaren Markt kritisch zu sichten und zu bewerten. Dazu werden die meisten der hierzulande zugänglichen Verfahren mit ihrem jeweiligen Entstehungshintergrund, ihrer Methodik und den bekannten Kontraindikationen auf der Grundlage von aussagekräftigen Studien der letzten zehn Jahre dargestellt. Jede Darstellung schließt mit einer Gesamteinschätzung ab, welche eine bessere Orientierung für empfehlende Fachleute ebenso wie für interessierte Nutzer erlaubt. Das Buch wendet sich in erster Linie an Ärzte, Psychologen und andere Gesundheitsberufe sowie an Akteure im Gesundheitswesen, die über die Förderungswürdigkeit des einen oder anderen Verfahrens zu entscheiden haben. Die Autoren des Buches sind ein Gesundheitspsychologe und ein naturheilkundlich tätiger Arzt.
Hans Wolfgang Hoefert Bücher
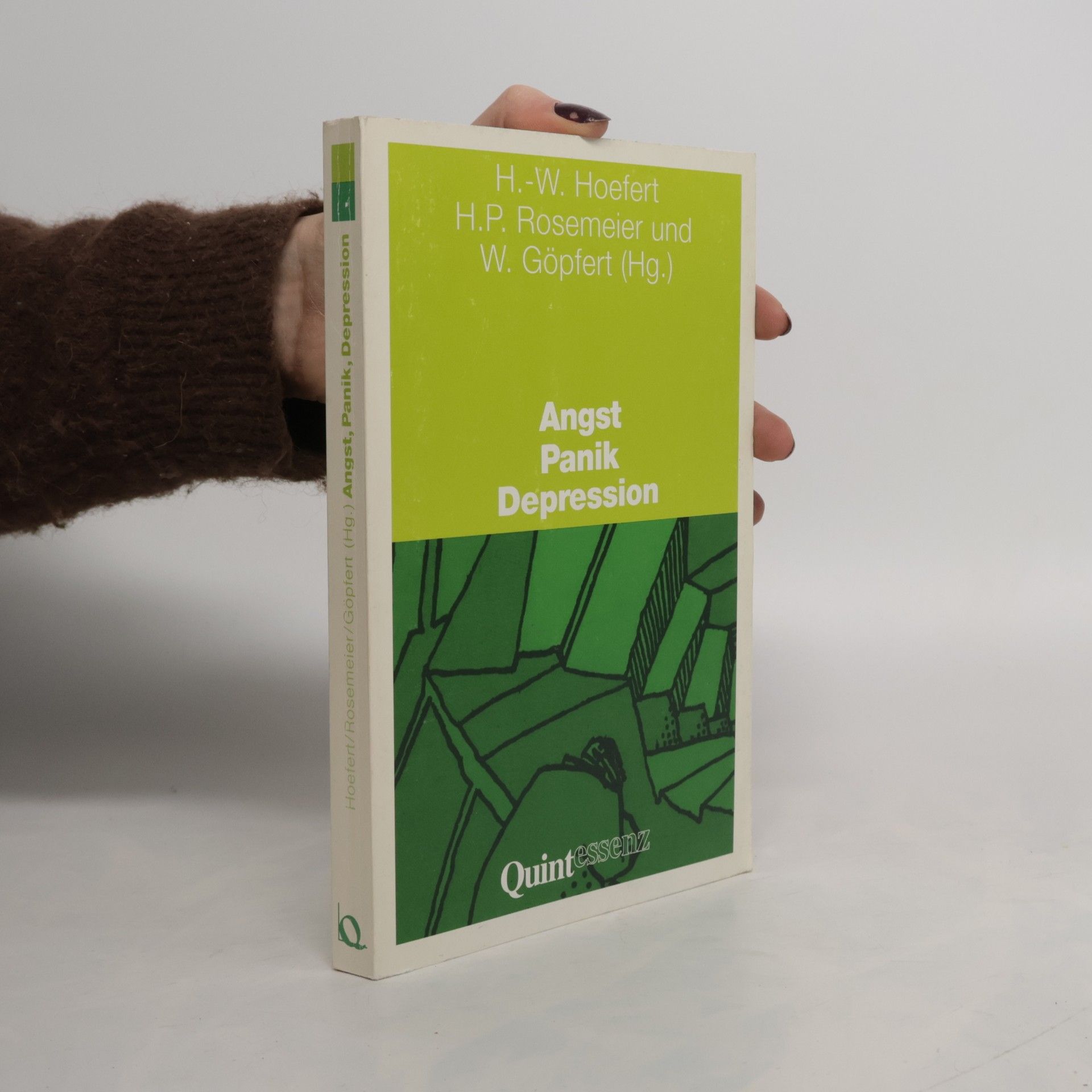
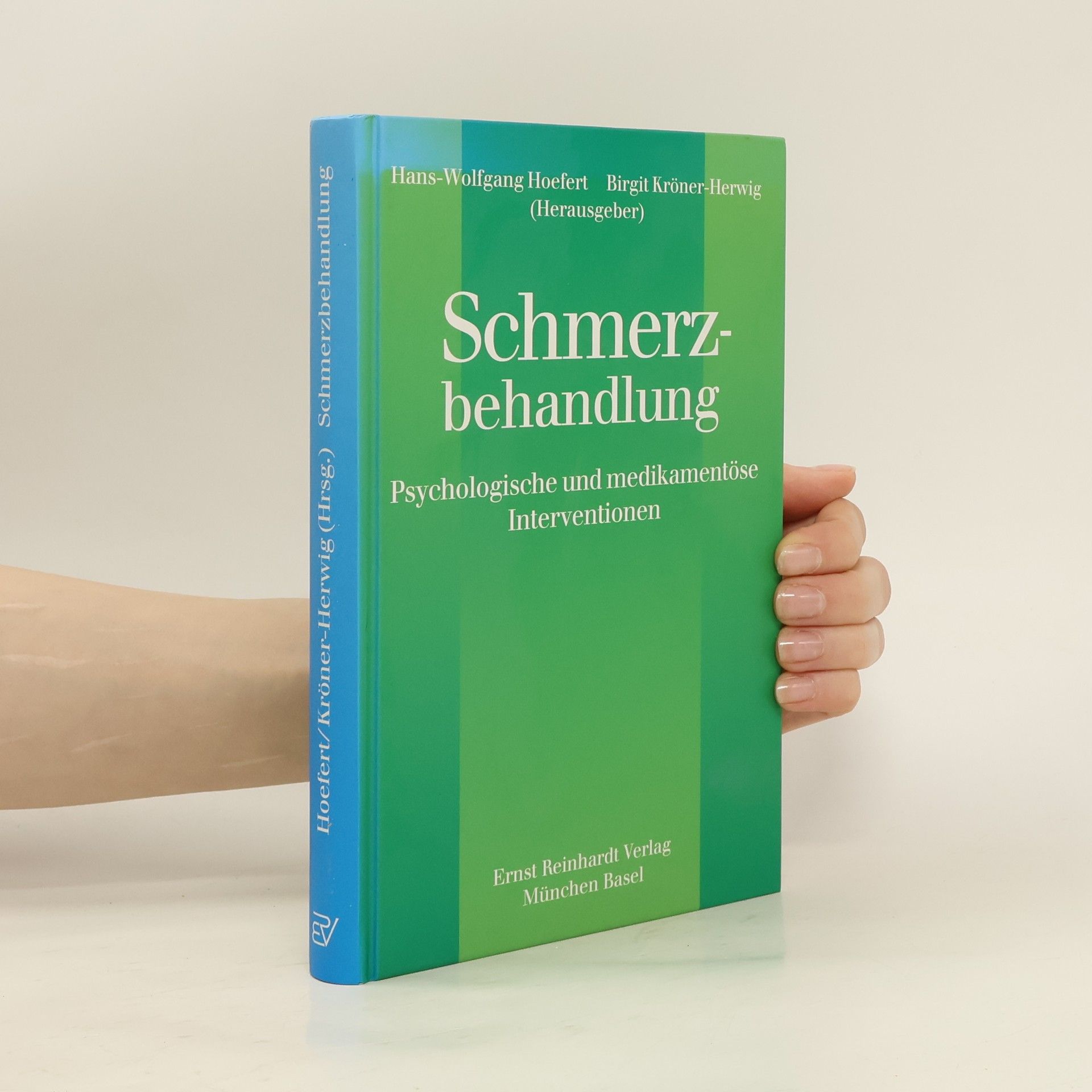
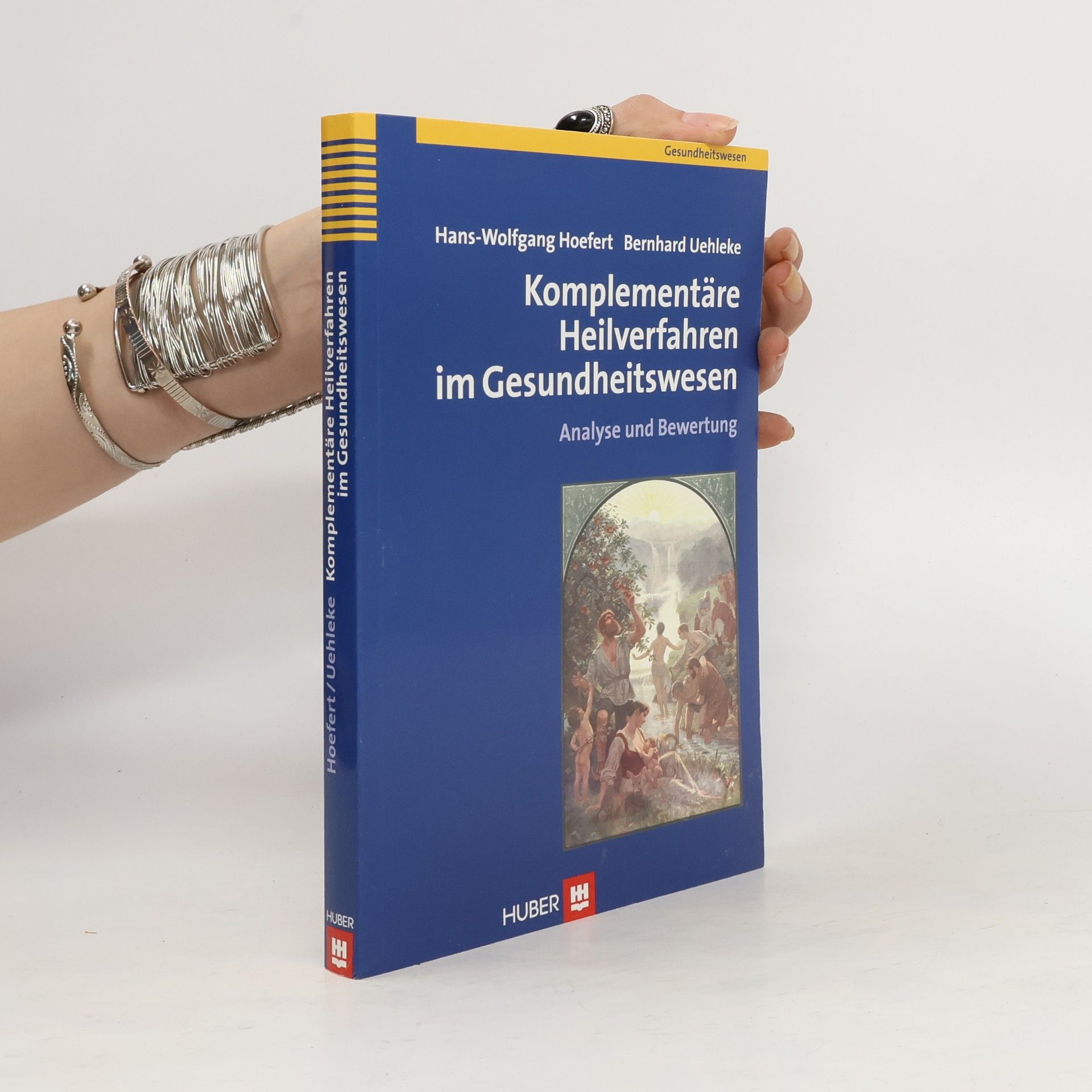
Kopfschmerzen, Migräne und Rückenschmerzen sind nicht nur körperliche Symptome, die durch Medikation behandelt werden können. Neben somato-medizinischen Ansätzen sind psychosomatische und psychologische Methoden mittlerweile essenziell in der Schmerztherapie. Prof. Dr. Birgit Kröner-Herwig, Prof. Dr. Hans-Wolfgang Hoefert und ein Team erfahrener Fachautoren beleuchten Schmerz aus medizinischer und psychologischer Sicht. Ziel ist eine kritische Darstellung der Methoden, die den Lesern einen aktuellen Überblick über die Forschung und Orientierung bei verschiedenen Schmerztherapien bietet. Die Inhalte umfassen anthropologische Aspekte, die Phänomenologie des Schmerzerlebens und kulturelle Einflüsse auf Schmerz. Es werden spezifische Schmerzbereiche wie chronischer Rückenschmerz, Spannungskopfschmerzen und Migräne behandelt. Zudem wird der Konsum von Schmerzmitteln in Deutschland analysiert, einschließlich der Anwendung von Opioiden und Psychopharmaka in der Schmerztherapie. Psychologische Interventionen, wie Verhaltenstherapie für chronische Schmerzpatienten und innovative Behandlungsansätze, werden ebenfalls thematisiert. Prof. Dr. Hans-Wolfgang Hoefert ist Experte für Sozial- und Organisationspsychologie im Gesundheitswesen, während Prof. Dr. Birgit Kröner-Herwig in Klinischer Psychologie tätig ist und in mehreren Fachgesellschaften aktiv ist.
Angst, Panik, Depression
- 220 Seiten
- 8 Lesestunden