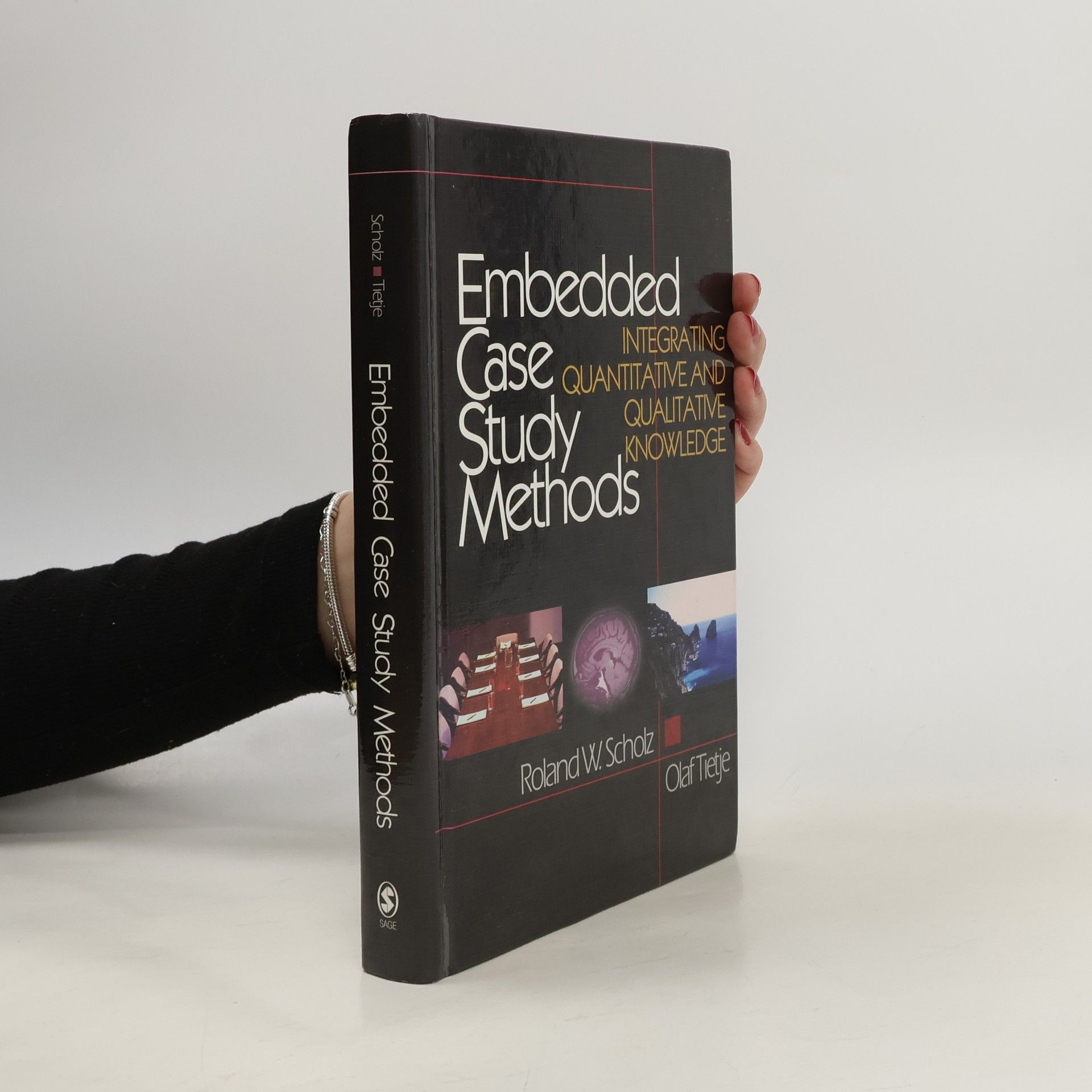Embedded Case Study Methods
Integrating Quantitative and Qualitative Knowledge
- 412 Seiten
- 15 Lesestunden
Focusing on the integration of quantitative and qualitative research methods, this book outlines strategies for synthesizing diverse perspectives within case studies. Drawing on examples from neuropsychology, education, law, business, and environmental sciences, the authors demonstrate how embedded case designs can enhance knowledge integration. They provide insights into the philosophy of science, practical analysis models, and recap essential concepts through "lessons to be learned," making it a valuable resource for researchers seeking to employ mixed methods effectively.