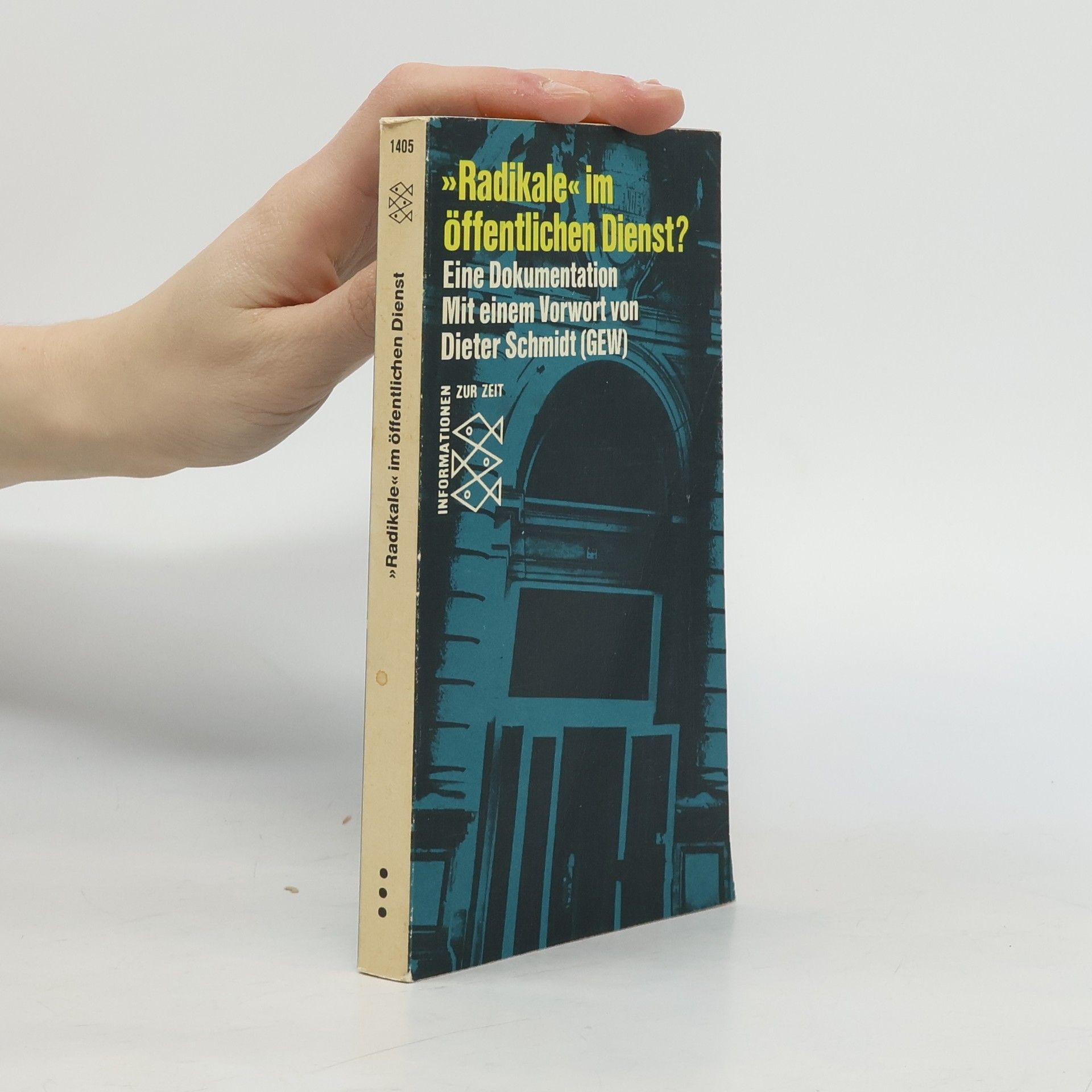Deutsches und europäisches Gesellschaftsrecht
- 382 Seiten
- 14 Lesestunden
Die Globalisierung der Wirtschaft hat gravierenden Auswirkungen auf das Gesellschaftsrecht. Daher begnügt sich diese Einführung nicht mit der Erläuterung der deutschen Normen, sondern legt auch großen Wert auf das ausländische europäische und internationale Gesellschaftsrecht. Sie behandelt zudem Fragen der Mitbestimmung und des Rechts von Konzernen und vergleichbaren Unternehmensverbindungen. Das Lehrbuch bietet anhand von Fällen eine anschauliche Einführung in das nationale und internationale Gesellschaftsrecht. Für Studierende und Dozenten der Volks- und Betriebswirtschaftslehre an Universitäten und Fachhochschulen