Die Coronakrise wirkt als Seismograph der gegenwärtigen Gesellschaft. Die Widersprüche und Pathologien werden unmittelbar sichtbar und insbesondere die gesellschaftsprägende Kraft der Digitalisierung führt deutlich vor Augen, dass Gestaltung das Gebot der Stunde ist. Durch die Pandemie werden Verunsicherungen gesteigert, ökonomisch-soziale Verwerfungen verschärft und individuelle Enttäuschungen produziert. Der neue Blickwinkel kann aber auch positive Funktionen haben und den Diskurs zu sozialen Innovationen beleben. Hierzu gehört die Revitalisierung staatlicher Interventionen, die ebenfalls bei Transformationsprojekten wie der Energiewende oder den demografischen Herausforderungen gefordert ist. Die Pandemie kann so als Beschleuniger von Prozessen gesehen werden, die sich bereits im Wandel befinden. Hierzu zählt auch der Wertigkeitsverlust marktlicher Regulierungen. Die Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft wie auch wirtschaftliche Wertschöpfungen hängen von einer funktionierenden staatlichen Infrastruktur und öffentlicher Daseinsvorsorge ab. Die Relevanz eines schützenden Staates und zivilgesellschaftlicher Organisationsformen, wie sie sich etwa in den solidarischen Hilfen manifestierten, sind als Narrative anerkannt. Deshalb dürften Neujustierungen der zentralen Steuerungsressourcen Zivilgesellschaft, Staat und Markt Auftrieb erfahren.
Rolf G. Heinze Bücher


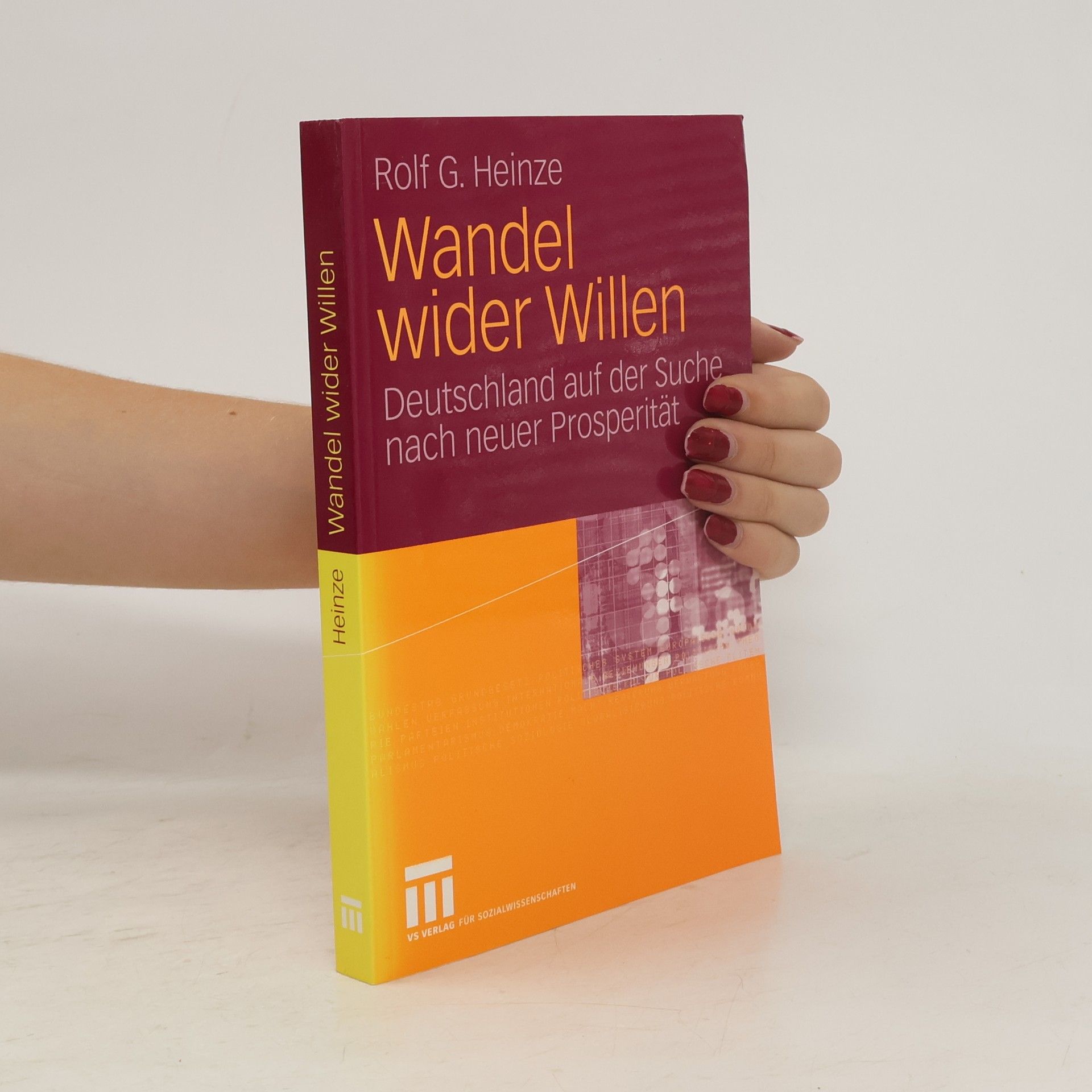


Die vorliegende Publikation erweitert konstitutiv das Diskursfeld zum Thema Grundeinkommen, lotet die Möglichkeiten einer Einführung sowie Chancen und Risiken ab. Obwohl alle visionären Vorschläge zum Bedingungslosen Grundeinkommen (BGE) zumindest in demokratisch verfassten Wohlfahrtsstaaten bislang politisch nicht umgesetzt wurden, wurde die Frage nach der Umsetzung bzw. den Gelingensbedingungen und der Identifizierung möglicher Blockaden nur am Rande behandelt. Auch jüngste Veröffentlichungen zu einem BGE weisen diese politisch-institutionelle „Blindheit“ auf und thematisieren zu wenig die Gründe für das bisherige Scheitern. Ohne eine Überführungsstrategie wird die Idee in Deutschland aber aufgrund einer solchen Implementierungsnaivität scheitern. Im Buch wird deshalb der Diskussionsstand zum Grundeinkommen insofern weiterentwickelt, dass eine Einbindung in wohlfahrtsstaatliche Entwicklungsverläufe und aktuelle Herausforderungen für die „Sicherung der sozialen Sicherung“ vorgenommen wird. Zudem wird anknüpfend an den „stillen“ Wandel zum sozialinvestiven Staat eine sozialwissenschaftliche Einordnung bislang visionär erscheinender garantistischer Elemente eines Grundeinkommensmodells vorgenommen.
Der Wirtschafts- und Sozialstandort Deutschland zeichnet sich durch eine ausgeprägte Koexistenz von faktischer Stagnation auf dem Arbeitsmarkt, sozialen Marginalisierungsprozessen und erfolgreichen betrieblichen Umstrukturierungen aus. In diesem Buch werden der Stagnationsprozess und die Zersplitterungen in den verschiedenen Dimensionen aus wirtschafts- und arbeitssoziologischer Sicht analysiert und historisch eingeordnet. Es widmet sich explizit auch den institutionellen Pfeilern des traditionellen „Modell Deutschland“, die langsam ins Wanken geraten, sowie den Gestaltungschancen der Politik, die auch durch die Große Koalition nicht den erhofften Umschwung erbracht hat, sondern eher erschöpft wirkt. Neben der „Verflüssigung“ und Flexibilisierung des deutschen Prosperitätsmodells in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht werden aber auch Ansatzpunkte für eine neue Prosperität gesucht.
Basic income - from vision to creeping transformation of the welfare state
- 292 Seiten
- 11 Lesestunden
The present publication constitutively expands the field of discourse on the topic of basic income and explores the possibilities of its introduction as well as the opportunities and risks. Although all visionary proposals for an unconditional basic income (BGE) have so far not been implemented politically, at least in democratically constituted welfare states, the question of implementation or the conditions for success and the identification of possible blockades have only been dealt with marginally. Recent publications on a BGE also show this political-institutional „blindness“ and do not address enough the reasons for the failure so far. Without a transfer strategy, however, the idea will fail in Germany due to such implementation naivety. In this book, therefore, the state of the debate on basic income is developed further to the extent that it is integrated into welfare-state development processes and current challenges for the „safeguarding of social security“. In addition, a social-scientific classification of hitherto visionary guarantee elements of a basic income model is undertaken, linking up with the „silent“ change to a socially investing state.
Kritische Texte: Chancengleichheit für Behinderte
Sozialwissenschaftliche Analysen für die Praxis
- 272 Seiten
- 10 Lesestunden