Heinz Bonfadelli Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
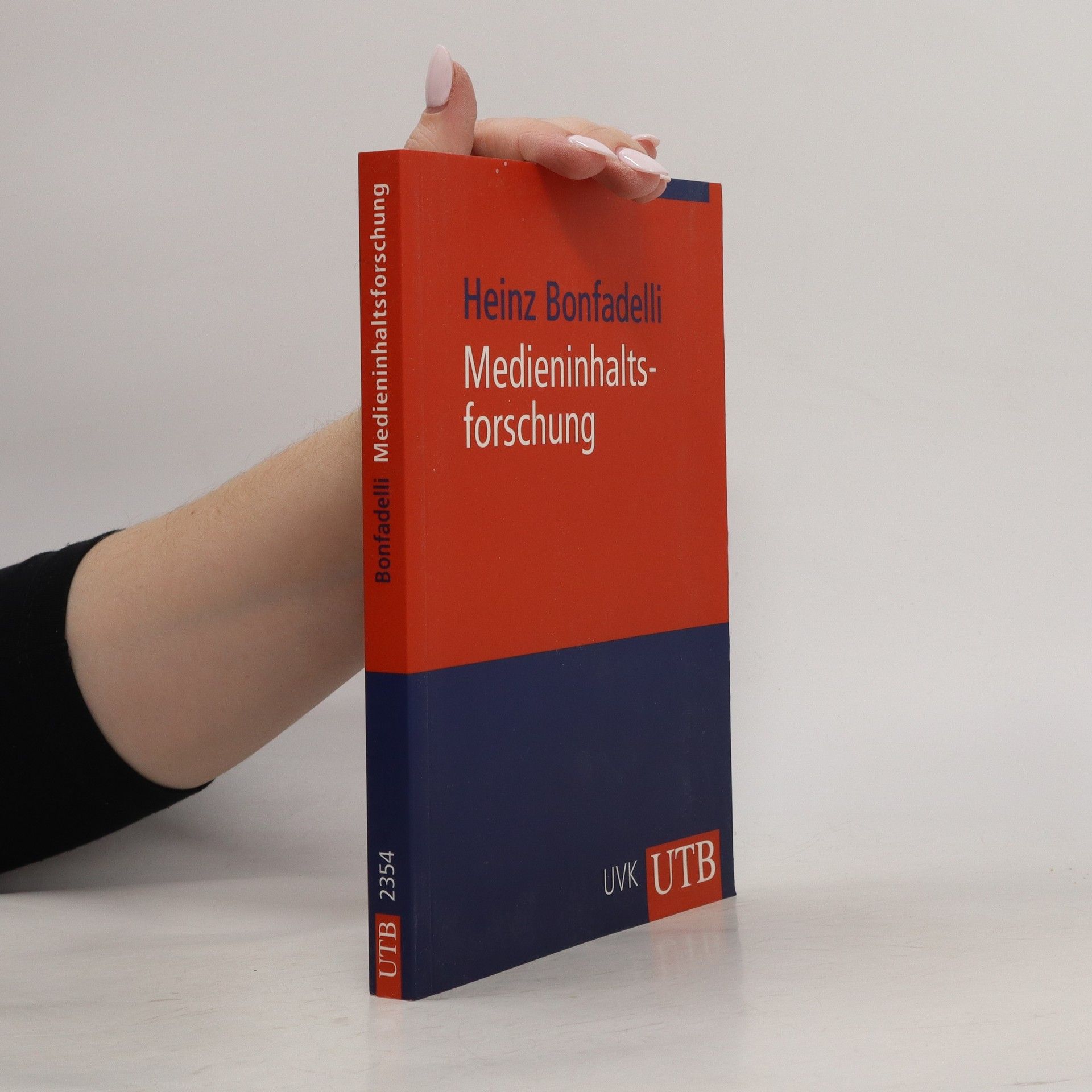


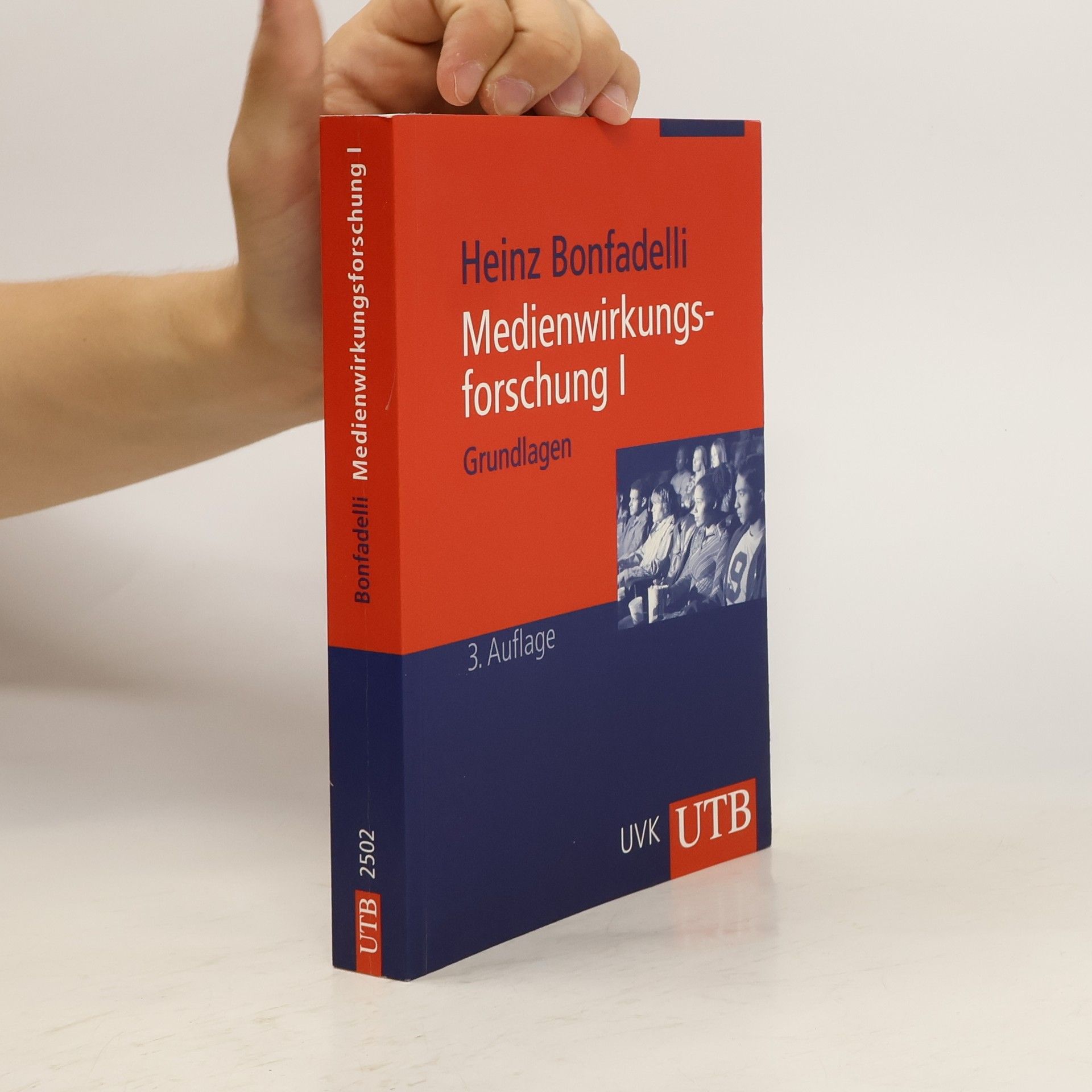
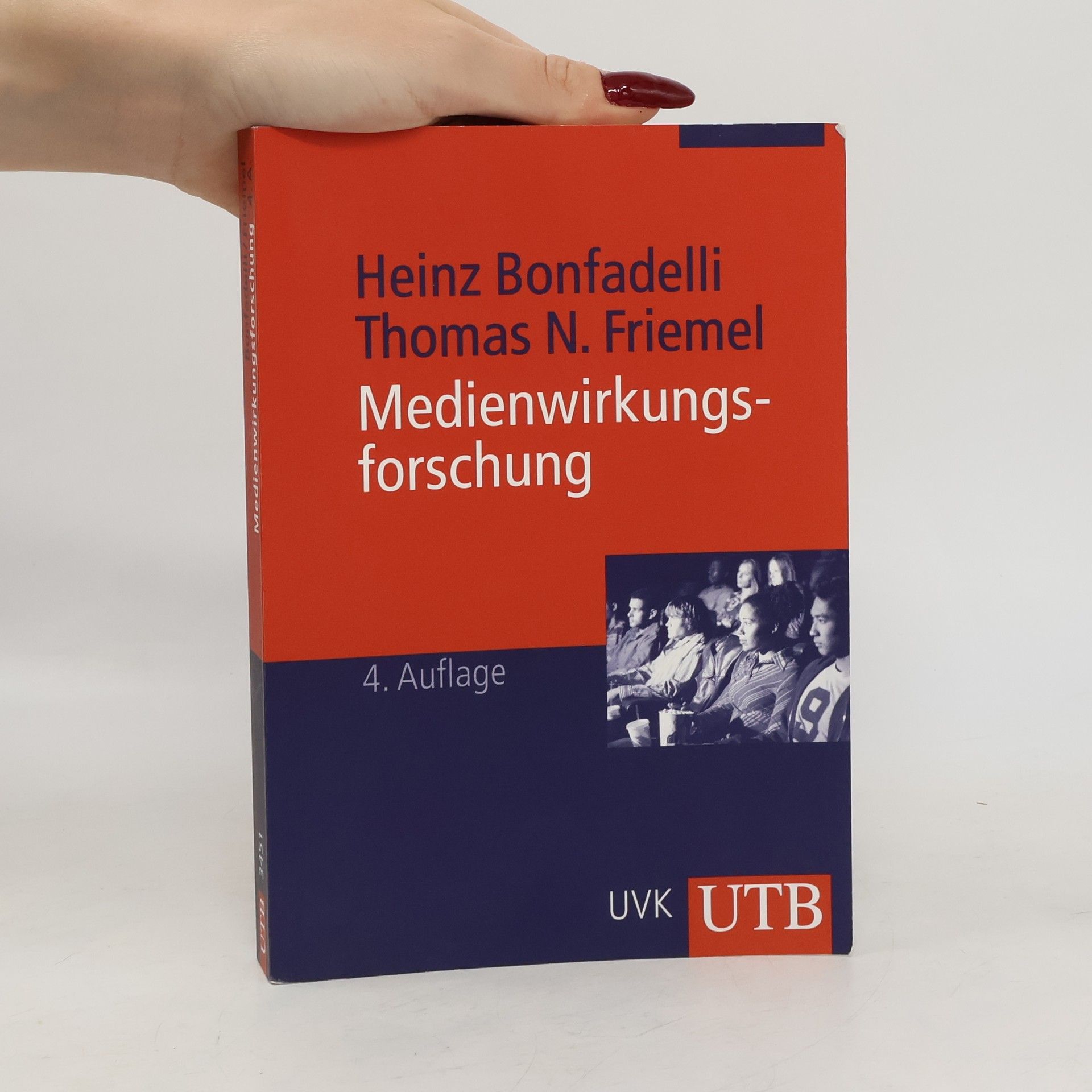
Medienwirkungsforschung
- 268 Seiten
- 10 Lesestunden
Dieses Lehrbuch behandelt grundlegende Konzepte, theoretische Ansätze und empirische Befunde der Medienwirkungsforschung. Die gleichzeitige Berücksichtigung der psychologisch und soziologisch orientierten Forschung erlaubt es, nicht nur die Nutzungsmuster und Wirkungen auf der Ebene einzelner Individuen zu verstehen (z. B. Informationssuche, Gewohnheiten, Sucht), sondern auch die Auswirkungen auf soziale Gruppen (z. B. Meinungsführer, Gewalt) sowie die Gesellschaft als Ganzes (z. B. Informationskampagnen, Wissenskluft, Agenda-Setting, Framing). Die grundlegend überarbeitete Neuauflage wird durch zusätzliche Materialien im Internet (Dieses Lehrbuch behandelt grundlegende Konzepte, theoretische Ansätze und empirische Befunde der Medienwirkungsforschung. Die gleichzeitige Berücksichtigung der psychologisch und soziologisch orientierten Forschung erlaubt es, nicht nur die Nutzungsmuster und Wirkungen auf der Ebene einzelner Individuen zu verstehen (z. B. Informationssuche, Gewohnheiten, Sucht), sondern auch die Auswirkungen auf soziale Gruppen (z. B. Meinungsführer, Gewalt) sowie die Gesellschaft als Ganzes (z. B. Informationskampagnen, Wissenskluft, Agenda-Setting, Framing). Die grundlegend überarbeitete Neuauflage wird durch zusätzliche Materialien auf utb-mehr-wissen. de ergänzt.
Einführung in die Publizistikwissenschaft
- 619 Seiten
- 22 Lesestunden
Das Einführungswerk für die gesamte Publizistikwissenschaft, systematisch aufgebaut und vielfältig erschlossen. Für Vorlesung und Selbststudium geeignet. Das Lehrbuch befasst sich einführend mit Grundlagen, Theorien und Modellen der Publizistikwissenschaft, analysiert Strukturen, Ökonomie und Regulierung des Mediensystems sowie die Gruppe der Kommunikatoren. Einen weiteren Schwerpunkt bilden Mediennutzung und -wirklichkeit sowie Medienleistungen und Medienrealität. Schließlich werden die grundlegenden Methoden der quantitativen und qualitativen Medienforschung einführund behandelt. In 18 Autorenbeiträgen werden die jüngsten Entwicklungen der Publizistikwissenschaft kritisch reflektiert sowie aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Medien, Öffentlichkeit und Informationsgesellschaft nachgezeichnet.
Medienwirkungsforschung 1
- 299 Seiten
- 11 Lesestunden
Dieses Lehrbuch stellt grundlegende Konzepte, theoretische Ansätze und Befunde der klassischen Wirkungsforschung vor, die entweder sozial-psychologisch oder soziologisch orientiert sind. Darüber hinaus geht der Autor auch ausführlich auf neuere Perspektiven wie Uses-and-Gratifications, Informationsverarbeitung, Agenda-Setting, Wissenskluftperspektive oder Kultivierungstheorie ein. Die komplexen Zusammenhänge werden durch eine Vielzahl von Grafiken veranschaulicht. Zahlreiche Literaturhinweise, ein Glossar sowie ein Register erleichtern den Zugang zum Thema. Der Band Medienwirkungsforschung II ist als eine anwendungsorientierte Vertiefung und Ergänzung geplant.
Medieninhaltsforschung
- 220 Seiten
- 8 Lesestunden
Medieninhalte stehen wegen ihrer massenhaften Verbreitung und ihrer potenziellen Wirkung im Zentrum der medienwissenschaftlichen Forschung. Dieses Lehrbuch erörtert die theoretischen Grundlagen und die wichtigsten Fragestellungen der Medieninhaltsforschung. Es führt nicht nur in die Methode der quantitativen Inhaltsanalyse ein, sondern stellt auch die wichtigsten qualitativen Instrumente der Textanalyse wie Semiotik, Diskurs- und Frame-Analyse oder das Monitoring von Medienqualität vor. Der Autor illustriert seine Ausführungen anhand zahlreicher Anwendungen aus der empirischen Forschung. Heinz Bonfadelli ist Professor am Institut für Publizistikwissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich.