Das Buch untersucht das antike griechische Symposion und hinterfragt die gängige Sichtweise, dass es eine ausschließlich aristokratische Männerinstitution war. Anhand von Text- und Bildzeugnissen des 8.-6. Jahrhunderts v.Chr., insbesondere dem "Nestorbecher", wird gezeigt, dass das Trinkgelage vielfältige soziale und kulturelle Mischungen umfasste.
Renate Schlesier Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)




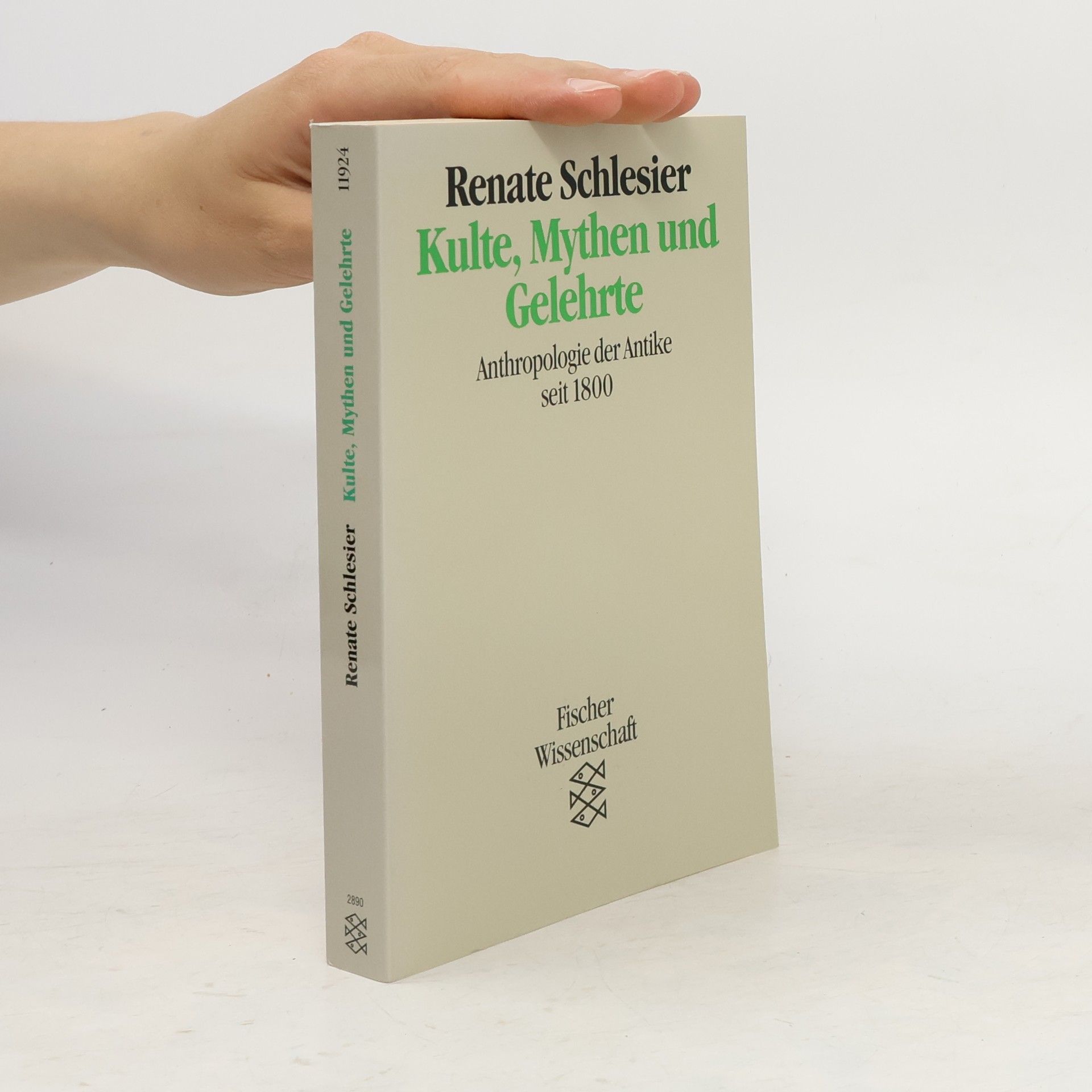
Dionysos
- 224 Seiten
- 8 Lesestunden
Dem antiken Gott widmet die Berliner Antikensammlung gemeinsam mit dem Sonderforschungsbereich „Transformationen der Antike“ und dem Institut für Religionswissenschaft der Freien Universität Berlin eine eigene Sonderausstellung im Pergamonmuseum: Die zahlreichen Facetten dieses Gottes werden anhand von hochkarätigen, meist seit Jahrzehnten nicht mehr gezeigten Exponaten aus der Berliner Antikensammlung präsentiert, die vom 6. Jh. v. Chr. bis in das 2. Jh. n. Chr. reichen, eine Leihgabe stammt aus dem Würzburger Martin von Wagner-Museum. Die Dionysos-Rezeption von der Renaissance bis zum Klassizismus veranschaulichen Objekte aus dem Berliner Kunstgewerbemuseum. International renommierte Fachleute beleuchten in übergeordneten Essays diese verschiedenen Aspekte des Gottes und erläutern die in prächtigen neuen Farbaufnahmen vorgestellten Exponate. Zugleich verstehen sich Ausstellung und Begleitband als Ergänzung und Vertiefung der gleichzeitig im Pergamonmuseum stattfindenden Sonderschau „Die Rückkehr der Götter. Berlins verborgener Olymp“. Die dortigen Abteilungen über Dionysos und das Theater stellen diese Ausstellung in einen größeren Zusammenhang.
»Stier, Schlange, Efeu und Wein«: vom kretischen Kern des Mythos ausgehend, verfolgt der Religionswissenschaftler und klassische Philologe Karl Kerényi einen Kult durch seine Hallräume: Athen, Delphi und Theben, die kretisch-minoischen Schichten der ägäischen Kultur, das olympische Pantheon. Dionysos wirkt auf uns widersprüchlich und fremd. Oft wendet er sich dem Menschen und der Natur freundlich zu. Erst über Tragödie, Komödie und Bildkunst wurde er zum gängigen Motiv in der europäischen Kultur. Das besondere Verdienst Kerényis ist dabei, die lebensnahen Mythen der Griechen zurückzuführen auf ihre ursprünglichen Kontexte. Karl Kerényi legt Bedeutungen frei in der Figur eines Gottes, der nach dem Humanismus zu musealem Bildungsgut verkam. Aus dem Inhalt: Erster Teil: Das Kretische Vorspiel: Minoische Visionen - Licht und Honig - Der kretische Kern des Dionysosmythos. Zweiter Teil: Der griechische Mythos und Kultus: Die Mythen der Ankunft - Dionysos Trieterikós - Gott der Zweijahresperiode - Der Dionysos der Athener und seiner Verehrer in griechischen Mysterien »Konsistent und kohärent musste ein Mythos sein, wenn man fast ein Jahrtausend lang noch danach lebte und starb. Man lebte und starb nach dem Mythos, weil der Gott selbst lebte und starb: Man erfuhr Dionysos in sich - Männer und Frauen auf die intimste Weise des eigenen Geschlechts.«
Kulte, Mythen und Gelehrte
- 360 Seiten
- 13 Lesestunden