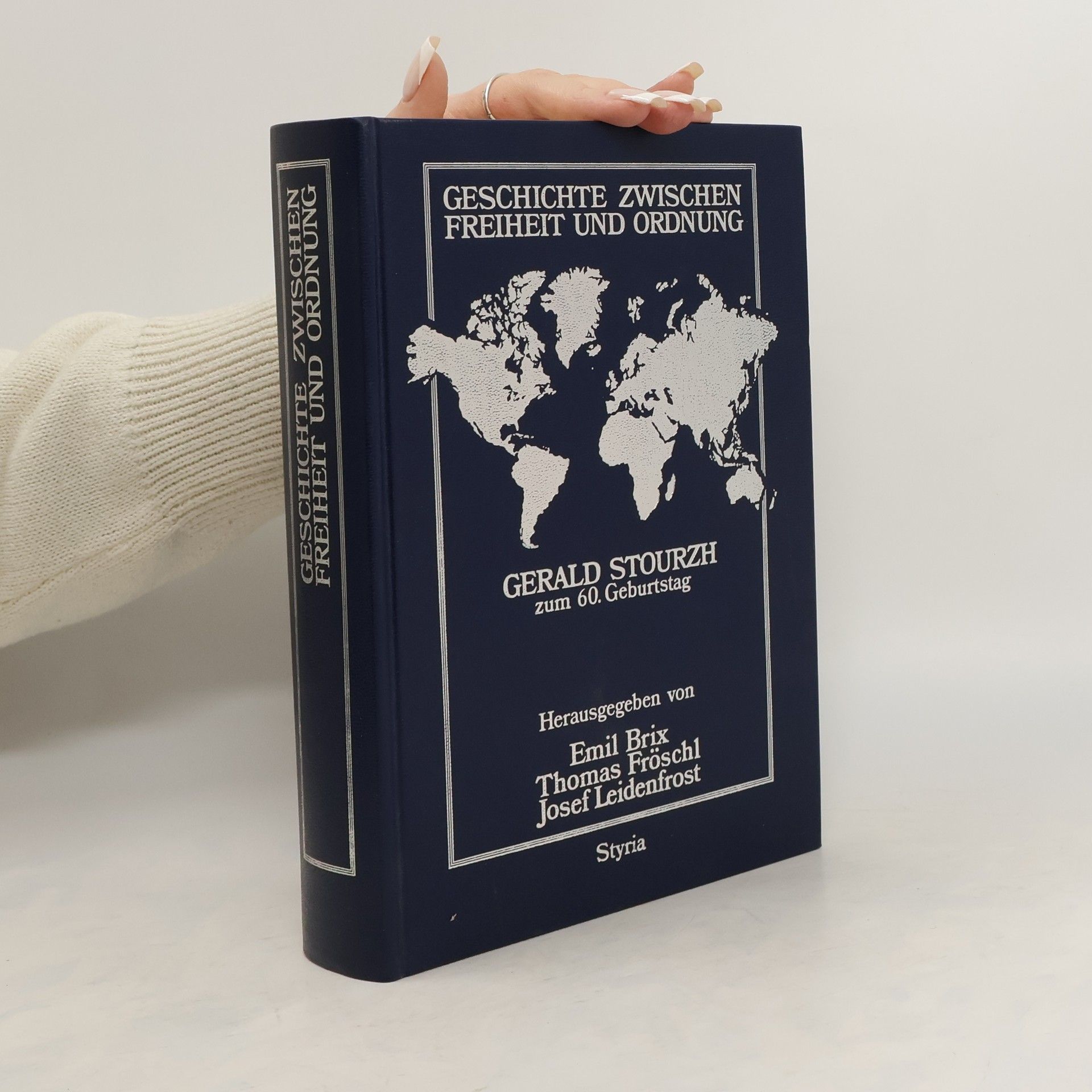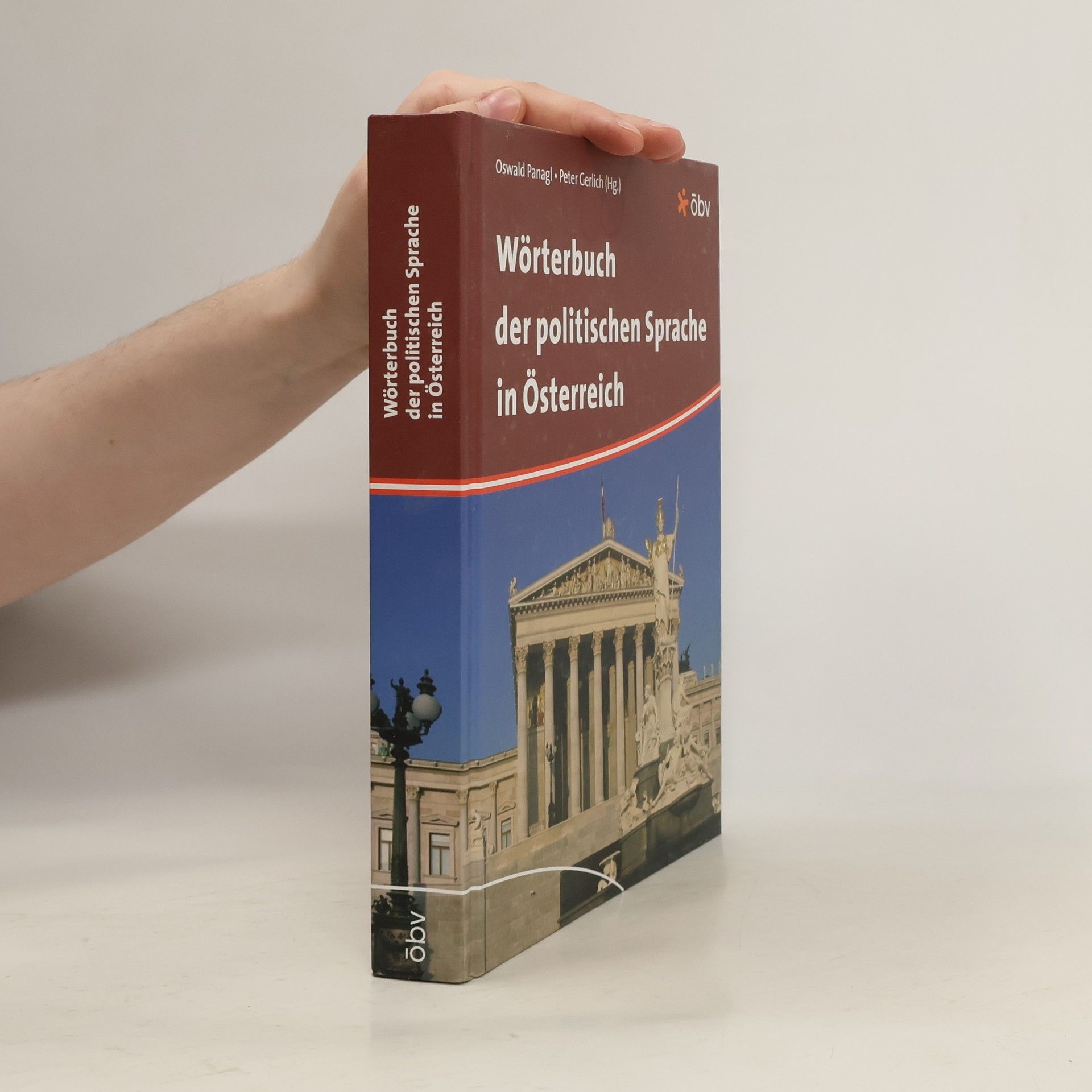Emil Brix Bücher
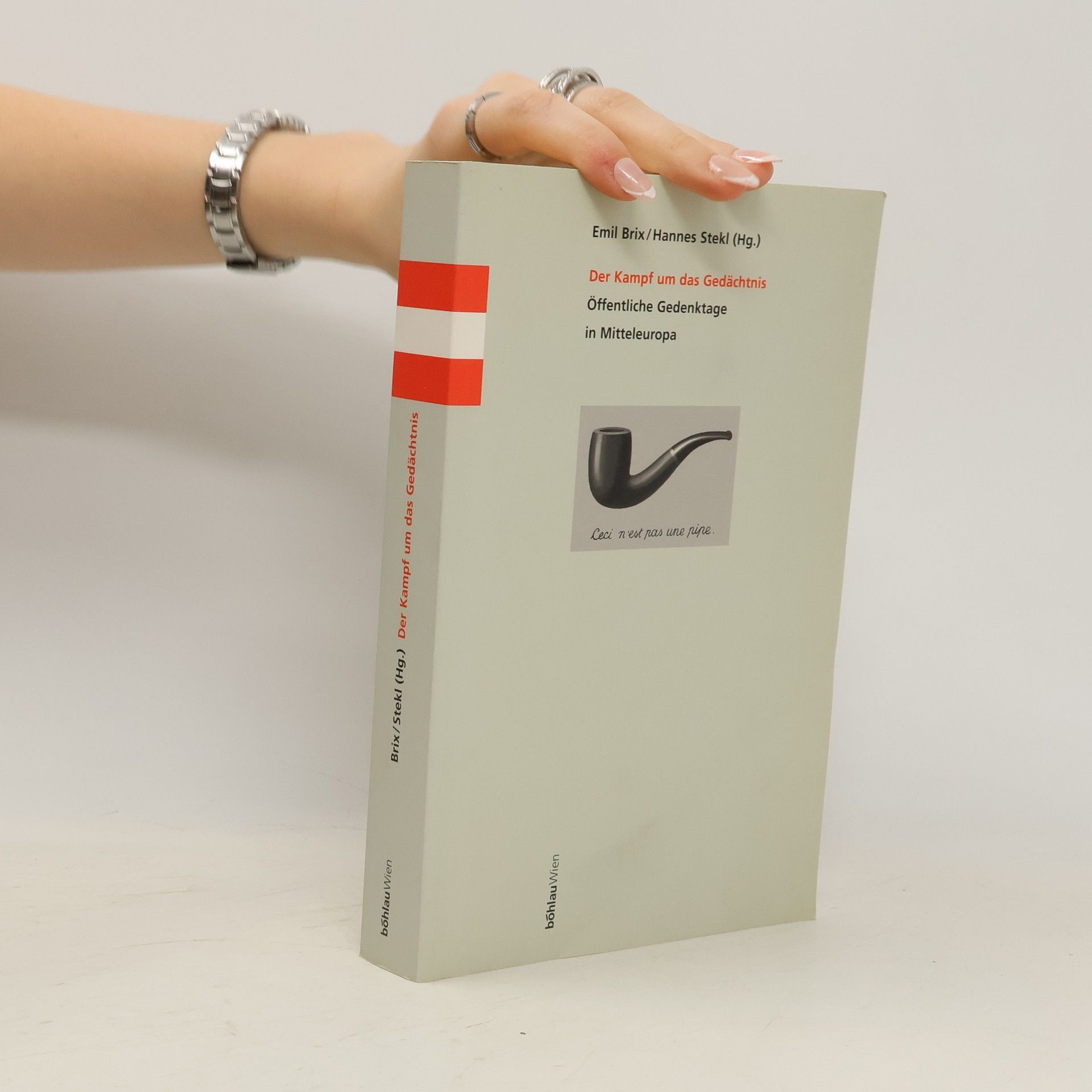


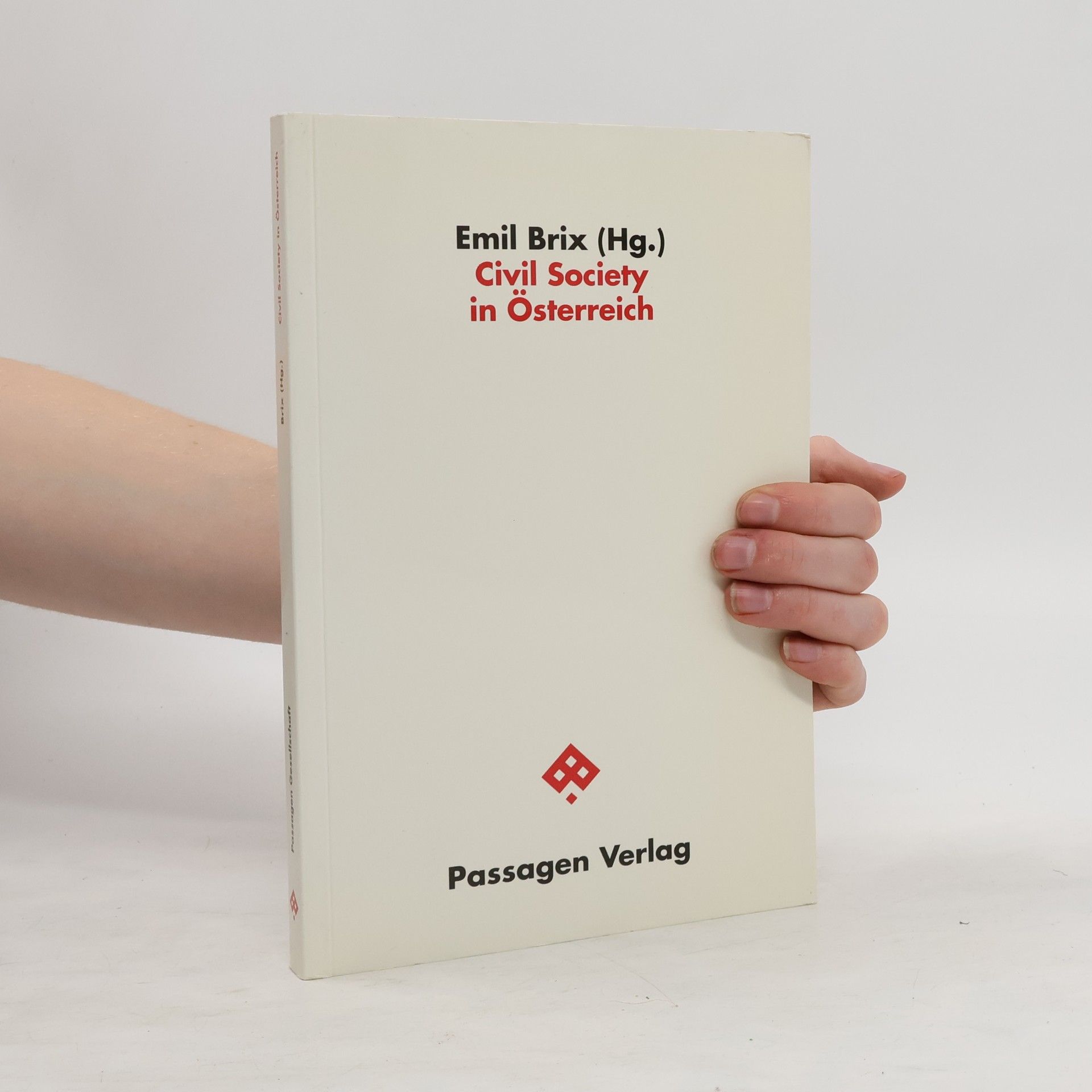
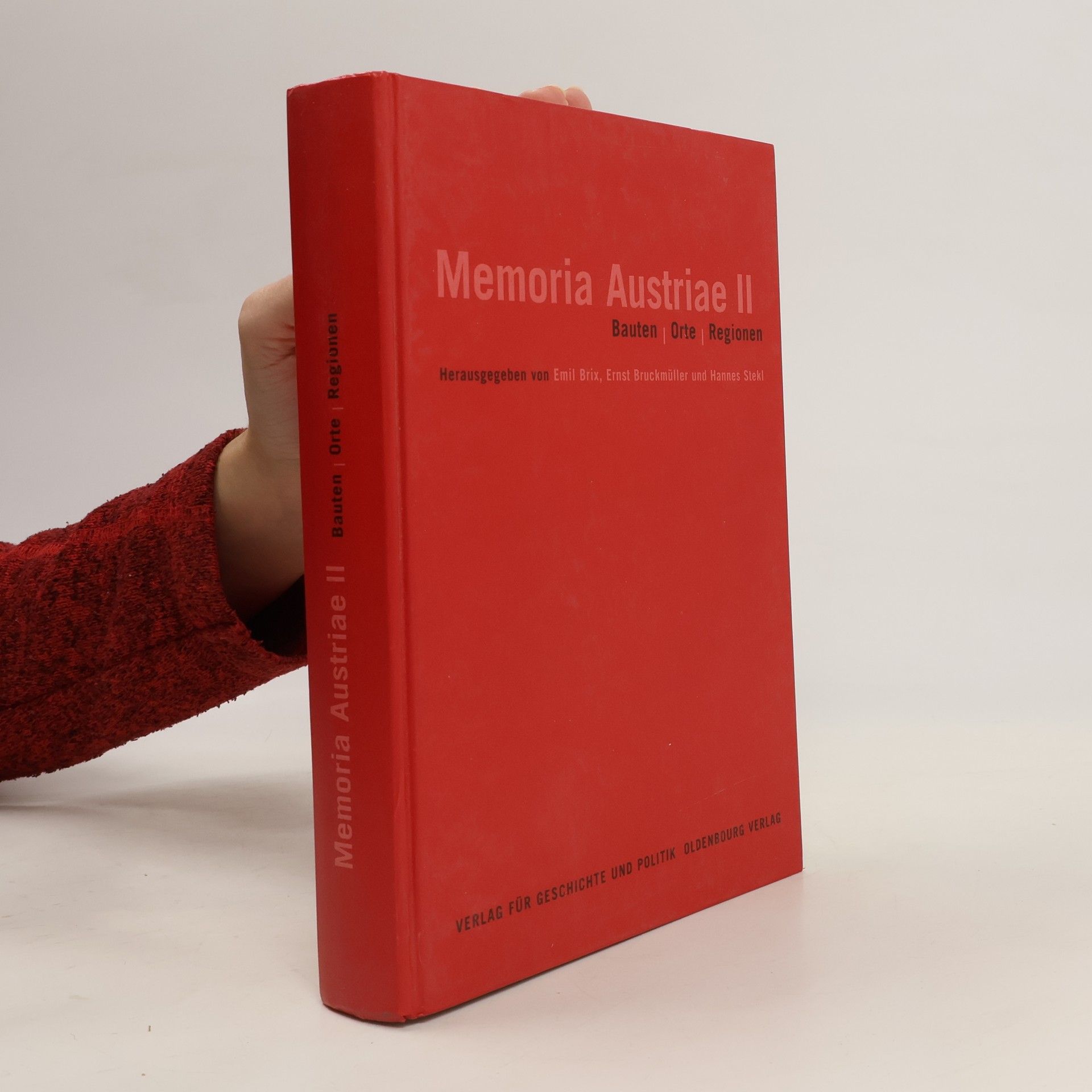

Bauten - Orte - Regionen
- 476 Seiten
- 17 Lesestunden
Europas Veränderungen der letzten zehn Jahre stellen uns vor die Frage nach dem Zustand und der Zukunft der Zivilgesellschaften. Dem Einzelnen scheint immer weniger Raum zur Selbstorganisation zu bleiben. Sowohl die Erfahrungen der westeuropäischen Demokratien als auch die Reformbemühungen Osteuropas verweisen aber auf die Bedeutung einer funktionierenden zivilen Gesellschaft für eine Demokratie. Was aber ist eine Zivilgesellschaft? Und wo steht in dieser Frage Österreich? Anders als in den „alten“ Demokratien Europas sind seine Traditionen einer zivilen Gesellschaft schwächer, und es erlebt nicht den Reformschub mancher seiner östlichen Nachbarn. Das Buch ist der erste Band einer Reihe, die interdisziplinäre Forschungen zur Lage der Civil Society in Österreich präsentiert und ein Forum für einen öffentlichen Diskurs über die Zivilgesellschaft schaffen will.
Heute existieren zwei große Ansichten zu Mitteleuropa. Für die einen ist es die größte europäische Erfolgsgeschichte der letzten Jahrzehnte, weil eine friedliche vollständige Transformation zu Demokratie und Marktwirtschaft und die Eingliederung in die westeuropäischen Wirtschafts- und Sicherheitsstrukturen gelungen sind. Für die anderen ist Mitteleuropa zu einer fragmentierten und teilweise marginalisierten Region geworden, aus der keine Vorschläge für Europas Zukunft kommen, die sich in der Migrationskrise unsolidarisch verhält und in der politische Stabilität nur um den Preis starker nationalpopulistischer Politik zu erreichen ist. 1986 veröffentlichten Erhard Busek und Emil Brix das Buch „Projekt Mitteleuropa“, das eine verbindende, grenzüberschreitende Utopie in einer Welt der feindseligen Extremismen präsentierte. Für viele Dissidenten in Ostmitteleuropa war diese Idee eine Chiffre der Hoffnung gegen das von Moskau gelenkte System, bis 1989 der Eiserne Vorhang fiel. Es scheint, dass Europa heute ein neues Nachdenken über Mitteleuropa braucht, um zu sich und zur Vernunft zu kommen.
Mit Beiträgen von: Tadeusz Boy-Zelenski, Franz Theodor Csokor, Alfred Döblin, Eva Hoffman, Thomas Keneally, Jan Kott, Karl Lubomirski, Halina Nelken, Peter Nell, Halyna Petrosanjak, Jerzy Pilch, Rafael Scharf, Robert Schindel, Hartmann Schedel, Jozef Tischner, Ernst Trost, Simon Wiesdenthal, Michael Zeller, Adam Zielinski, u. v. a.
Wörterbuch der politischen Sprache in Österreich
- 520 Seiten
- 19 Lesestunden
Used book in good condition, due to its age it could contain normal signs of use
Geschenke für das Kaiserhaus
Huldigungen an Kaiser Franz Joseph und Kaiserin Elisabeth
- 255 Seiten
- 9 Lesestunden
The authors explore the evolving political landscape of the region between Germany, Russia, and the Mediterranean, reflecting on changes that have occurred since their influential work "Projekt Mitteleuropa." They analyze contemporary dynamics and relationships, offering insights into the geopolitical significance of this area over three decades. Through their examination, Brix and Busek provide a thoughtful perspective on the historical and current challenges faced by these nations.