Robert Weninger Bücher


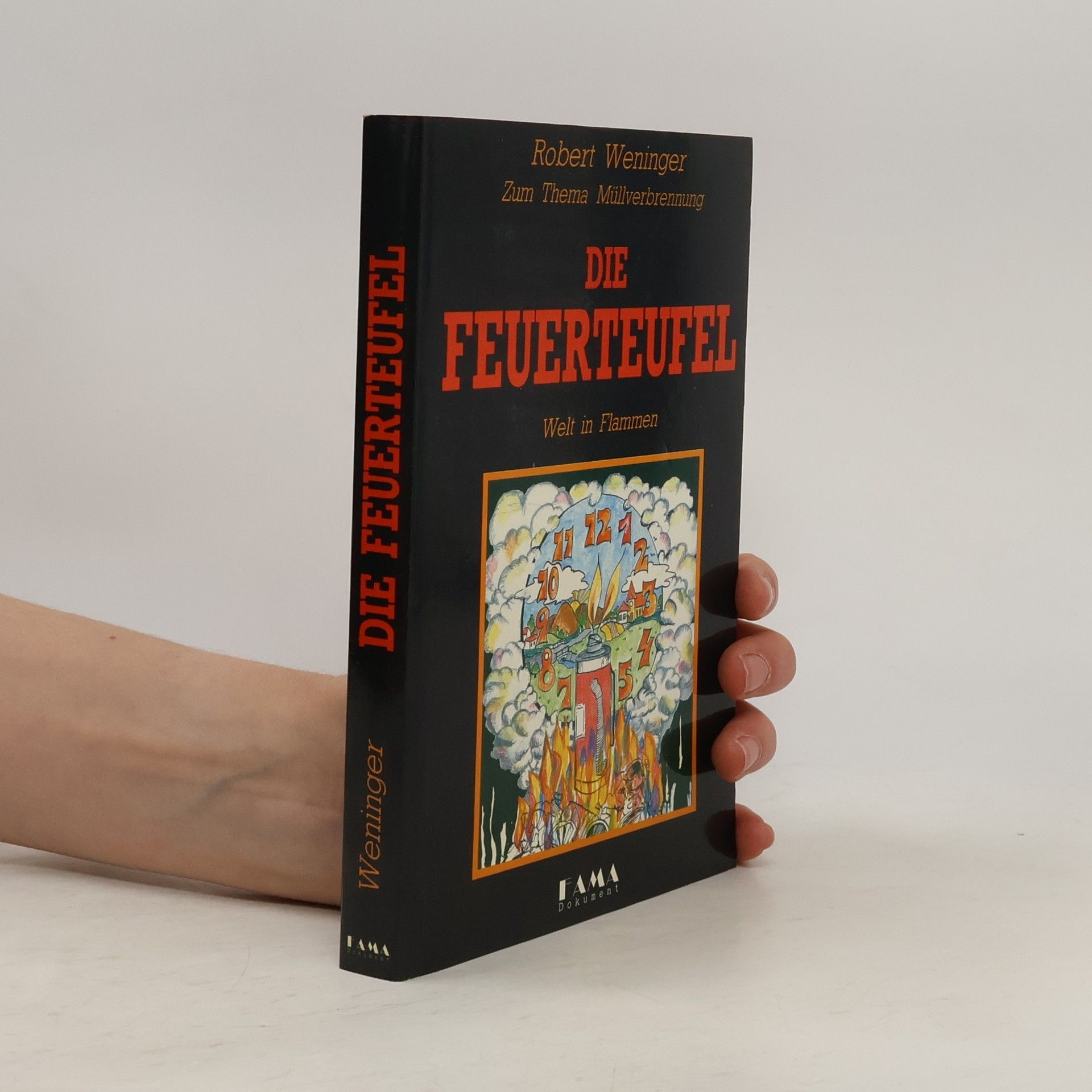
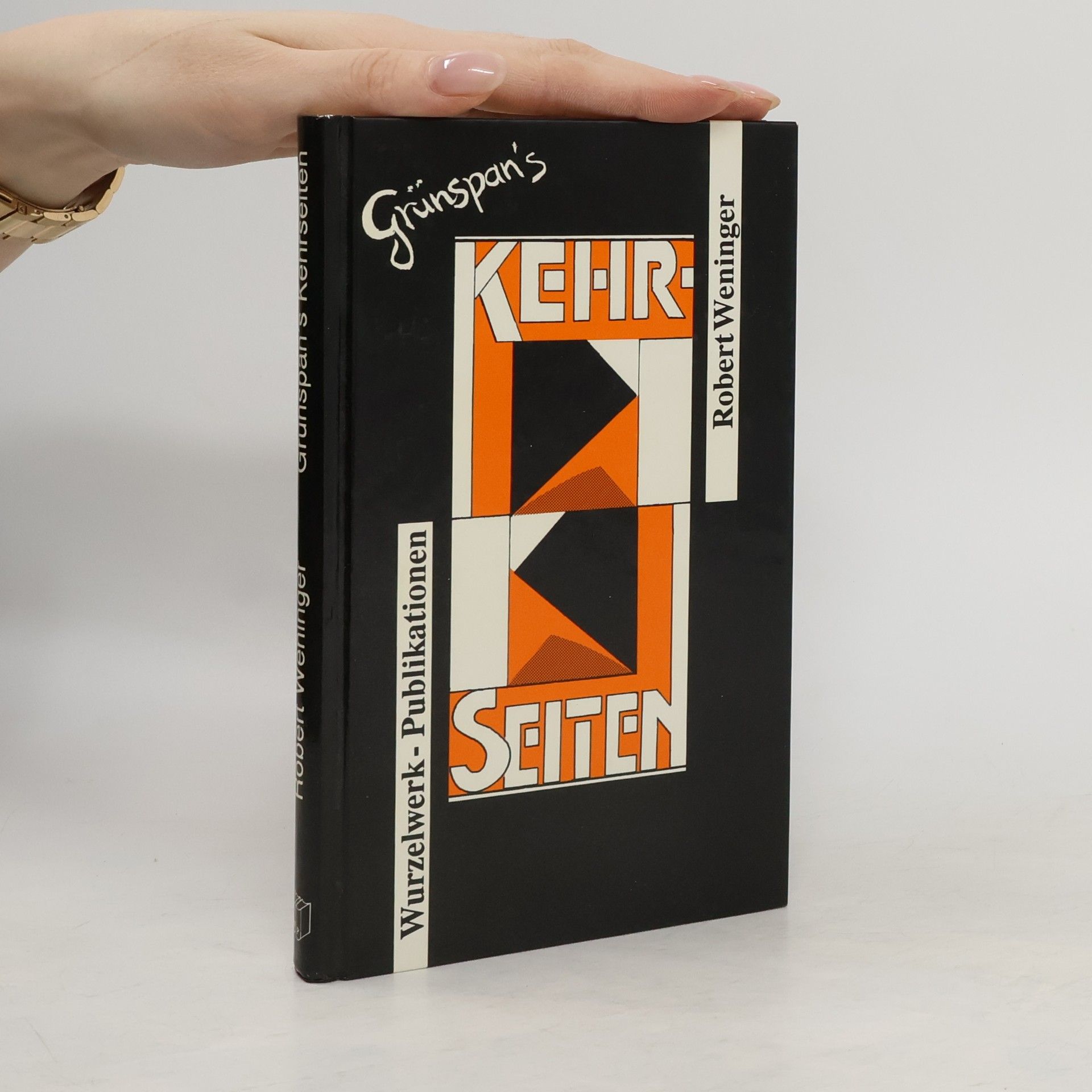
„Schmidt-Leser sind niemals nur Schmidt-Leser“, stellt Robert Weninger in der Einleitung zu seinem Buch fest und in der Tat sind viele Schmidt-Leser besonders interessiert an den Zusammenhängen zwischen den Werken Schmidts und den Büchern von James Joyce, insbesondere „Finnegans Wake“. Weninger kommentiert in diesem Band genauestens eine zentrale Passage aus „Finnegans Wake“, nämlich die Fabel „The Mookse an the Gripes“ aus dem 6. Kapitel des 1. Buches.
Arno Schmidt-Bibliographie
Ein Verzeichnis der wissenschaftlichen Sekundärliteratur nach Titeln und Themen
- 95 Seiten
- 4 Lesestunden