Wielandgut Oßmannstedt
- 133 Seiten
- 5 Lesestunden
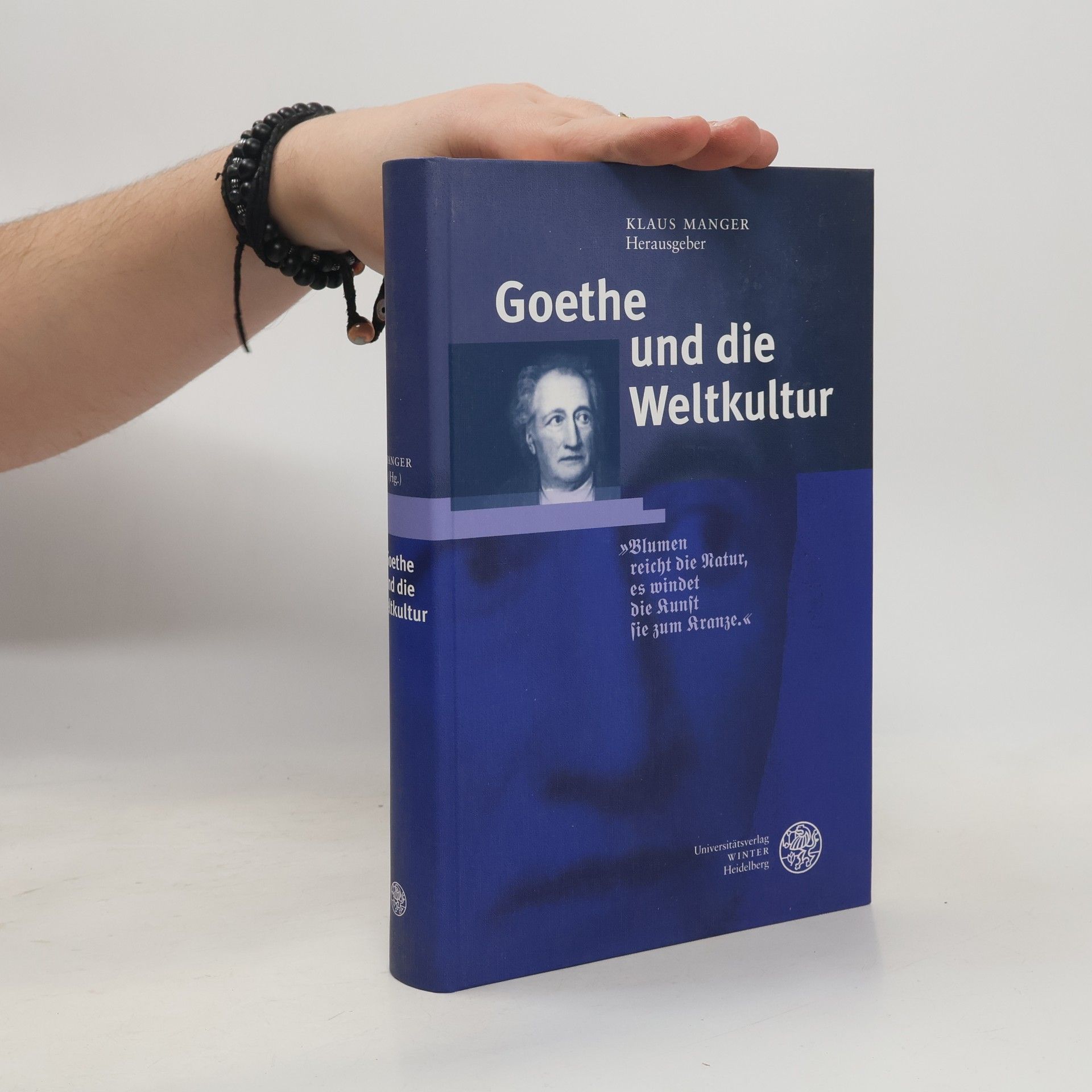
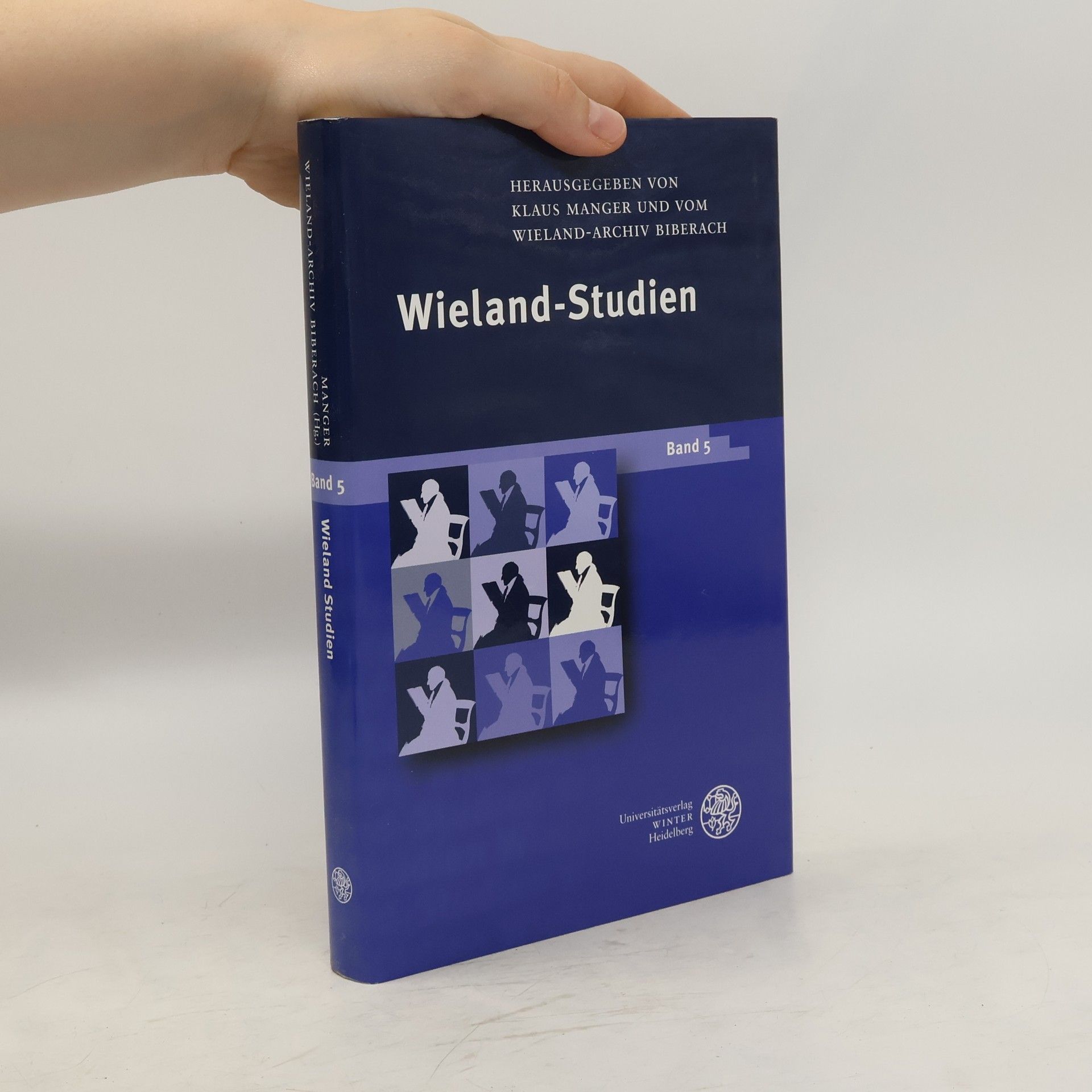

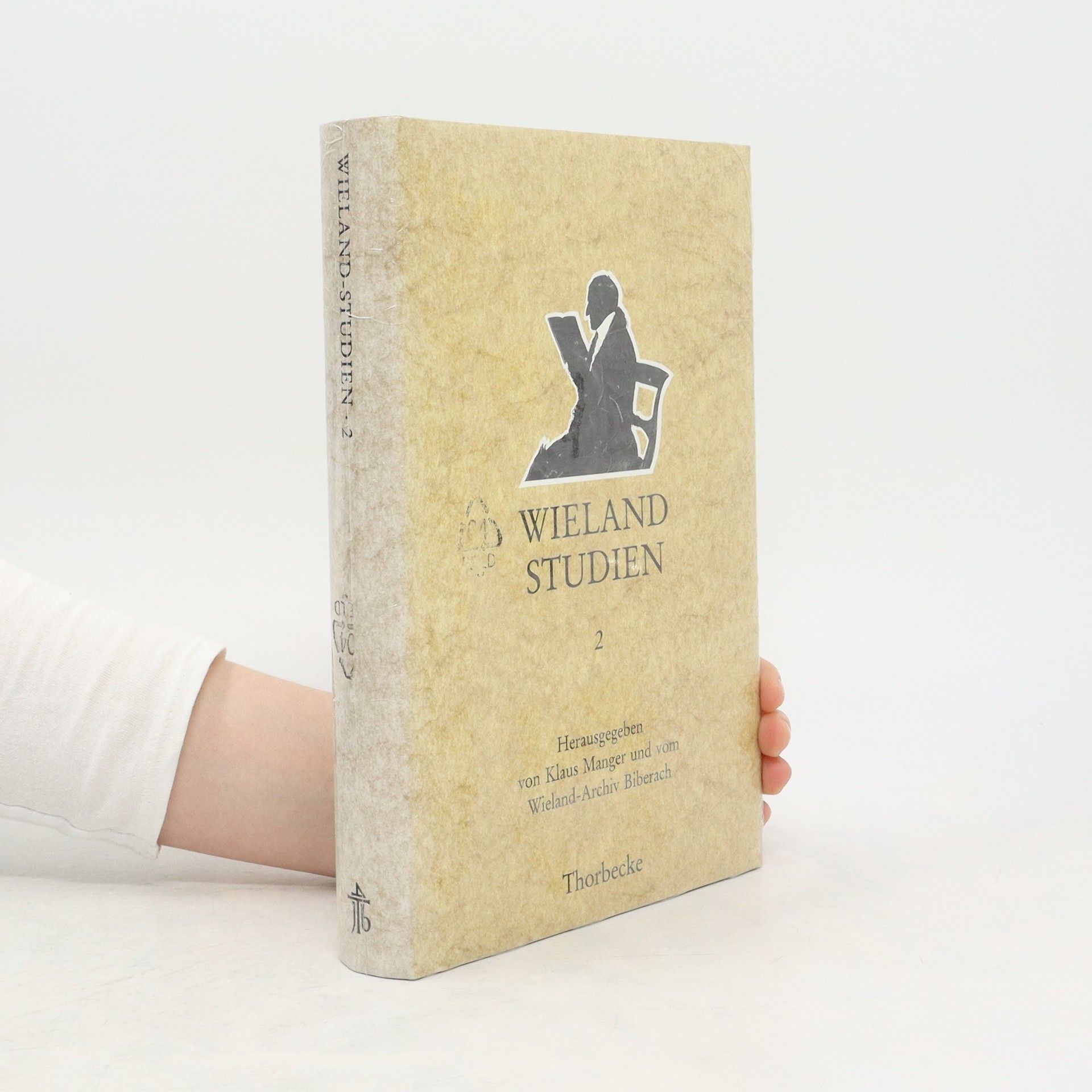
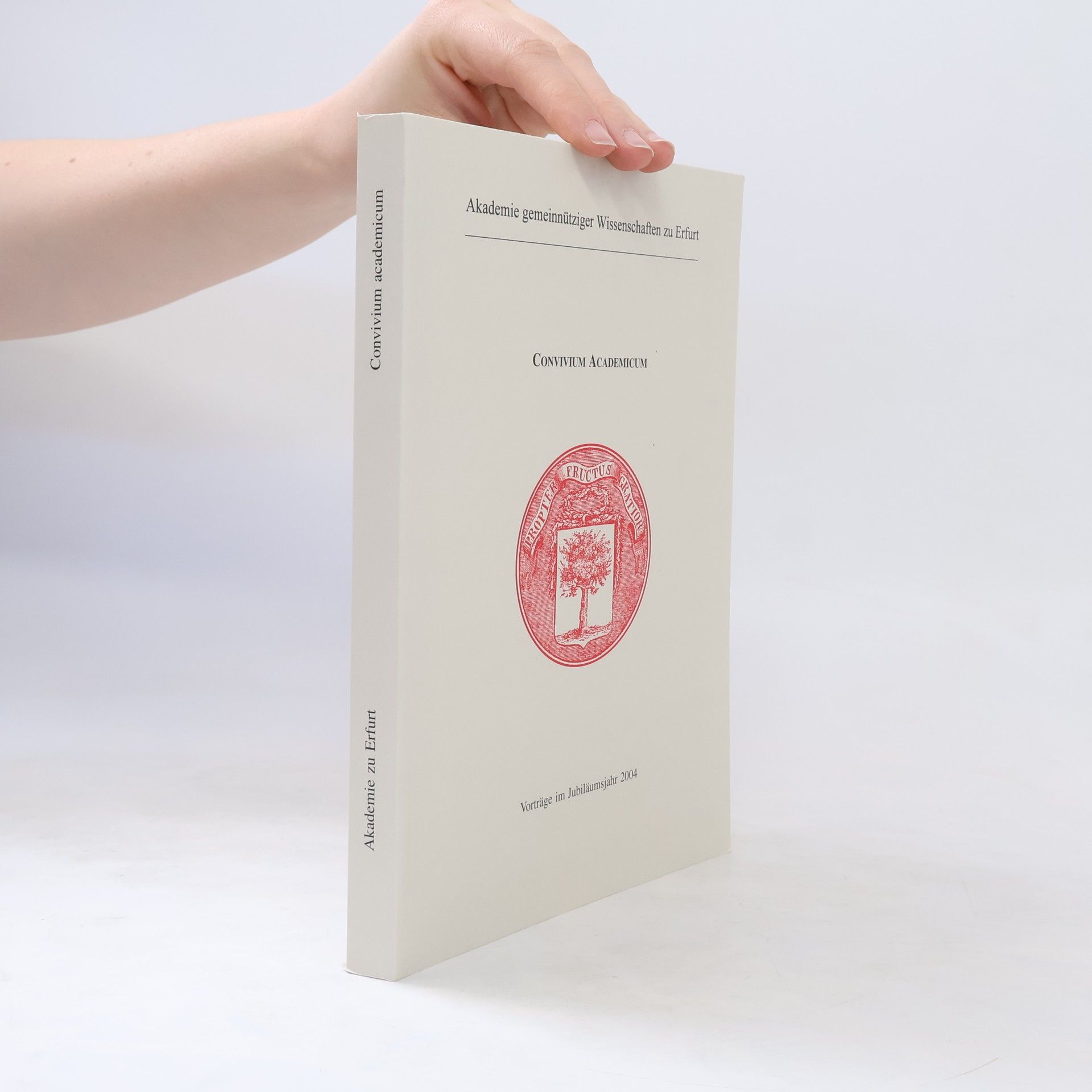
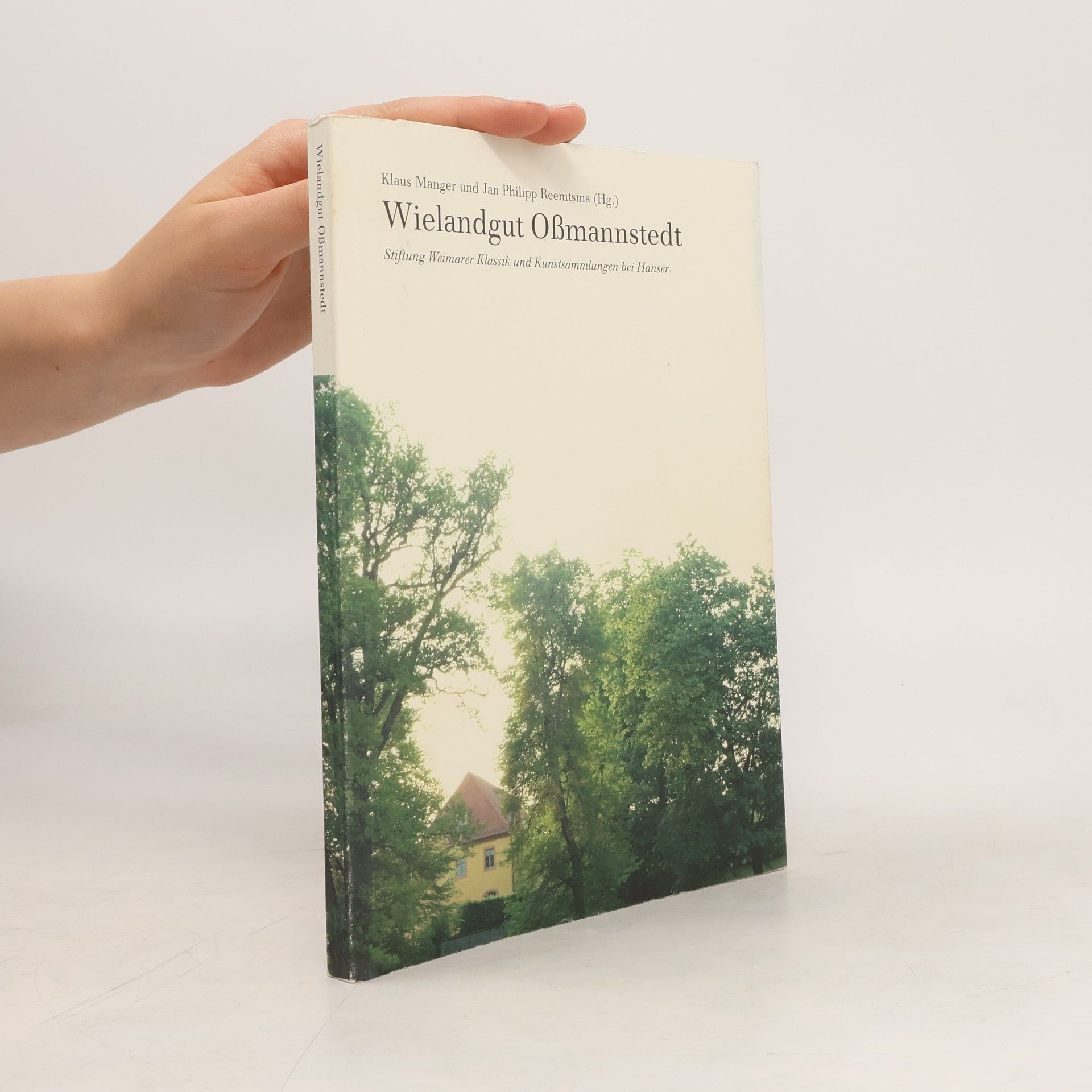
Geschichte des Agathon. Endymions Traum. Musarion, oder die Philosophie der Grazien. Idris. Nadine. Chloe. Vorberichte und Zusätze. April 1766 - Dezember 1769. [100 - 111]
Die Gesamtedition von Christoph Martin Wielands Werk umfasst 36 Bände und bietet einen umfassenden Überblick über seine bedeutenden poetischen Werke sowie wichtige Übersetzungen. Die chronologische Anordnung der Texte ermöglicht einen tiefen Einblick in die Entwicklung seines Schaffens. Ergänzt wird jeder Textband durch einen Kommentarband, der zusätzliche Informationen und Analysen bereitstellt. Als Begründer des Bildungsromans und Wegbereiter der Weimarer Klassik wird Wielands Einfluss auf die Literaturgeschichte deutlich.
Aufsätze • Texte und Dokumente • Diskussion • Berichte • Bibliographie
Im Ereignisraum von Weimar und Jena läßt sich ausgangs des 18. Jahrhunderts eine unvergleichliche Kulturverdichtung beobachten. Darin nimmt Goethes Werk dank seiner Vielseitigkeit eine Sonderstellung ein. Wer heute nach Goethe und der Weltkultur fragt, darf weder den literarischen und hier höchst gattungsdifferenzierten, noch den wissenschaftlichen, noch den politischen Goethe vernachlässigen. Der Band, der das wissenschaftliche Kolloquium des Sonderforschungsbereiches dokumentiert, sammelt die Beiträge unter den Schwerpunkten, die besonders Goethes Experimentalkultur, die von ihm aufgenommenen Kulturtraditionen sowie die politische Kultur berücksichtigen. Welche Denktraditionen, Strömungen, Entwicklungen haben bei ihm Spuren hinterlassen? In welcher Wirkungstiefe sind sie zu beobachten? Ihre Anverwandlung und Veranschaulichung prägten das kulturelle Gedächtnis um 1800. Als eine Art Motto gilt Goethes Monostichon: „Blumen reicht die Natur, es windet die Kunst sie zum Kranze.“