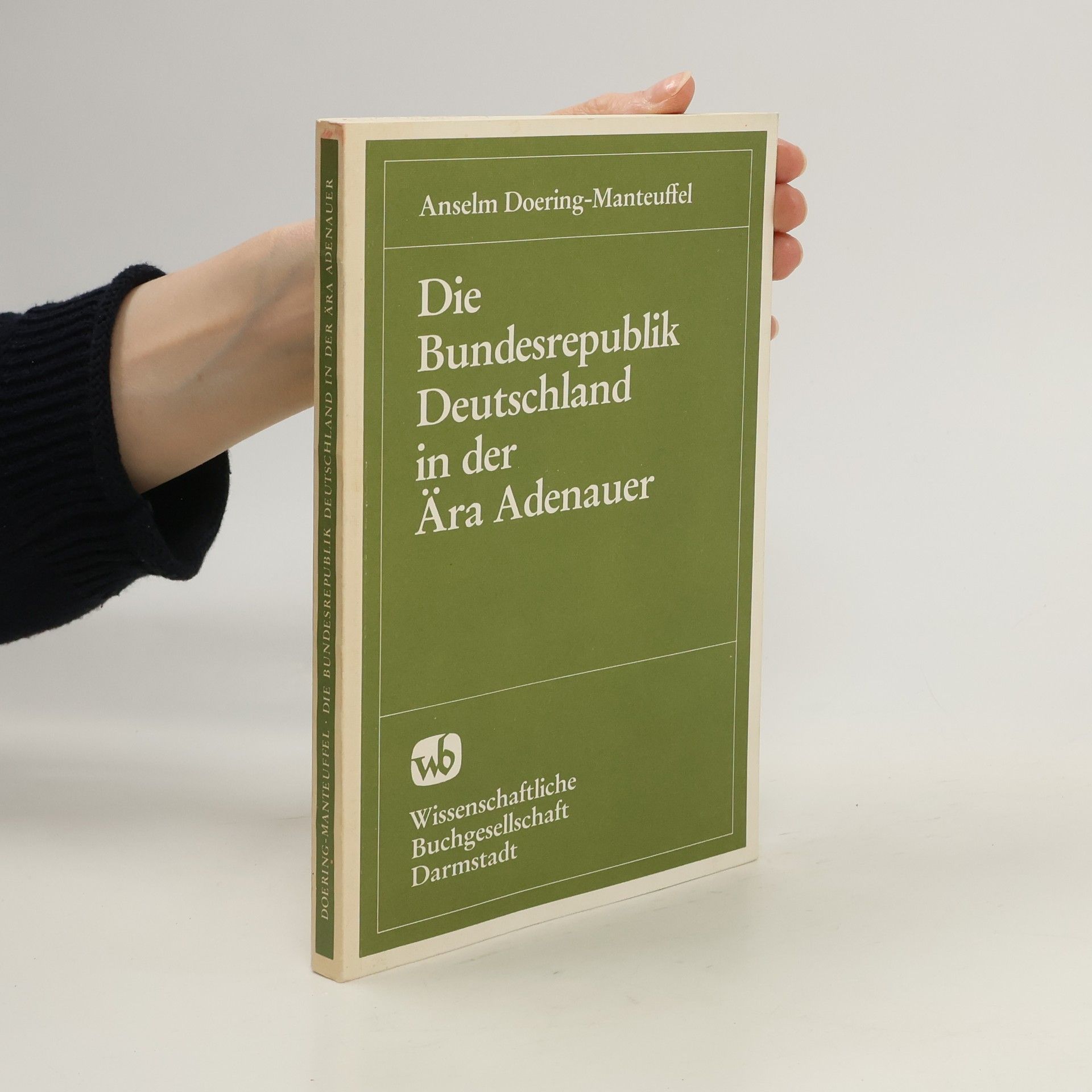Nach dem Boom
Perspektiven auf die Zeitgeschichte seit 1970
English This book looks at developments in the last three decades of the twentieth century in Western Europe in the light of the great boom of the 1950s to 1970s and sees it as a structural transformation of revolutionary dimensions. The characteristics of this new era are discussed, focusing on individual mobility, industrial development and changing concepts of social order. German text. German Die Zeit des Booms waren die funfziger bis siebziger Jahre, die Jahrzehnte einer stabilen Nachkriegsordnung, die mit dem Marshallplan 1947 eingeleitet wurde und im wirtschaftlichen Wandel seit 1973 an ihr Ende kam. Grundlegende Veranderungen gingen von der Wirtschaft aus und hatten ihre Wirkung auf die politischen und sozialen Leitvorstellungen in den westeuropaischen Landern. Das Gesellschaftsmodell der Boom-Epoche wandelte sich mit hoher Dynamik. Dieses komplexe Geschehen stellt einen Strukturbruch in der Entwicklung der Bundesrepublik und Westeuropas seit dem Zweiten Weltkrieg dar. Das Nebeneinander von Kontinuitat und Bruch in Strukturen und Mentalitaten ist das Kennzeichen einer neuen Epoche in der europaischen Geschichte.