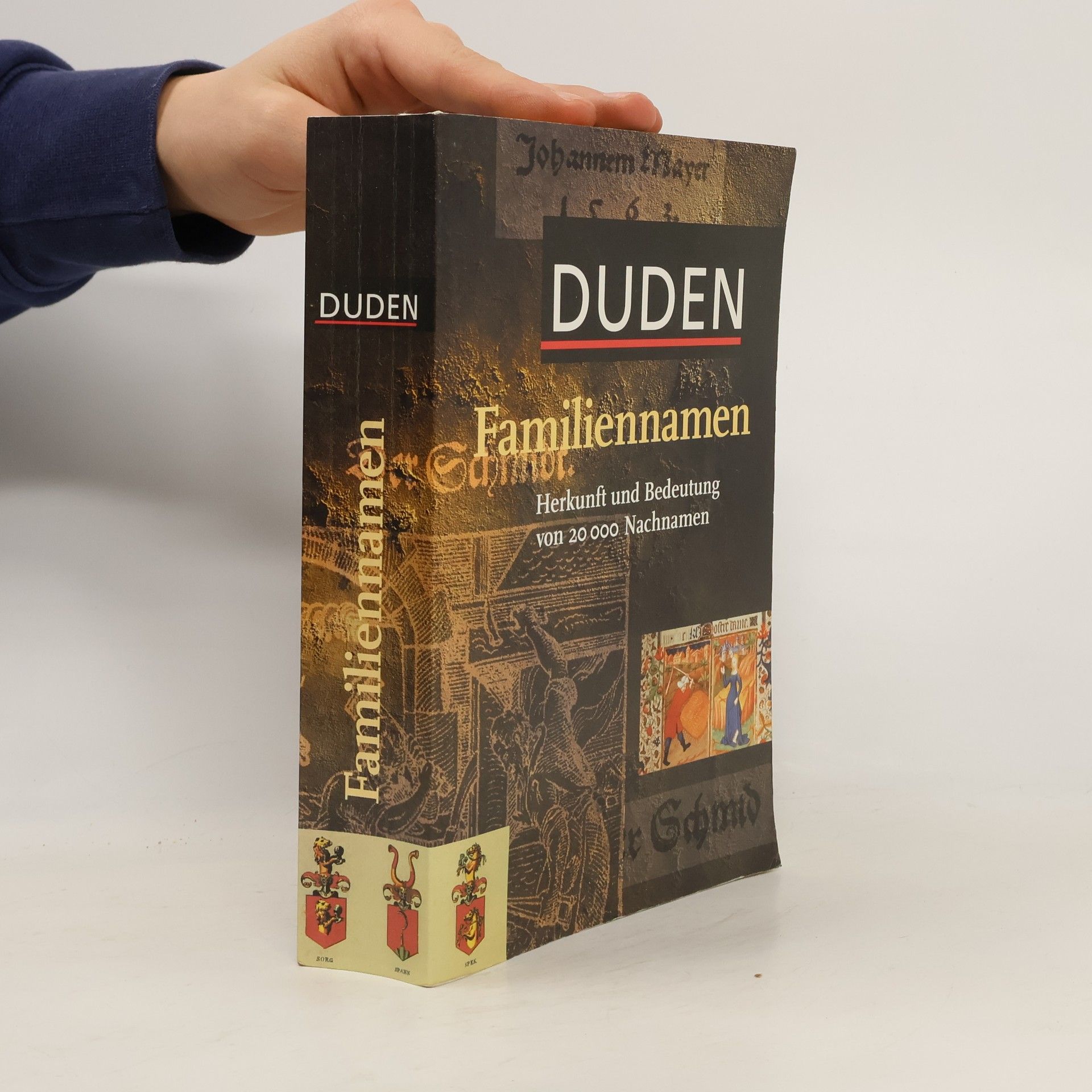Johannes-Leopold Mayer Bücher

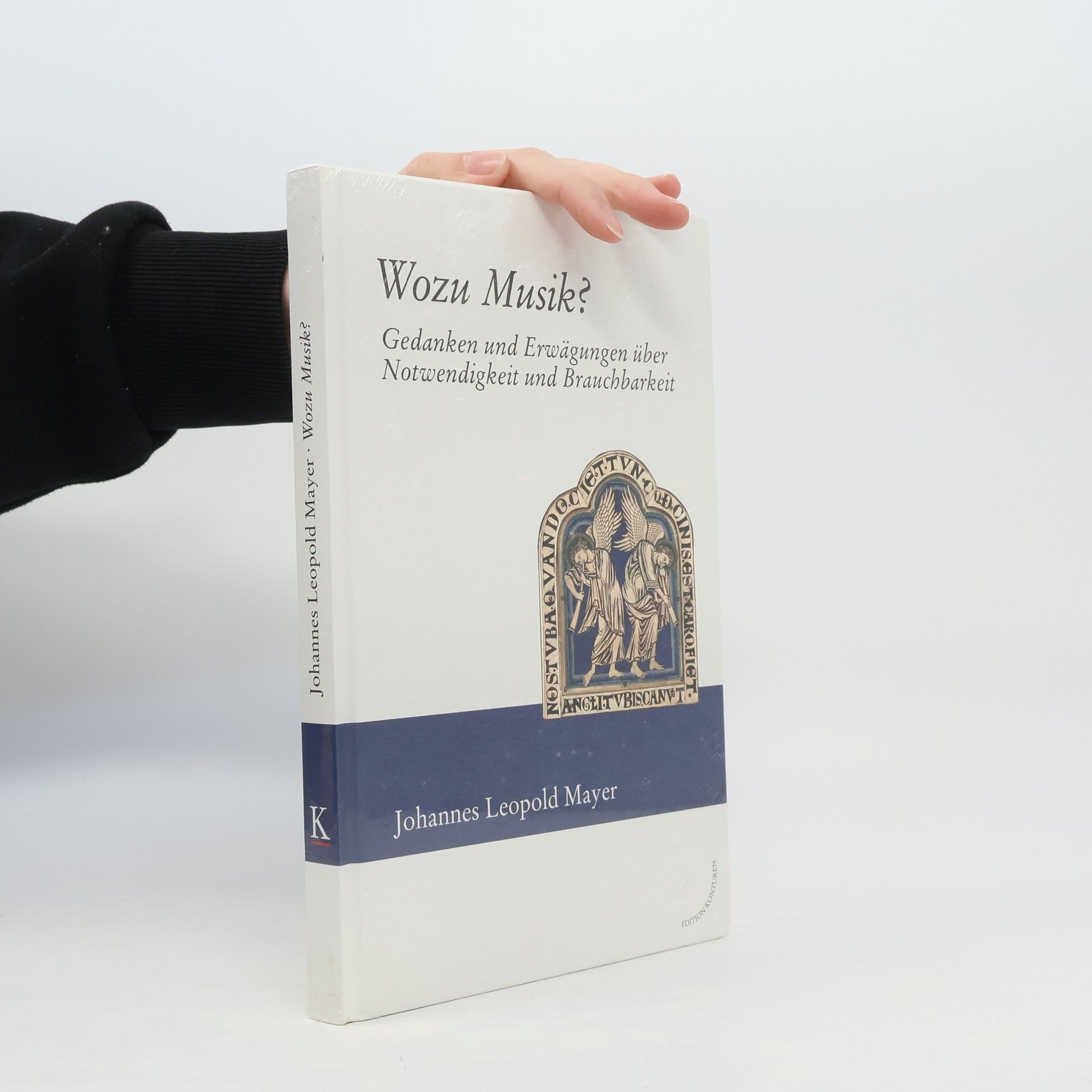


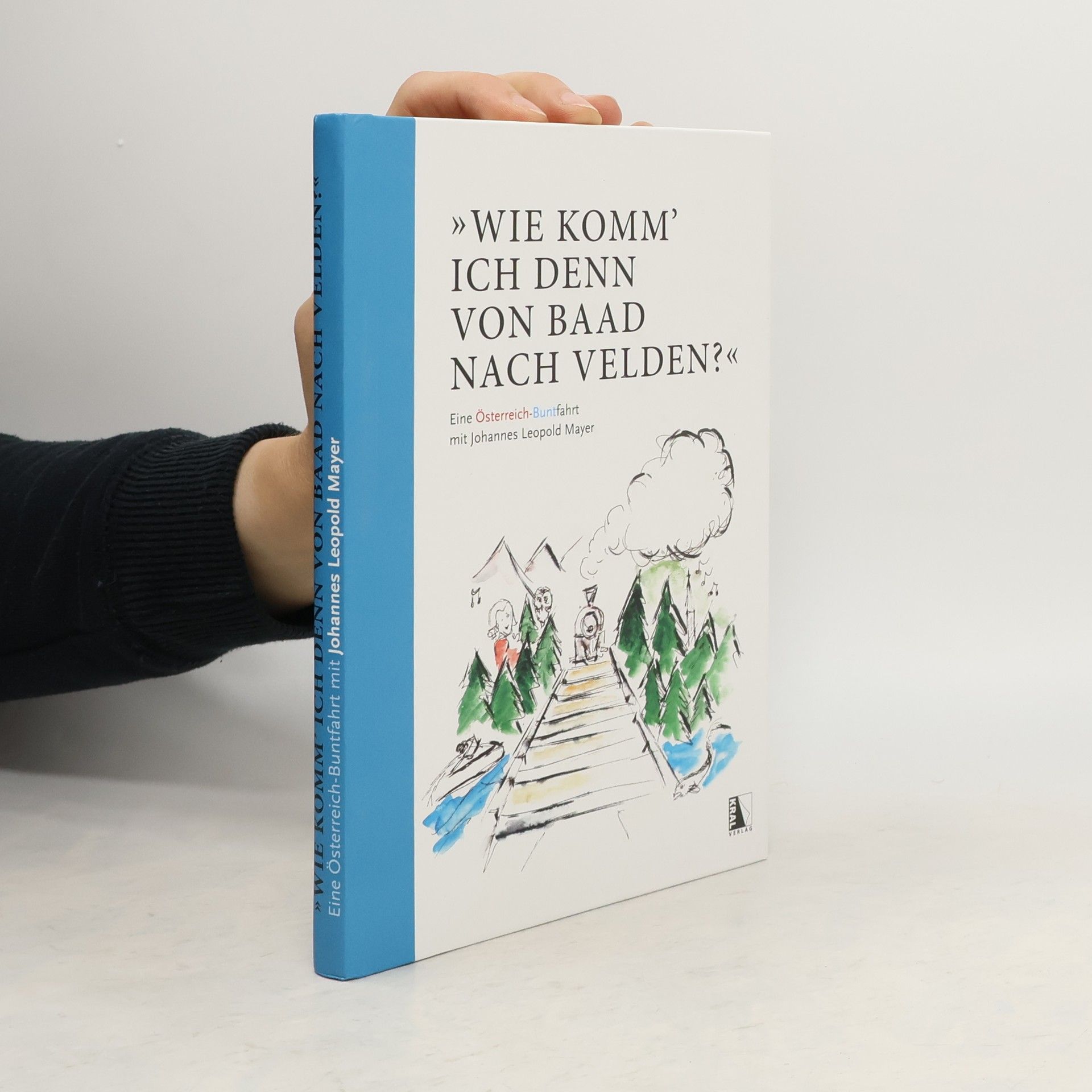
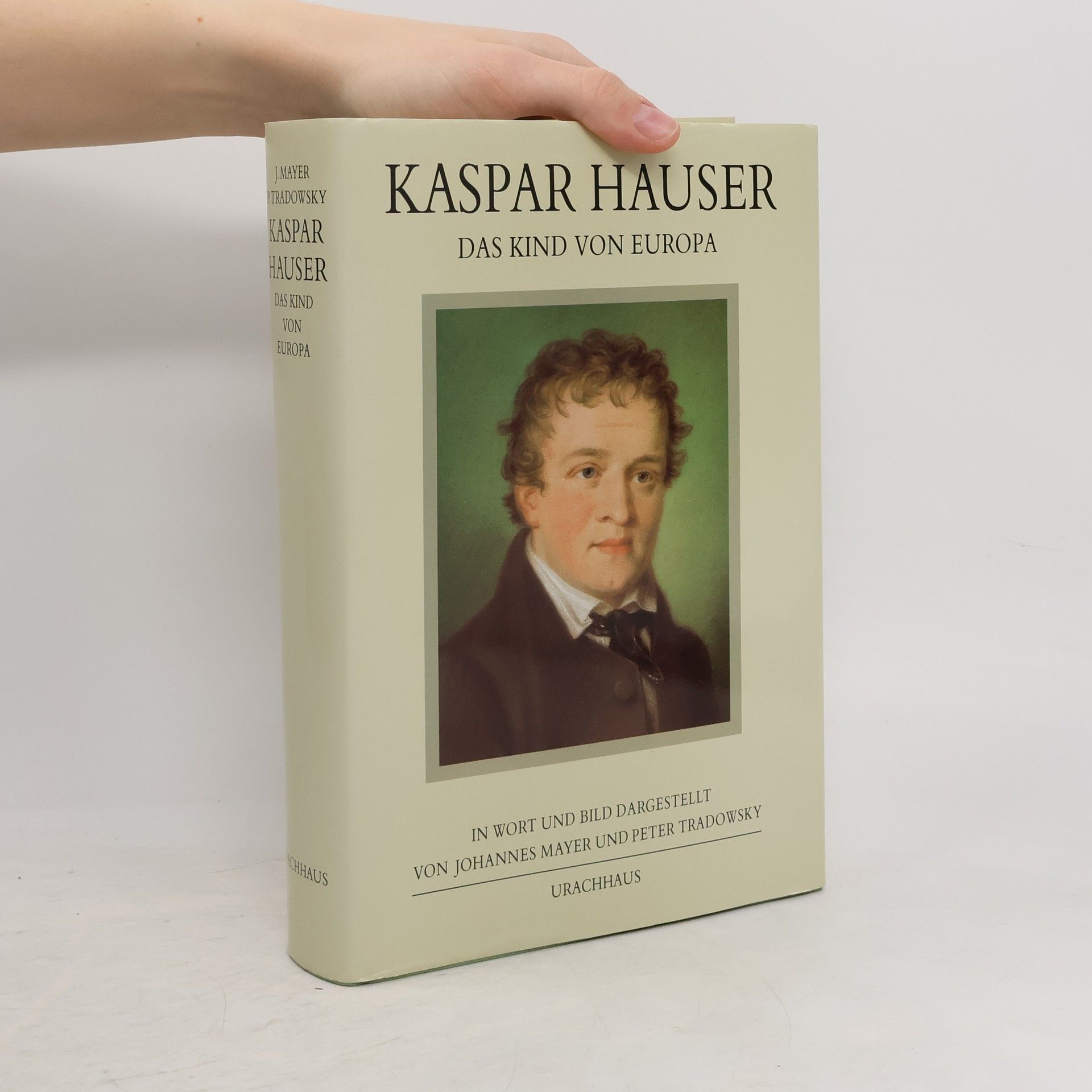
Johannes Leopold Mayer beschreibt in seinem Werk die bunte und vielfältige Landschaft sowie Geschichte Österreichs, die Höhen und Tiefen umfasst. Mit einem Hintergrund in Geschichte und Musikwissenschaft erforscht er abseits bekannter Pfade die Geheimnisse des Landes und führt kritische Gespräche über dessen geistige Prägung.
Lehrbuch Osteopathische Medizin
Studienausgabe
Das Lehrbuch zur Osteopathie bietet eine umfassende Darstellung der therapeutischen Strategien und diagnostischen Vorgehensweisen, gegliedert nach Körperregionen und Spezialgebieten. Es behandelt verschiedene Disziplinen wie Pädiatrie, Geriatrie und Schmerztherapie und vereint schulmedizinische und osteopathische Perspektiven. Ideal für Studierende und Praktizierende.
EHEMANN - VATER - FÜRST
Gesprächsweise Annäherungen an Markgraf Leopold III. von Österreich, „den Heiligen“
Heilig sein und Politiker sein – geht das zusammen? Was den heiligen Landespatron Niederösterreichs, Markgraf Leopold III. betrifft, so hatte dessen österreichisches Volk schon bald nach seinem Tod die Auffassung, dass das sogar sehr gut zusammengeht – und dies lange, bevor sich die Katholische Kirche zur Heiligsprechung des Landfürsten entschließen konnte. Aber was heißt das für Menschen im 21. Jahrhundert, welche nicht nur dem „Mittelalter“ weit entrückt sind, sondern vielfach auch Leopolds christlicher Gläubigkeit? Und doch: Eine Annährung, wie sie in diesem Buch versucht wird, kann zumindest nachdenklich machen hinsichtlich der Frage, was menschliche Größe über die Distanz der Jahrhunderte und Lebensformen bedeuten kann, zumal, wenn sie an einem Menschen, dessen Gedächtnis heute noch präsent ist, beobachtet werden kann. Mit den Mitteln seiner Wissenschaft, der Österreichischen Geschichte ebenso wie mit ganz persönlichen Fragestellungen, welche nicht zuletzt auf ererbt-gelebten Traditionen ebenso wie auf Lebenserfahrungen beruhen, möchte der Autor den Heiligen Leopold vor seinen eigenen Zeitgenossen und -genossinnen ins Bild setzen.
„Leben ist, so lehrt es die aktuelle medizinische Forschung ebenso wie die Neurowissenschaft, ohne Musik nicht vorstellbar. Jedenfalls nicht in jener Wertigkeit, welche das Leben lebenswert macht“, schreibt Johannes Leopold Mayer. Mit großer Intensität geht er der Frage nach, was Musik den Menschen verschiedener Zeiten und Gesellschaftsschichten ganz konkret bedeutet hat, und spart auch ihren Missbrauch nicht aus. Um zu ergründen, warum Musik unser Leben erst lebenswert macht, breitet er schließlich seine ganz persönlichen Überlegungen zu seinen fünf Lieblingskomponisten vor uns aus: Anton Bruckner, Joseph Haydn, Josquin des Prés, Olivier Messiaen und Dmitrij Schostakowitsch.
Band 22 der Enzyklopädie CORPUS MUSICAE POPULARIS AUSTRIACAE „WeXel oder Die Musik einer Landschaft” dokumentiert in Teilband 1 „Das Geistliche Lied” im Wechselgebiet. Im Mittelpunkt stehen 192 “Leichhüatlieder”, welche zwei Nächte lang im Hause des Verstorbenen vor dem aufgebahrten Toten gesungen wurden. Die Sammlung beleuchtet – vor dem (sozial)historischen und geographischen Hintergrund des Grenzgebietes „Herzogthum Steyermark” und „Österreich” – diesen bäuerlichen Brauch von der Monarchie bis heute. Wallaszkovits, Phonogrammarchiv, ÖAW), das Melodienregister (S. Scheybal), J. L. Mayers geistlicher Kommentar sowie ein Wörterbuch des lokalen Dialekts (I. Hausner, Inst. f. Dialekt- u. Namenlexika, ÖAW) ergänzen die Dokumentation im Auftrag des „Österreichischen Volksliedwerkes“. Mit der verpflichtenden Nutzung der ab 1965 errichteten Aufbahrungshallen sind die Lieder verklungen.