Das „Kompendium der Soziologie“ besteht aus drei Bänden: Im ersten Band werden die Grundbegriffe der Soziologie dargestellt. Der zweite Band behandelt die Klassiker der Soziologie, von Auguste Comte bis Talcott Parsons. Der dritte Band präsentiert die wichtigsten soziologischen Theorieansätze der letzten 50 Jahre, von Erving Goffman bis in die Gegenwart. Dieses Lehrbuch bietet eine kompakte, systematische und verständliche Einführung in die Soziologie. Auf diese Weise gelingt ein hervorragender Einstieg in das Fach und wird ein fundierter, umfassender Überblick ermöglicht.
Heinz-Günter Vester Bücher
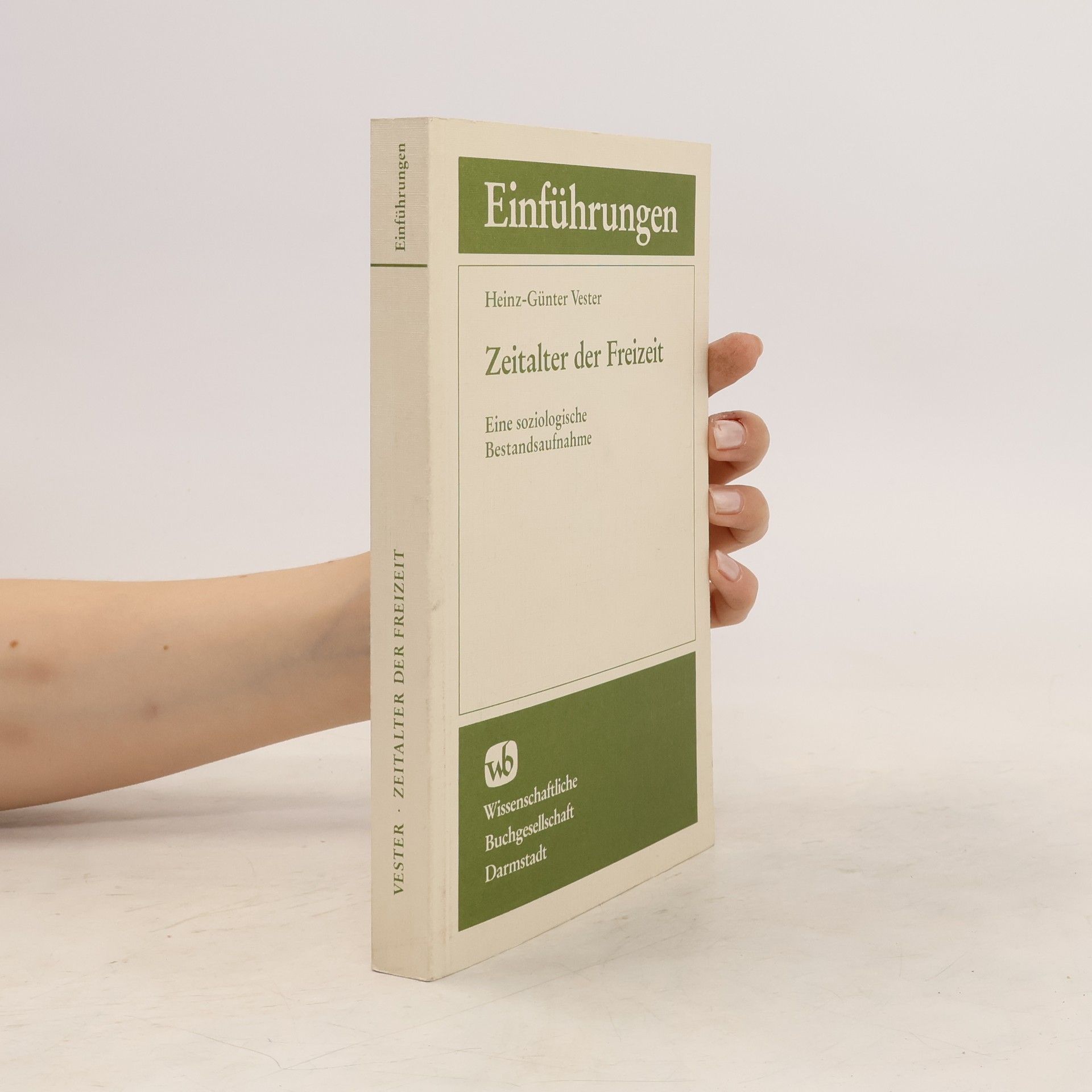
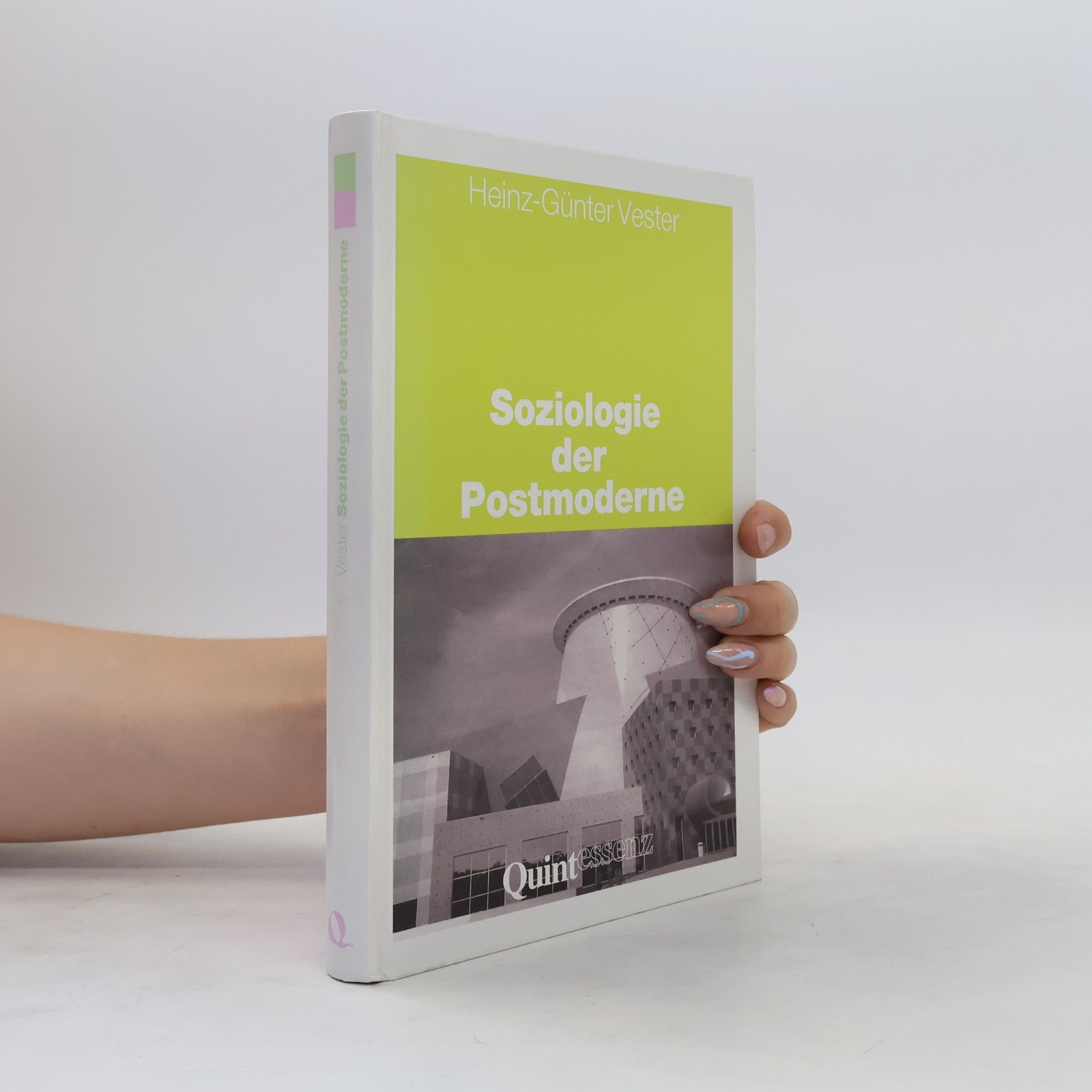
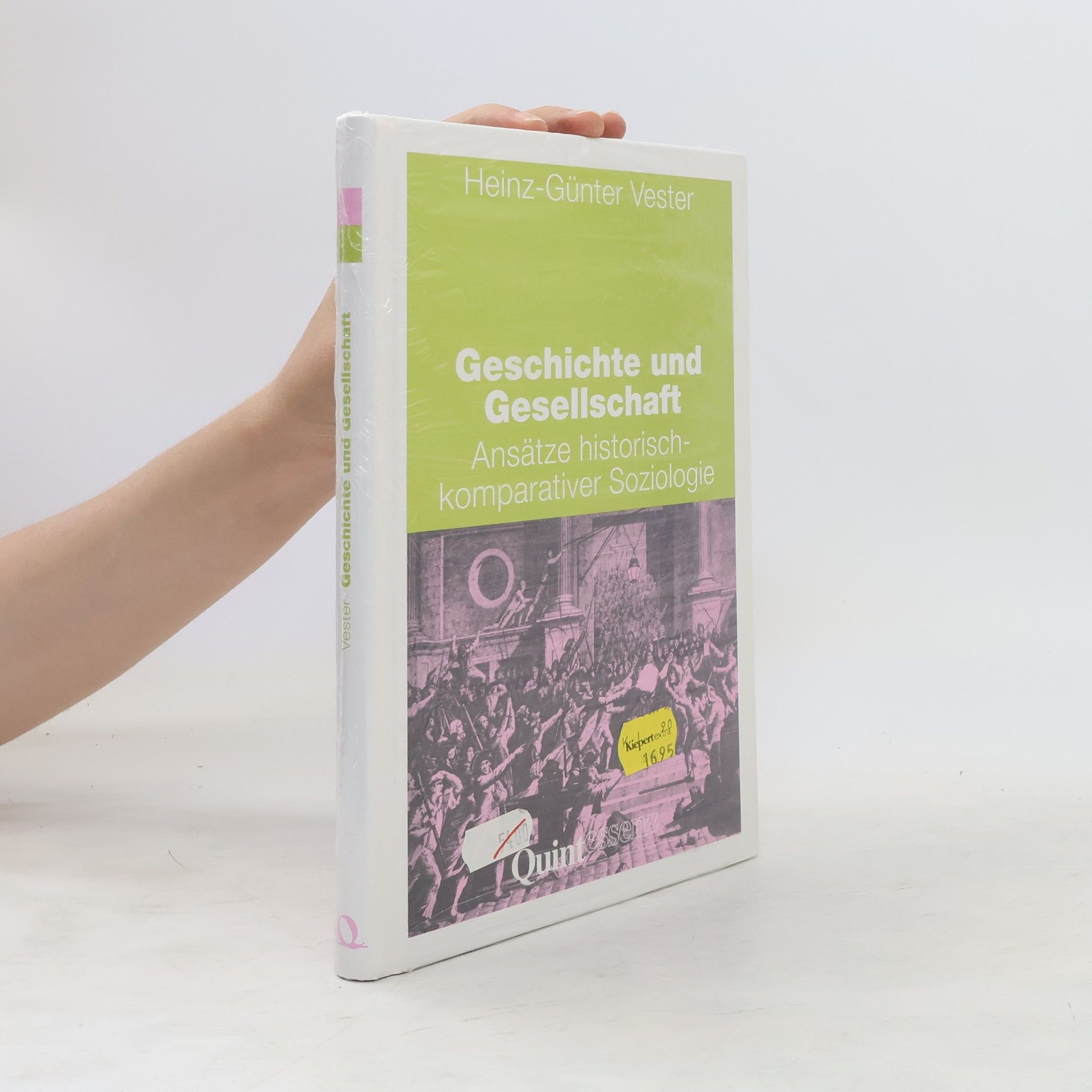

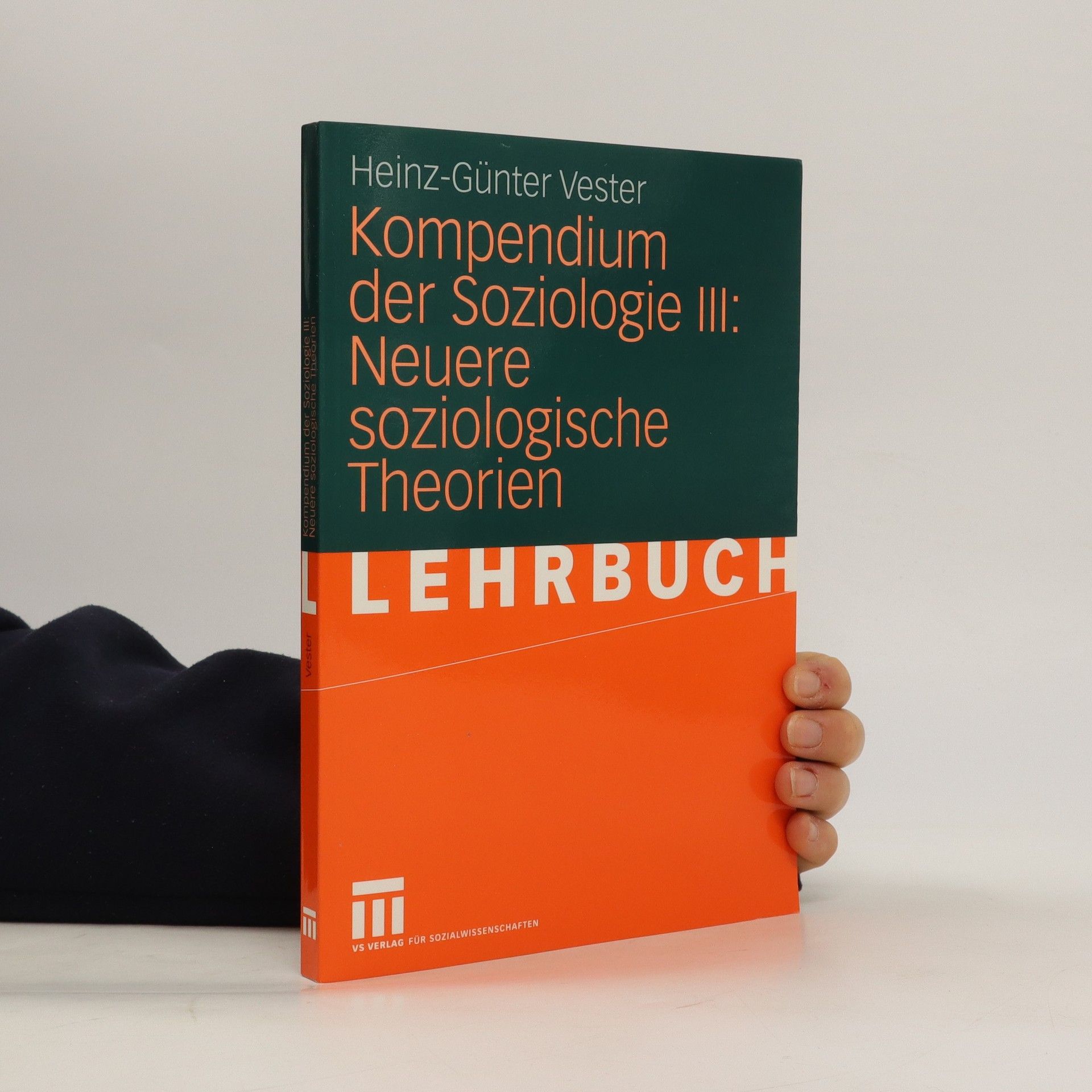
Das "Kompendium der Soziologie" besteht aus drei Banden: Im ersten Band werden die Grundbegriffe der Soziologie dargestellt.