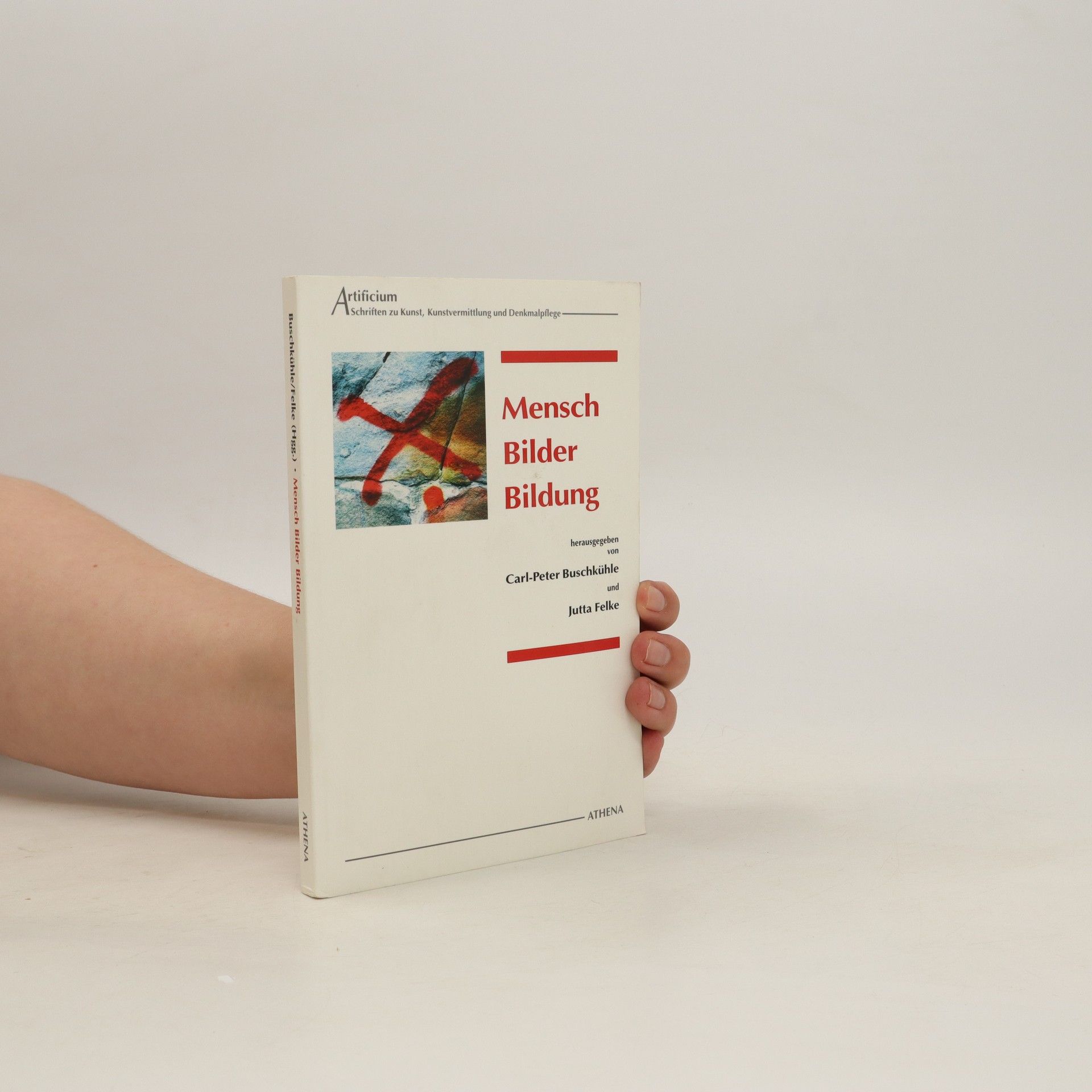Wärmezeit
Zur Kunst als Kunstpädagogik bei Joseph Beuys
Das Grundlagenwerk zur Kunstpädagogik von Joseph Beuys sowie zur künstlerischen Bildung untersucht, welche Impulse das Werk von Joseph Beuys für eine zeit- und kunstgemäße Kunstpädagogik setzt. Den Kern bildet eine Gesamtinterpretation des Beuys'schen Schaffens aus der kunstpädagogischen Perspektive. Daraus werden Anforderungen an eine künstlerische Bildung formuliert. Wesentliche Elemente der Kunstpädagogik werden mit aktuellen Entwicklungen in der ästhetischen Bildung und mit philosophischen Theorien über Kunst, Wissenschaft, Erkenntnis und Existenz verknüpft. Buschkühles Blick auf das Werk von Beuys weist auf eine künstlerische Bildung, die den Menschen ganzheitlich" in Denken, Handeln und Lebensführung beeinflusst. 0Wer sich in Kunstpädagogik, Kunstwissenschaft und Kunsthistorik mit der Verbindung von Kunst und Bildung befasst, findet hier einen wesentlichen Zugang zum erweiterten Kunstbegriff und zu pädagogischen Aspekten im Werk von Joseph Beuys