Landschaften wie Galizien, Bessarabien, Podolien oder die Bukowina existieren heute nicht mehr auf Landkarten. In diesem östlichen Gürtel Europas, zwischen Baltikum und Schwarzem Meer, lebte einst die Mehrheit der europäischen Juden, die während des Zweiten Weltkriegs nahezu vollständig ermordet wurde. Die Geschichte Osteuropas ist geprägt von Unabhängigkeitsbestrebungen und dem fortwährenden Versuch von Imperien, diese Völker zu unterdrücken. Der aktuelle Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat diese schmerzhaften Erinnerungen wieder aufgeworfen. Diese Region war über Jahrhunderte das Zentrum des europäischen Judentums und erlebte immer wieder Verfolgungen. Jüdisches Leben hat hier entscheidend zur Entwicklung der östlichen Hälfte des Kontinents beigetragen, bevor es mit dem deutschen Überfall im Zweiten Weltkrieg fast vollständig ausgelöscht wurde. Dennoch sind seine Spuren weiterhin sichtbar, und seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion wird wieder offen über sie gesprochen. Der Fotograf und Blogger Christian Herrmann hat in zahlreichen Reisen diesen Spuren nachgeforscht. Er fand verwilderte Friedhöfe, zerstörte oder umgenutzte Synagogen und Hinweise auf jüdisches Erbe, das allmählich in neuen nationalen Narrativen seinen Platz findet. Mit Beiträgen von Samuel D. Gruber und Rolf Sachsse.
Christian Herrmann Bücher
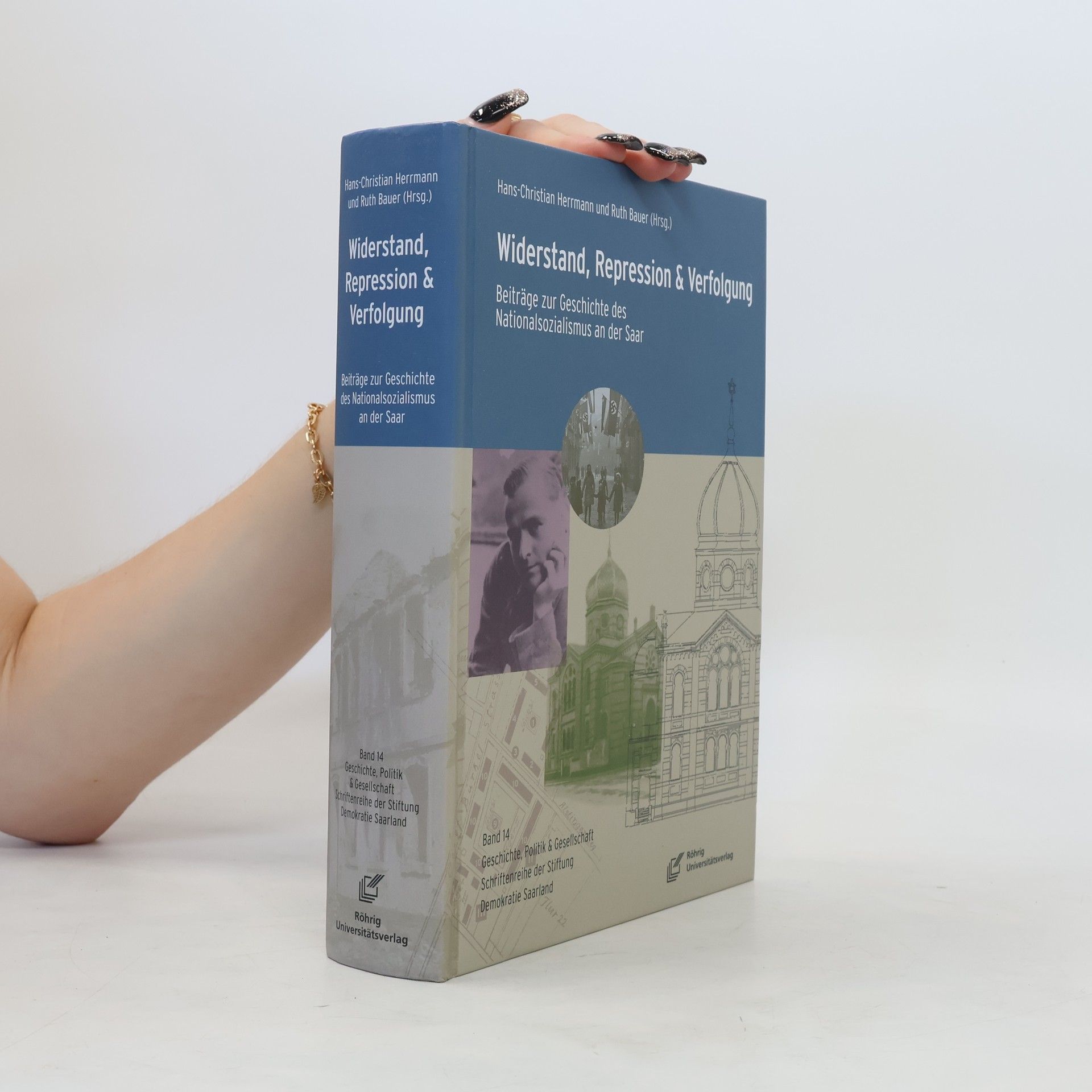


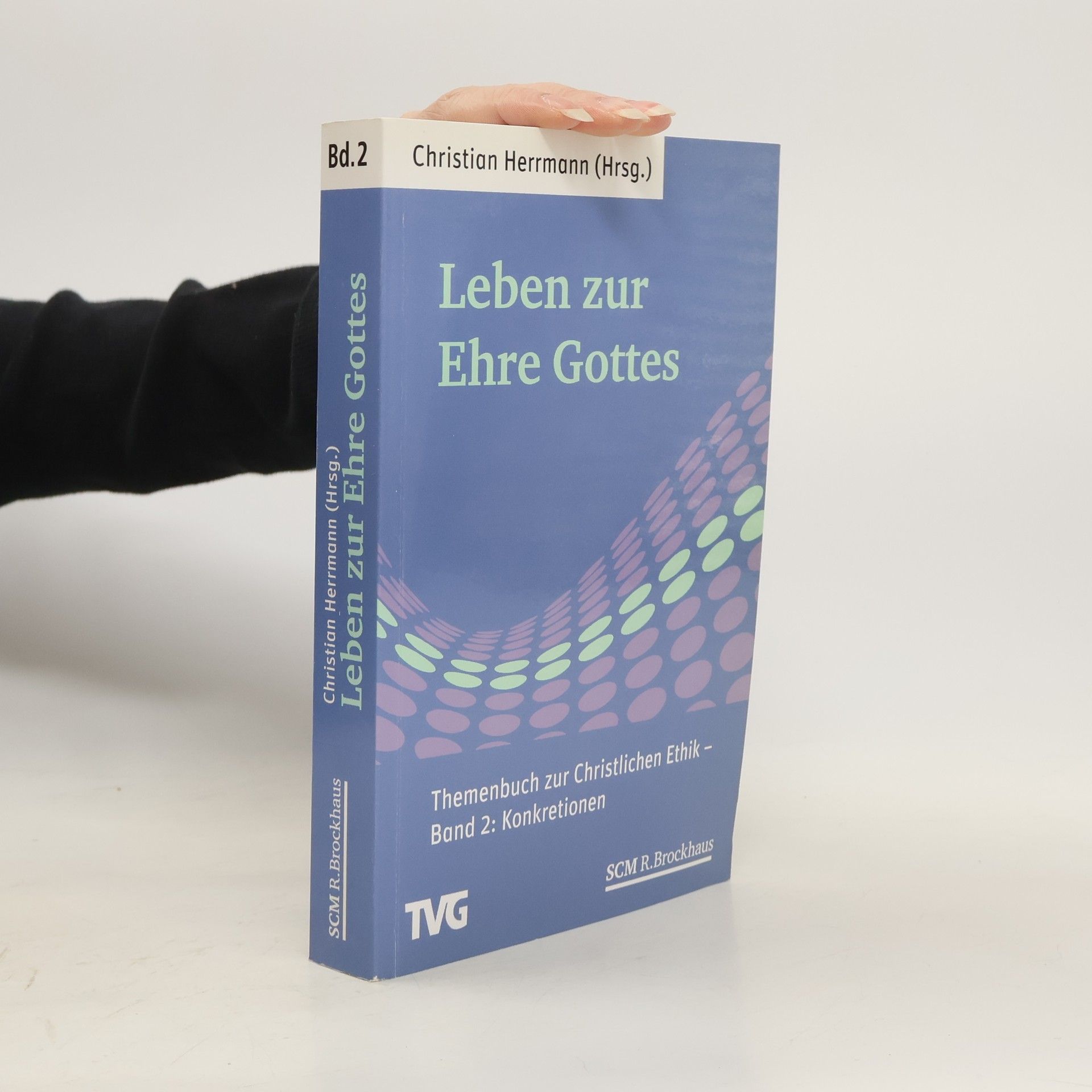

bildfromm?
Die Bibel in Bildern
Das Zueinander von Sehen und Glauben, Sehen und Erkenntnis durchzieht die Bibel. Bei Bibel-Illustrationen, bei der Bibel in Bildern geht es um den Zusammenhang von Wort und Sehen, um die Wirkung der Botschaft. Das Verbot der bildlichen Darstellung Gottes gilt, wird aber doch bildlich veranschaulicht. Bilder konnen Glauben stiften und starken, Textinhalte prazisieren und visuell neu erzahlen. Die Ausstellung deutet Antworten an auf die Fragen: Wird man bzw. wie wird man durch das Betrachten von Bibelillustrationen fromm? Wie druckt sich Frommigkeit im Bild aus?
Kriege gehören zu den prägendsten Erfahrungen im menschlichen Leben. Ihre ganz persönliche Verarbeitung in Form von Ego-Dokumenten gibt uns ergänzende und detailreiche Einblicke in die Geschichte jenseits der offiziellen Dokumente und bekannten historischen Darstellungen. Der Band versammelt unter dem Motto „Kriegserinnerungen und Kriegsfolgen“ Editionen und Auswertungen von Feldpostbriefen, Tagebüchern und Lebenserinnerungen aus der Saarregion von der Zeit der Türkenkriege über den deutsch-französischen Krieg bis zum Ersten und Zweiten Weltkrieg sowie die überraschende Interpretation eines eher ungewöhnlichen Denkmals in Saarbrücken. Das Schwerpunktthema ergänzen ein Beitrag zur altkatholischen Gemeinde im Saarland, eine Dokumentation des Landesrates des Saargebietes in der Völkerbundszeit, eine Untersuchung zu Euthanasie und Zwangssterilisation im Saarland von 1935-1945 sowie ein Blick auf die saarländische Identität im Wandel anlässlich des 65. Geburtstages des Bundeslandes 2022.
Widerstand, Repression und Verfolgung
- 473 Seiten
- 17 Lesestunden
Die Beiträge des Buches bieten klare Antworten auf zentrale Fragen der NS-Geschichte an der Saar, wie die Zustimmung der Saarländer zu Hitler-Deutschland 1935 und den frühen Antisemitismus. Es wird untersucht, warum es keinen massiven Widerstand der katholischen und evangelischen Kirche gegen die Rückgliederung gab und warum christliche Kräfte nicht mit Sozialdemokraten und Kommunisten eine Mehrheit gegen Hitler mobilisieren konnten. Die Publikation beleuchtet die innenpolitische Situation zwischen 1930 und 1935 und berücksichtigt bedeutende Persönlichkeiten wie Hermann Röchling und Franz-Josef Röder im Kontext der Saarabstimmung. Zudem wird die Entwicklung jüdischen Lebens an der Saar vom 19. Jahrhundert bis zum Holocaust thematisiert, einschließlich einer Biographie des Saarbrücker Rabbiners Friedrich Schlomo Rülf. Ein weiterer Fokus liegt auf dem Gestapo-Lager Neue Bremm, das Einblicke in die Biographien der Täter und die Bedingungen ihrer Taten bietet. Die Themen Entnazifizierung und Wiedergutmachung schließen dieses düstere Kapitel der deutschen und saarländischen Geschichte ab. Der Band spannt den Bogen von 1935 bis 1955 und ist trotz seines wissenschaftlichen Ansatzes kompakt und verständlich. Ein spezielles didaktisches Kapitel unterstützt Lehrerinnen und Lehrer dabei, die Geschichte des Nationalsozialismus mit ihren Klassen anhand regionaler Beispiele zu erarbeiten.