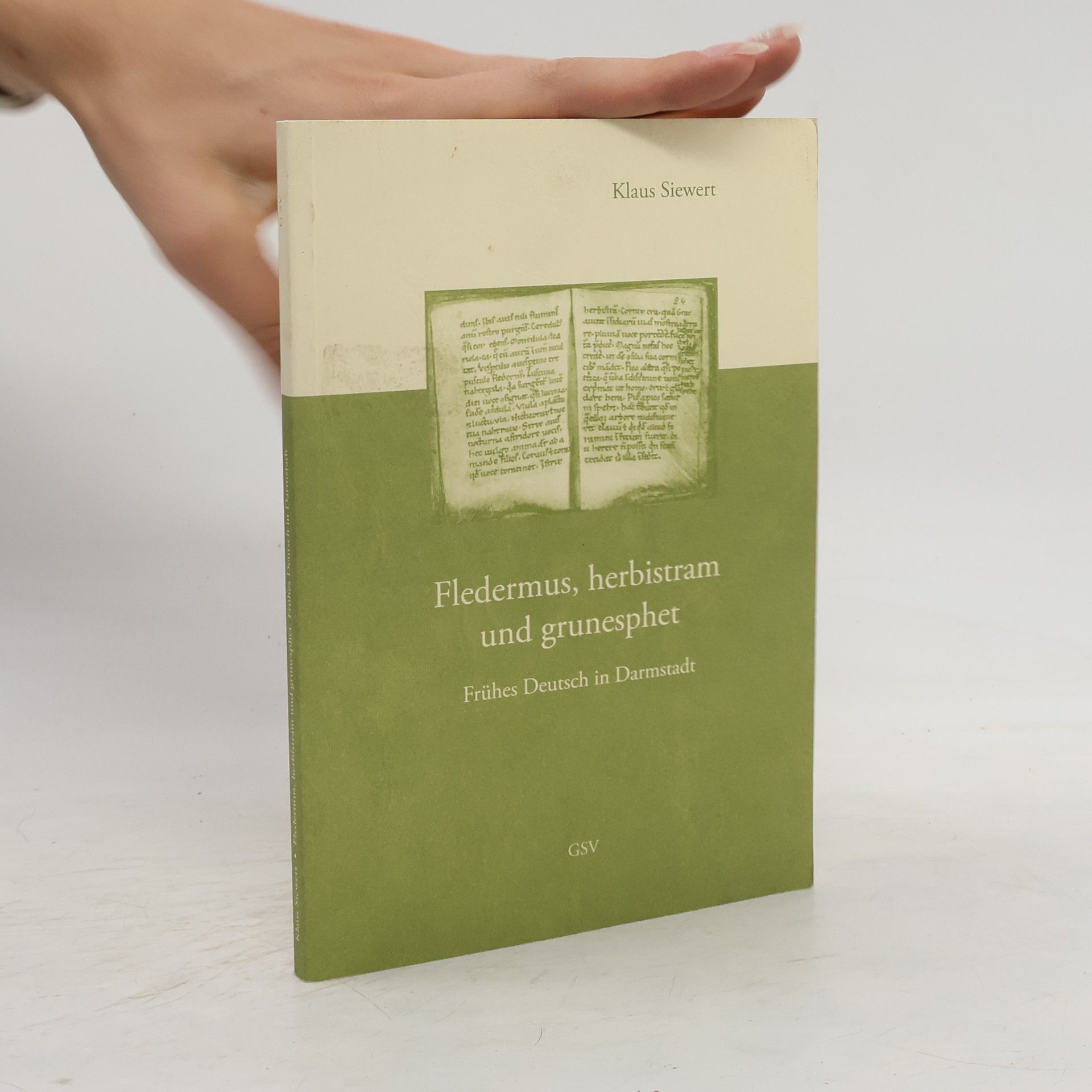Wörterbuch Deutsch-Buttjersprache
Mit Karikaturen von Klaus Holthaus
Das Wörterbuch Deutsch–Buttjersprache ist aus der 2002 erschienenen Dokumentation „und sie knospelte ihr ersten kutschabo. Die Mindener Buttjersprache“ erarbeitet und um neu hinzugekommene Wörter erweitert worden. Es ermöglicht erstmals den Zugang zur Buttjersprache vom Hochdeutschen her. Sämtliche Sprachdaten beruhen auf Sprecherbefragungen. Der Anhang mit Sprüchen und Satzbeispielen führt den Leser in Textzusammenhänge. Karikaturen zeigen die Welt des Mindener Buttjers in Bildern.