Paul Michel Bücher
Dieser Autor erforscht die Komplexität menschlicher Verbindungen und findet Schönheit im Alltäglichen. Sein Schreiben wird für seine rohe Ehrlichkeit und seine lyrische Prosa gefeiert, die die Leser in tiefgründige emotionale Landschaften zieht. Mit einem scharfen Blick für Details und einem durchdringenden Einblick in die menschliche Verfassung fängt er die flüchtigen Momente des Lebens ein. Er schafft Werke, die lange nach der letzten Seite nachklingen.
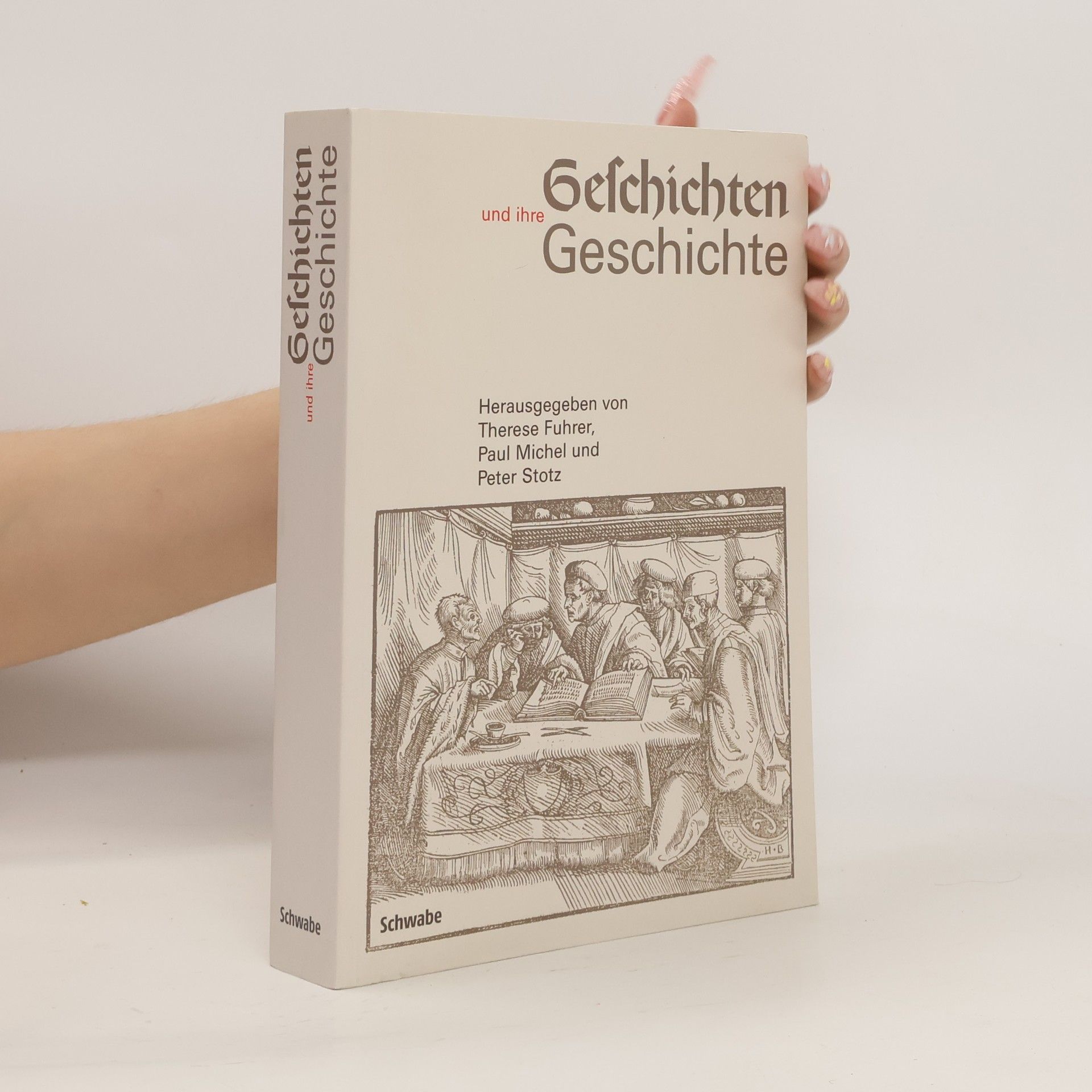
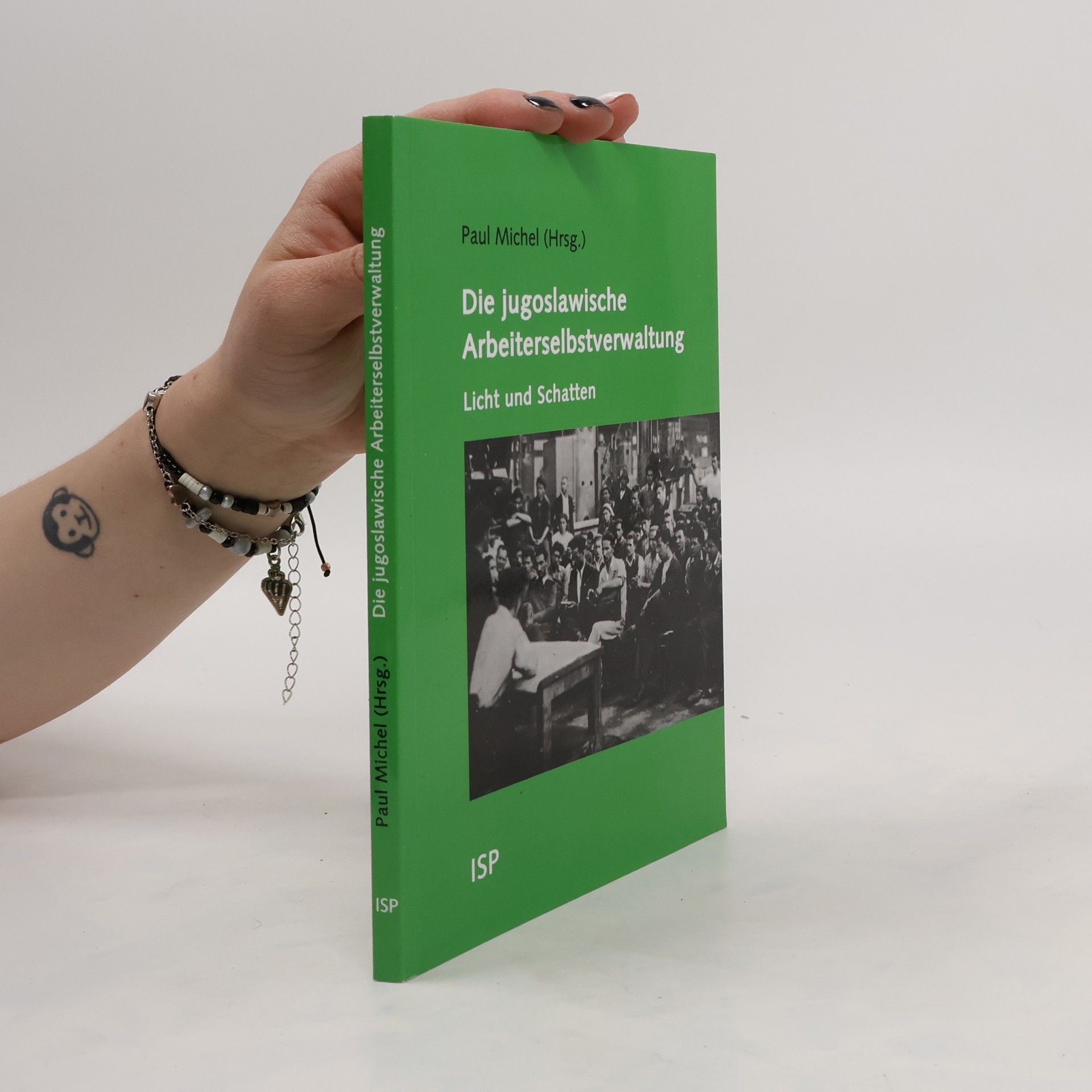
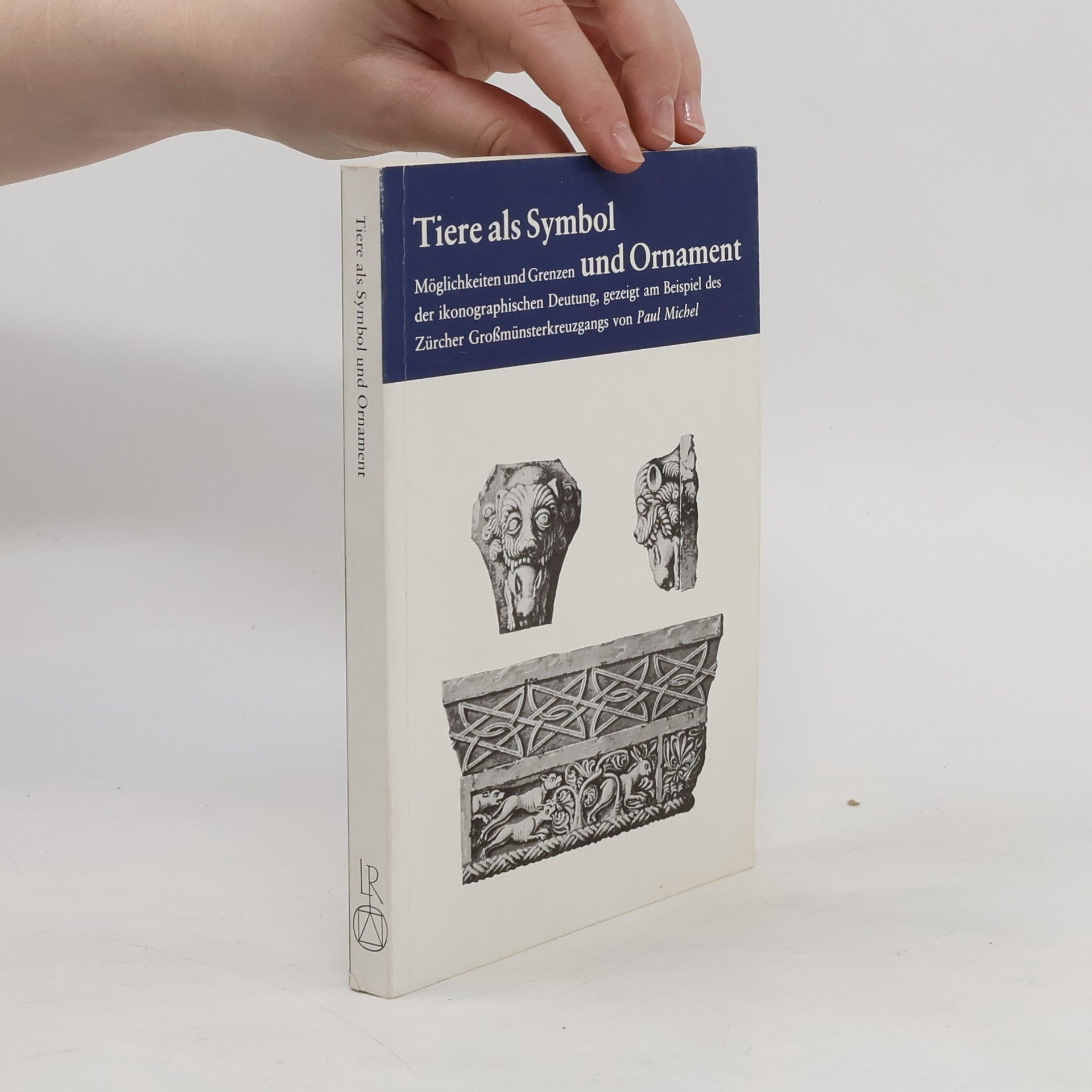
Die jugoslawische Arbeiterselbstverwaltung und die damit verbundene Selbstverwaltung in den Kommunen sind heutzutage fast vergessen. In den 1950er und 1960er Jahren war das Projekt, das die jugoslawischen Kommunisten »erfunden« hatten, nachdem sie 1948 von Stalin exkommuniziert worden waren, in aller Munde.Die Beiträge von Jean-Arnault Dérens, Catherine Samary und Paul Michel rufen die Bemühungen der 1950er und 1960er Jahre in unser Gedächtnis zurück, in Jugoslawien einen Sozialismus zu schaffen, in dem die Menschen an der Basis, in den Betrieben und Gemeinden, das Heft selbst in die Hand nehmen. Im neuen System der Arbeiterselbstverwaltung wirkten von Beginn an neben diesen emanzipatorischen Ansätzen die Kräfte des Marktes als Destruktivkräfte: Die ihnen innewohnende Dynamik wurde nicht eingedämmt, sondern gefördert und konnte sich immer ungehemmter entfalten.Das Buch zeichnet Licht und Schatten in den realen gesellschaftlichen Experimenten der 1950er Jahre nach, die widersprüchlich, chaotisch und innovativ waren und in den 1960er Jahren der jugoslawischen Führung eine grundsätzliche Weichenstellung aufzwangen.Die Erfahrungen mit der Arbeiterselbstverwaltung in Jugoslawien vermögen Denkanstöße zur nach wie vor ausstehenden »Neuvermessung der Utopie« zu geben. Sie geben aber auch einen Eindruck davon, welche Abgründe sich beim Beschreiten dieses Wegs auftun können.
Geschichten und ihre Geschichte
- 440 Seiten
- 16 Lesestunden