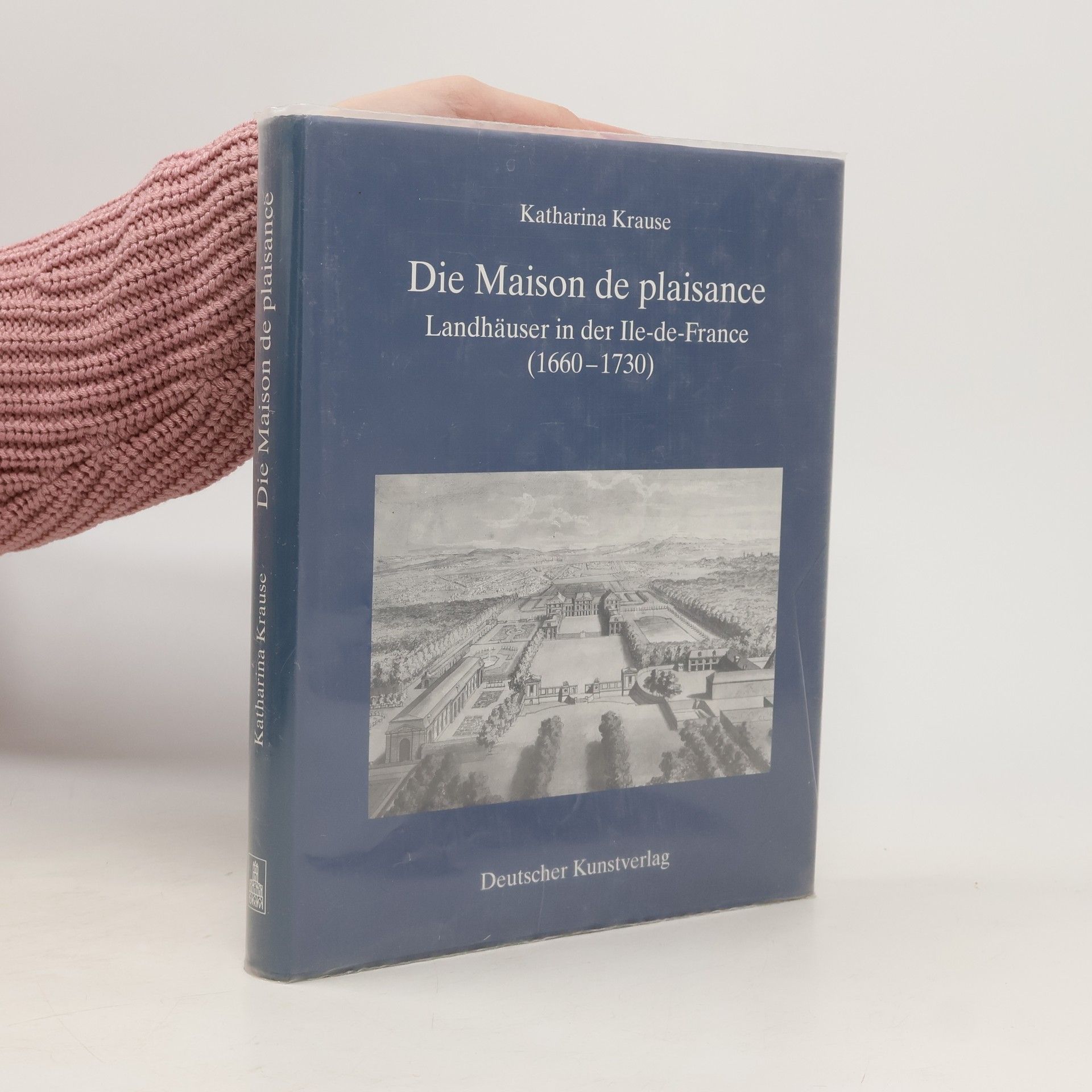Gefährliche Bilder
Milchfrauen, Lumpensammler und anderes Straßenvolk in der großen Stadt
- 450 Seiten
- 16 Lesestunden
Bilder können politische Verhältnisse stabilisieren oder Unsicherheit erzeugen. Dies wird an den zahllosen Grafiken der „Cris de Paris“ (Pariser Kaufrufe) untersucht, die vom 16. bis zum 20. Jahrhundert entstanden. Hinzu kommen andere Darstellungen der sogenannten „Unterschichten“. Denn die Vorstellungen der Eliten wurden zunehmend durch Ereignisse wie Revolutionen und Aufstände, Epidemien und die Industrialisierung geprägt. Die Angst der Eliten vor der politischen Wirkung von Bildern bei der Bevölkerung ist ein zentrales Thema des Buchs. Ein Fokus liegt auf der Phase der Restauration und der Julimonarchie, da in dieser Zeit die großen sozialen Veränderungen parallel zu erheblichen bildkünstlerischen und -technischen Innovationen erfolgten (Lithographie, Holzstich, Fotografie).