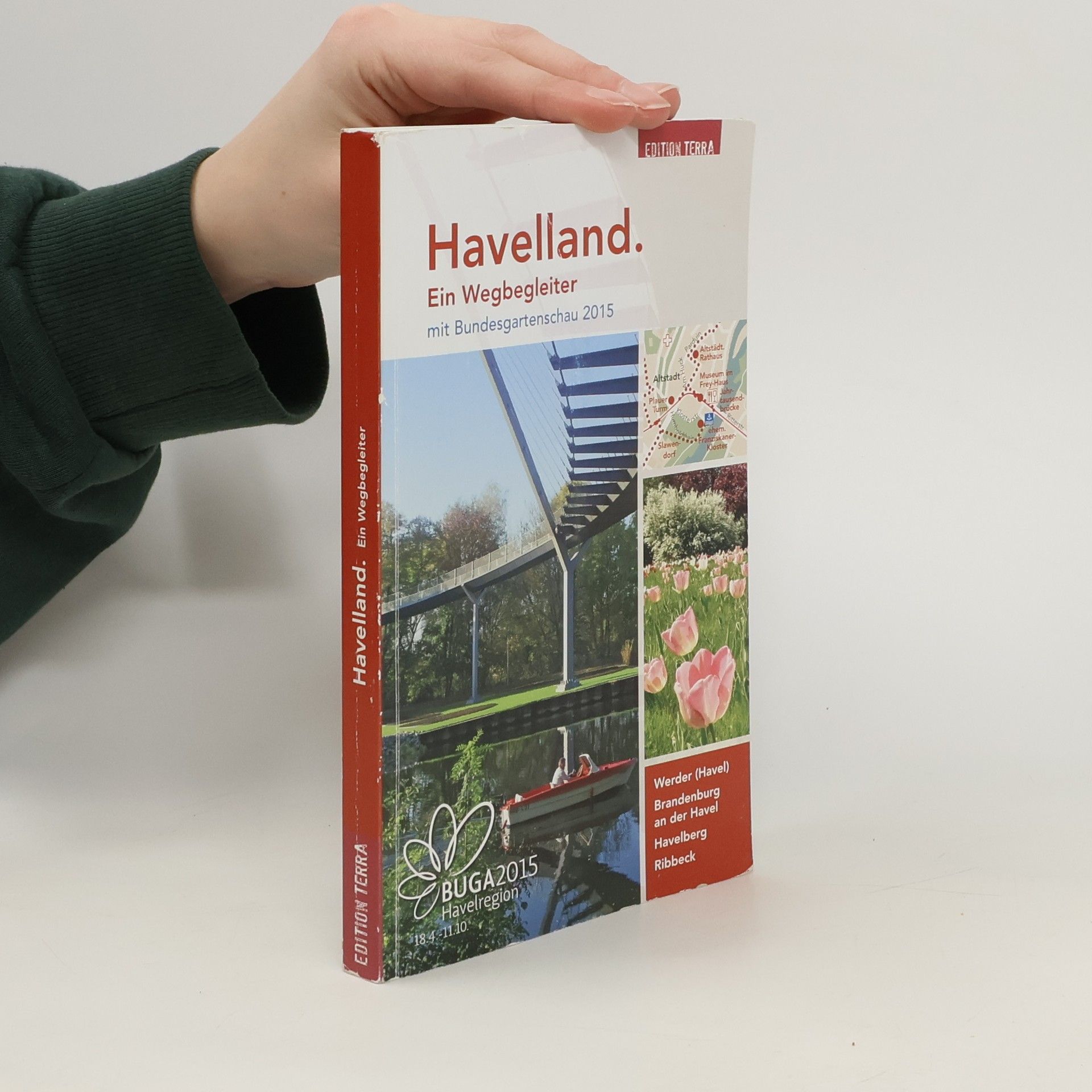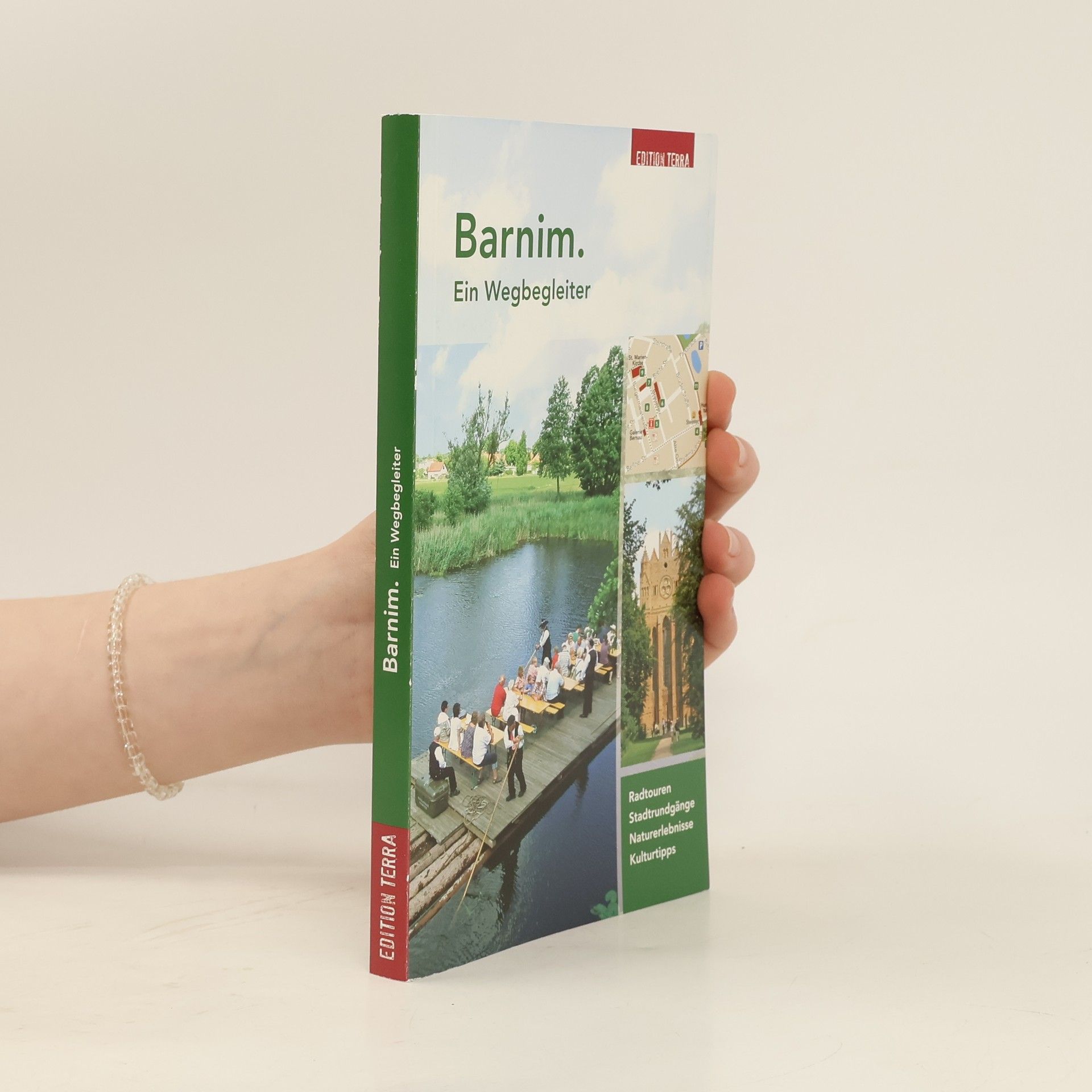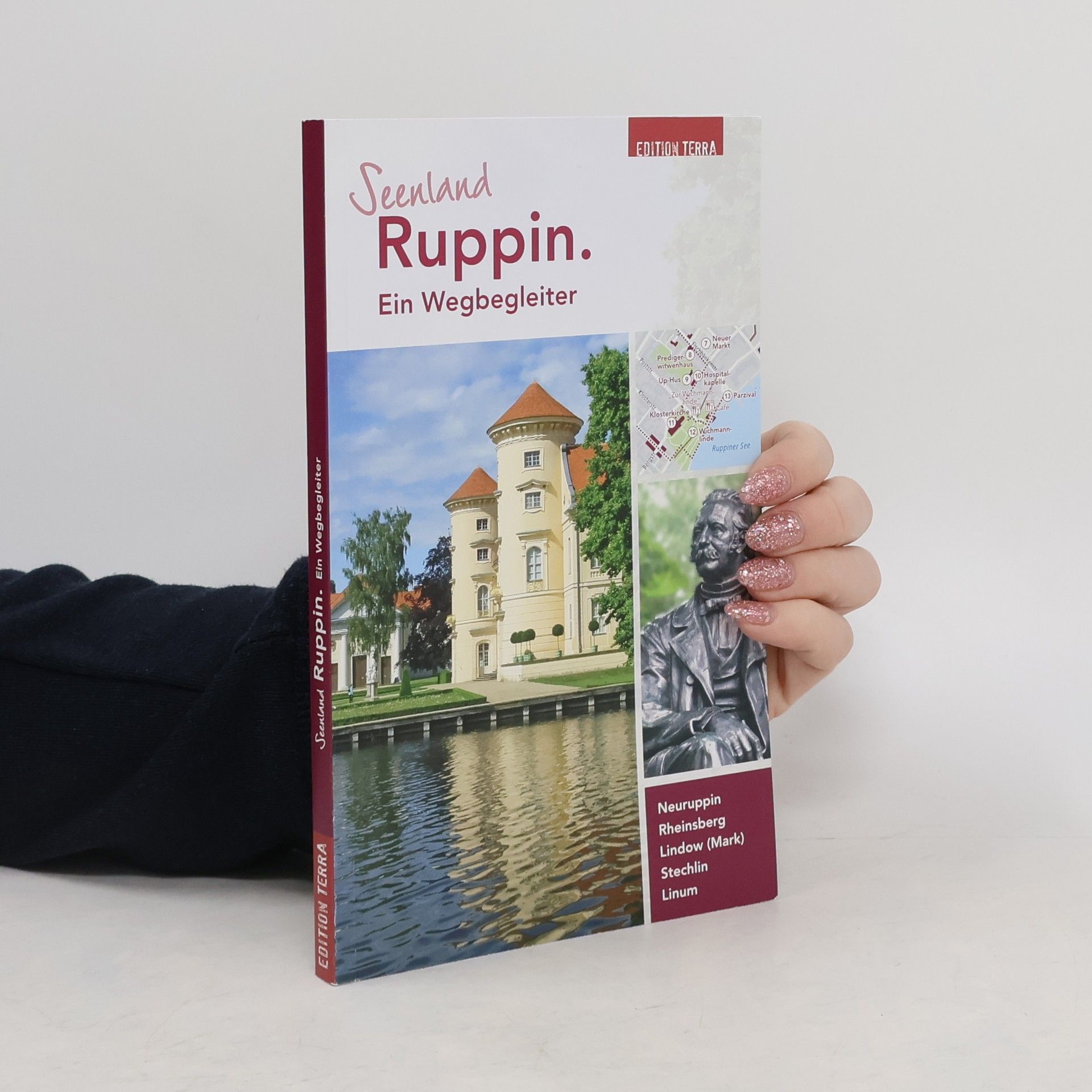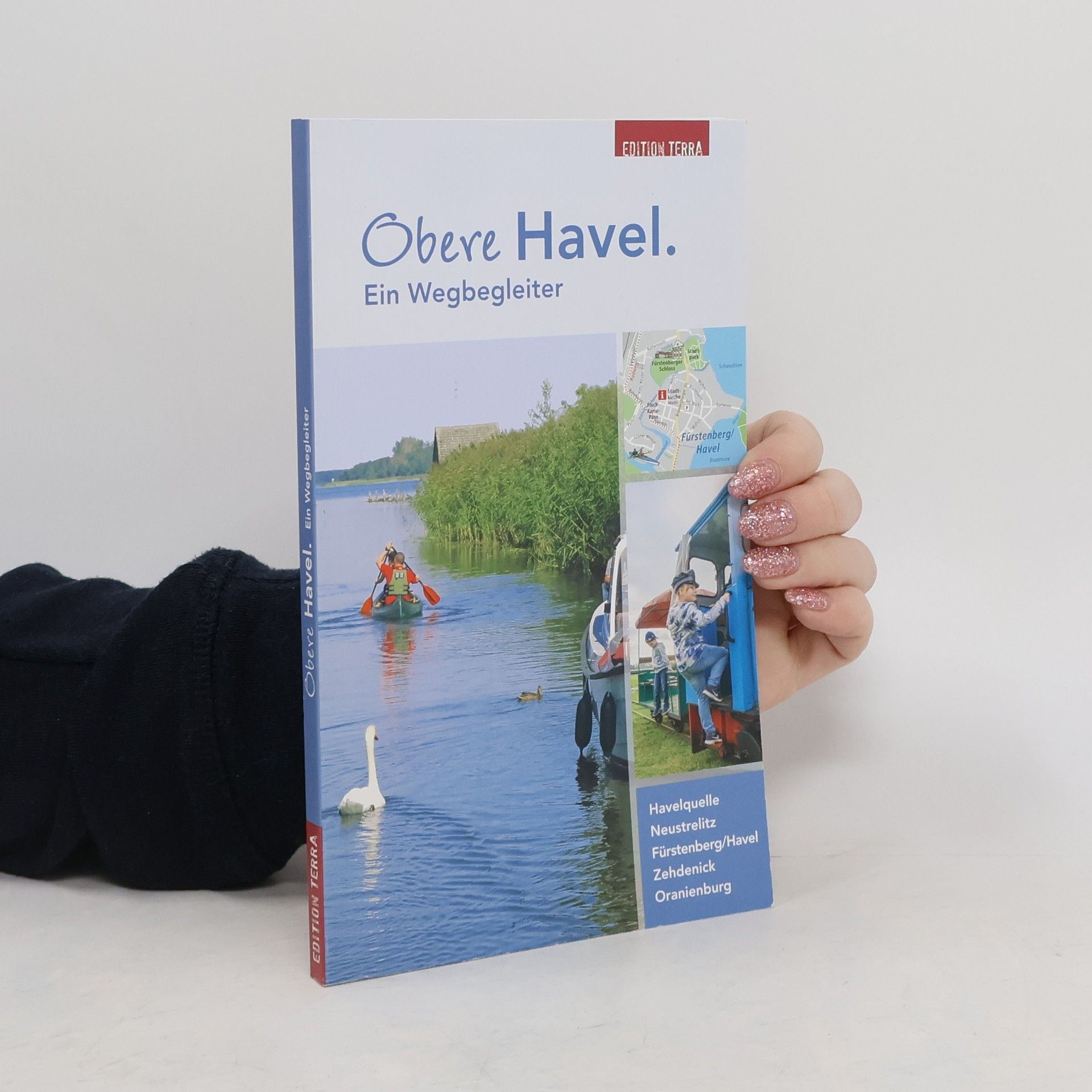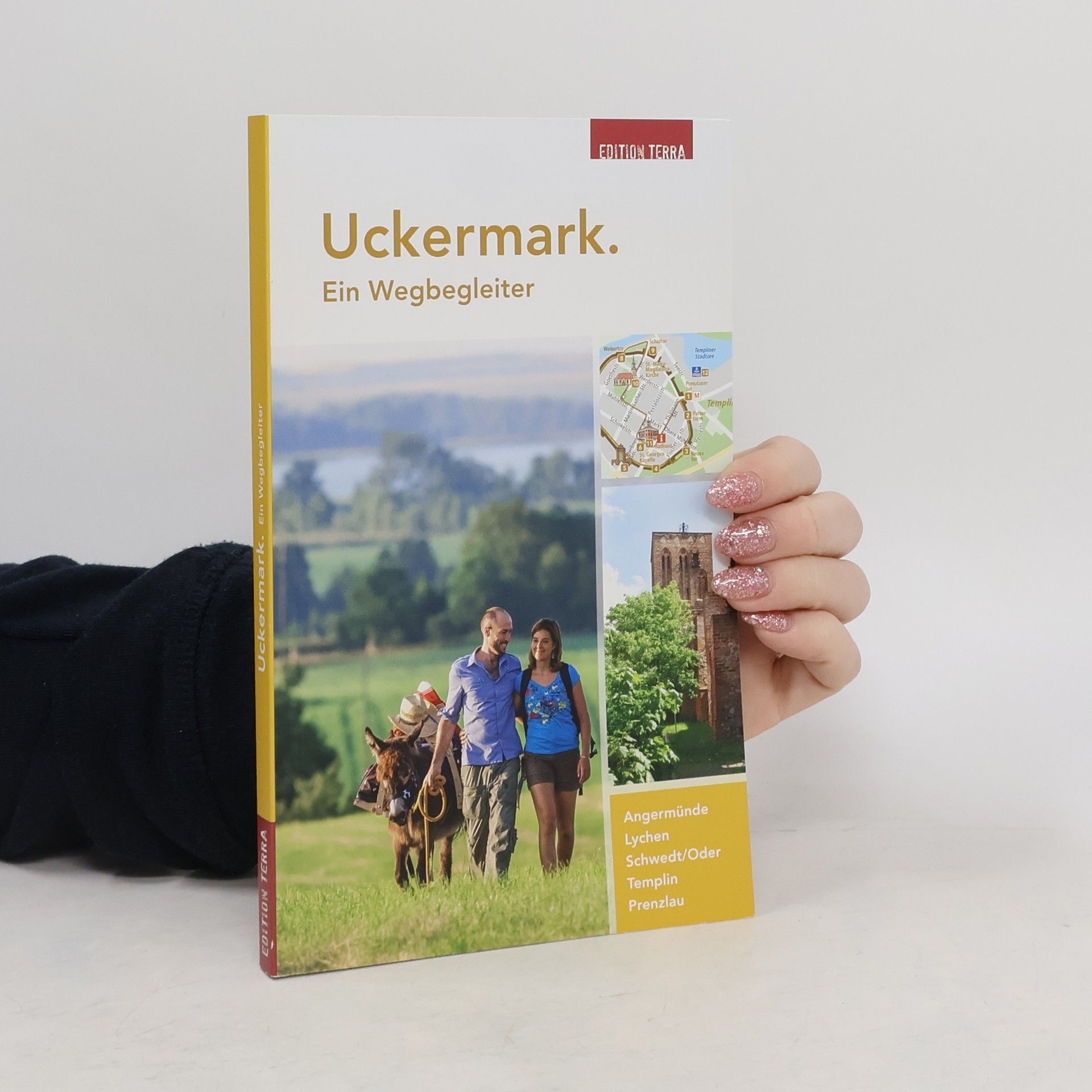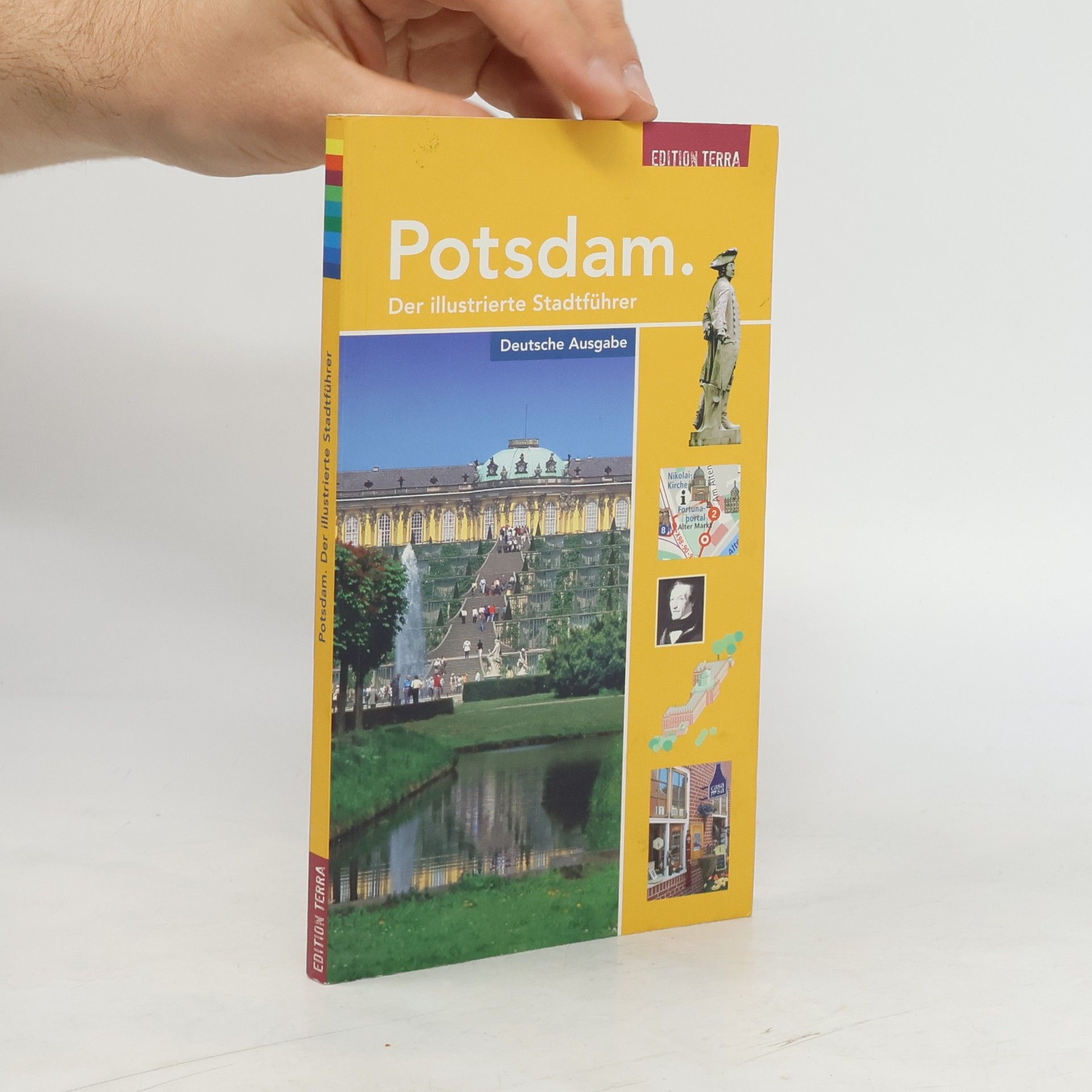ICP Emissionsspektrometrie für Praktiker
Grundlagen, Methodenentwicklung, Anwendungsbeispiele
- 288 Seiten
- 11 Lesestunden
Die Neuauflage dieser leicht verständlichen Einführung in die ICP-Emissionspektrometrie bietet praxisrelevante Grundlagen, technische Informationen, eine Anleitung zur Methodenentwicklung und zahlreiche Anwendungsbeispiele. Das Inhaltsverzeichnis umfasst verschiedene Themenbereiche, beginnend mit einem Überblick über die analytischen Merkmale und die Verbreitung der ICP OES sowie weiteren Techniken zur Elementanalytik. Es behandelt das Plasma, einschließlich Betriebsgas, Plasmafackel und Anregung zur Emission elektromagnetischer Strahlung. Des Weiteren wird die Optik und der Detektor des Spektrometers erläutert, gefolgt von der Methodenentwicklung, die Wellenlängenauswahl, Auswerte- und Korrekturtechniken sowie Optimierung und Validierung umfasst. Die Routineanalyse behandelt die Probenvorbereitung, Kalibrierung und analytische Qualitätssicherung. Ein Abschnitt widmet sich der Fehleranalyse, um Ursachen zu finden und zu vermeiden. Zudem werden Anwendungen in verschiedenen Bereichen wie Umwelt, Biologie, Geologie, Metallurgie und Materialwissenschaften behandelt. Abschließend wird auf die Beschaffung und Vorbereitung des Labors eingegangen, einschließlich der Auswahl geeigneter spektrometrischer Techniken und Geräte.