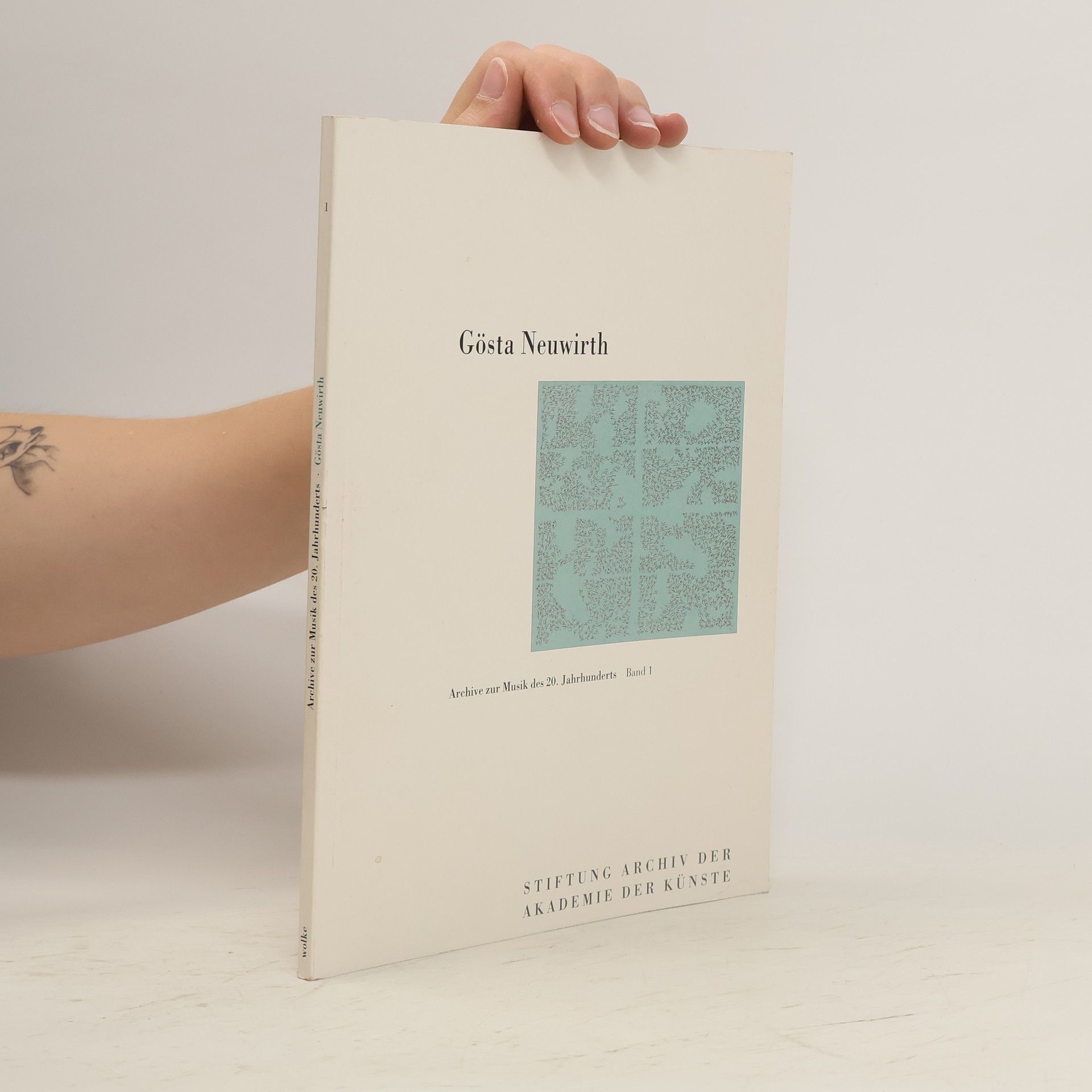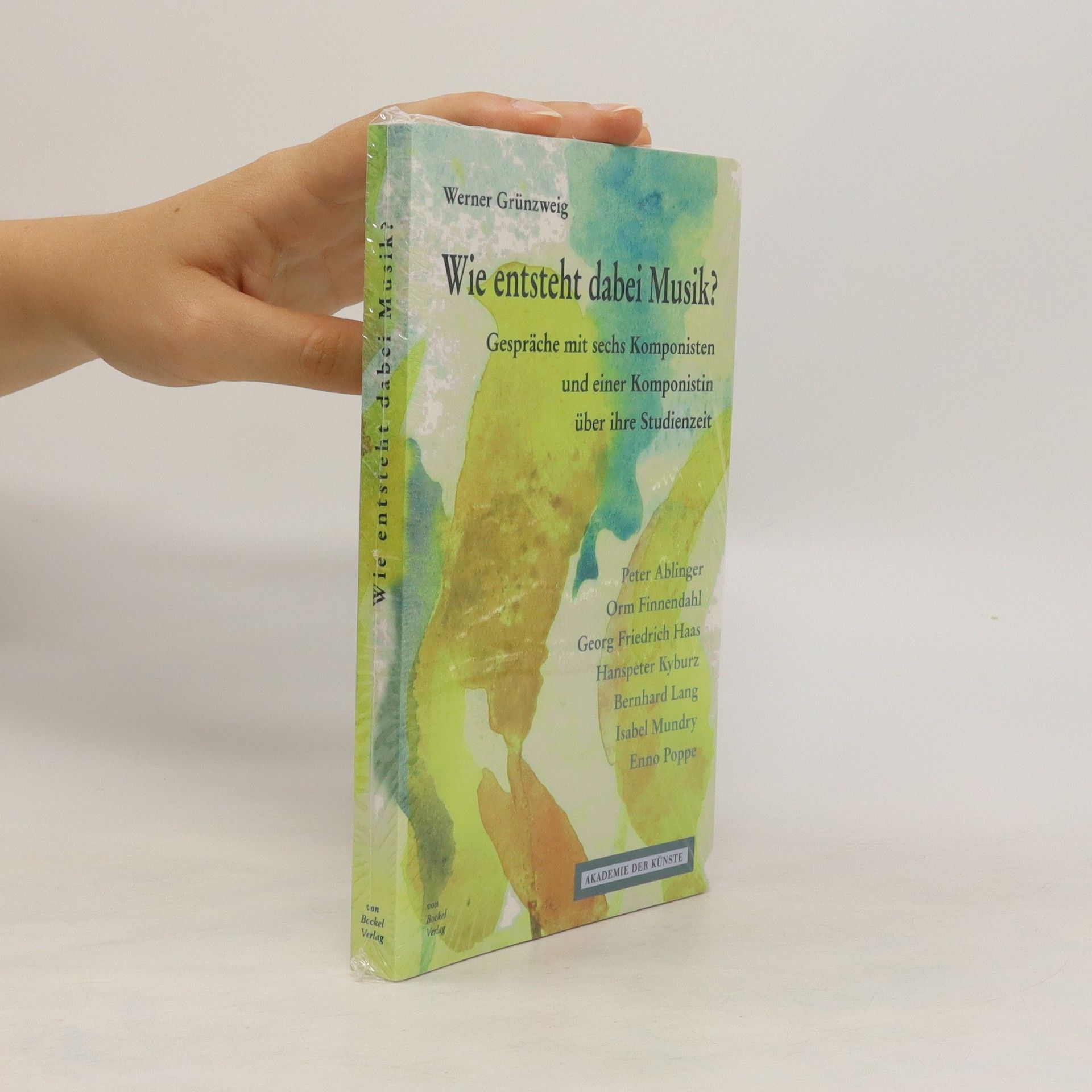Wie entsteht dabei Musik?
Gespräche mit sechs Komponisten und einer Komponistin über ihre Studienzeit
- 199 Seiten
- 7 Lesestunden
Der Band enthält sieben Interviews, die der Musikwissenschaftler Werner Grünzweig mit einer Komponistin und sechs Komponisten führte, die international anerkannt sind: Peter Ablinger, Orm Finnendahl, Georg Friedrich Haas, Hanspeter Kyburz, Bernhard Lang, Isabel Mundry und Enno Poppe. Diese Komponisten haben unterschiedliche Ausbildungswege durchlaufen, teilen jedoch eine entscheidende Gemeinsamkeit: Sie erhielten wesentliche Impulse von Gösta Neuwirth, einem einflussreichen Komponisten und Musikwissenschaftler, der von 1982 bis 2000 an der Hochschule der Künste Berlin lehrte. Obwohl er keine offizielle Kompositionsklasse leitete, war er für viele Studierende der ideale Ansprechpartner für ihre kompositorischen Arbeiten. Die Interviewten reflektieren, wie Neuwirths Ansatz ihr Musikdenken im Vergleich zu den offiziellen Lehrern beeinflusste. Georg Friedrich Haas, der an der Columbia University unterrichtet, beschreibt Neuwirth als einen der bedeutendsten Kompositionslehrer des letzten Viertels des 20. Jahrhunderts, warnt jedoch vor den heutigen Reglementierungen an Hochschulen. Diese Interviewsammlung dient somit nicht nur als Zeugnis der jüngeren Musikgeschichte und Würdigung Neuwirths, sondern auch als kritische Auseinandersetzung mit den Veränderungen der Studienbedingungen seit dem Bologna-Prozess.