Gerd Bender Bücher


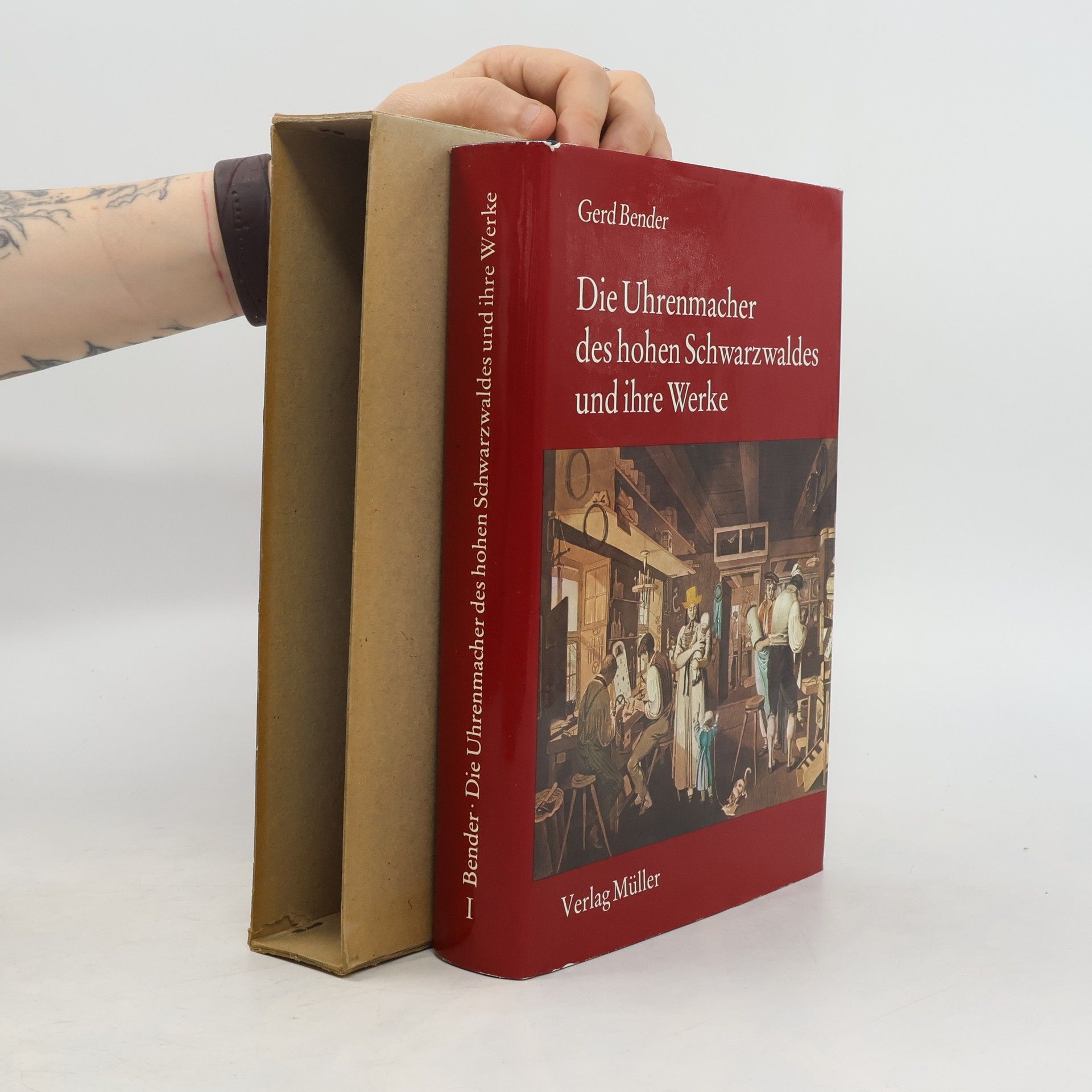
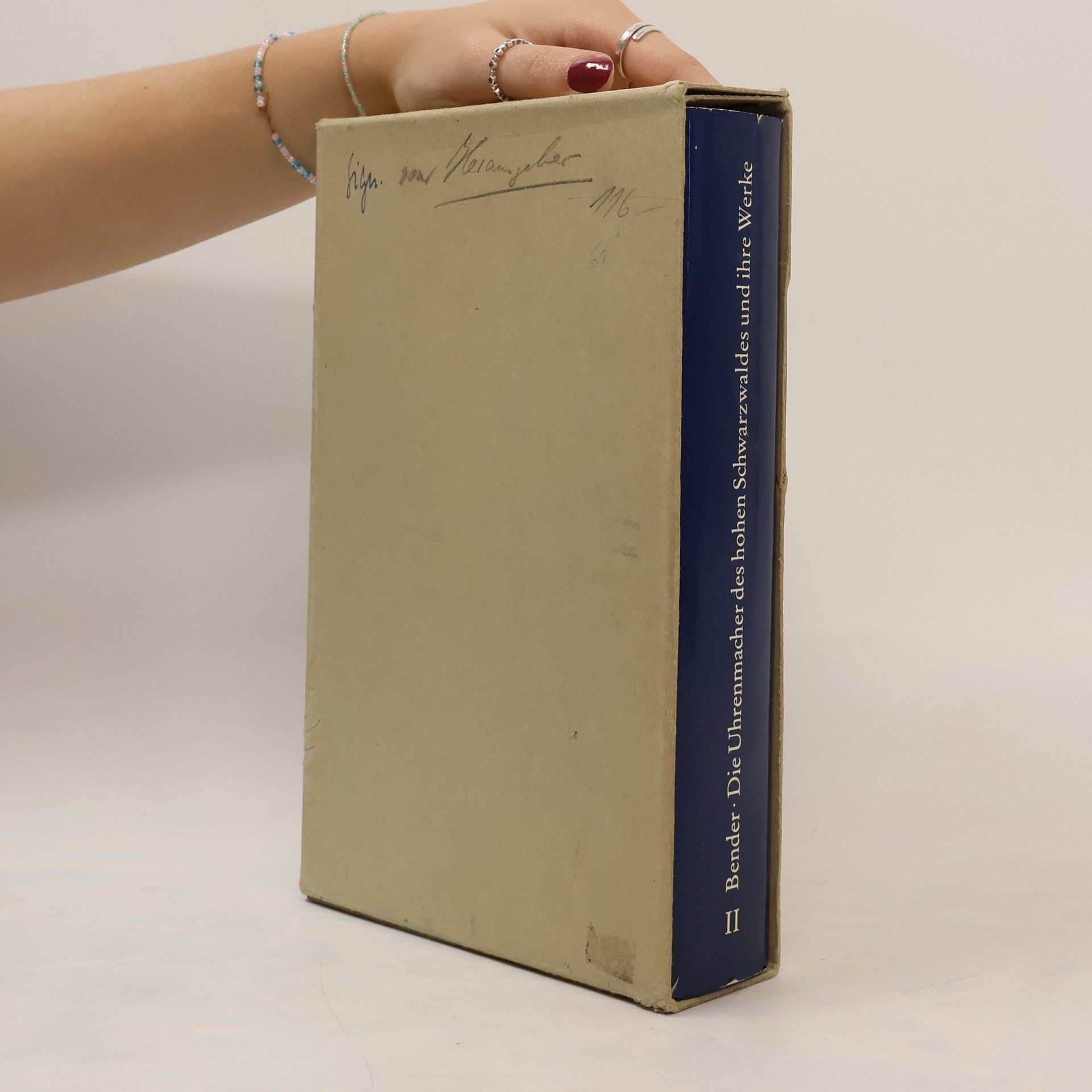
Gerd Bender, Rainer Maria Kiesow, Dieter Simon: Das Europa der Diktatur. Eine Vorbemerkung • Klaus von Beyme: Steuerung in kommunistischen Systemen • Karl Otto Hondrich: Kollektive moralische Gefühle – Instrument oder Widerstand für politische Steuerung? Kommentar Uwe Schimank • Pierangelo Schiera: Korporativismus im Faschismus – nur Element der Systemsteuerung oder notwendige pluralistische Komponente des italienischen Totalitarismus? Kommentar Joachim Rückert • Antonio Serrano González: Juristische Formen im Spanien Francos 81 • Christoph Boyer: Stabilisierung durch Wandel. Institutionenevolution im Staatssozialismus • Michael Hutter: Wirtschaftssteuerung durch diktatorische Regimes? • Günter Krause: Über Grundzüge rechtlicher Wirtschaftssteuerung in der DDR • Helmut Willke: Gesellschaftssteuerung und die Perversionen der Perfektabilität • Armel Le Divellec: Der verfehlte Steuerungsversuch der Weimarer Demokratie durch Recht. Kommentar Christoph Gusy • Dieter Gosewinkel: Wirtschaftspolitische Rechtsetzung im Nationalsozialismus. Kommentar Johannes Bähr
Gegenwartserzeugung durch Zukunftssimulation
- 237 Seiten
- 9 Lesestunden
Die grundlegende These dieser Arbeit lautet, daß mit Technologieentwicklung uno actu auch gesellschaftliche Verhältnisse erzeugt werden (können). Entwickelt wird diese These am Beispiel des Projekts der Spezifizierung des europäischen Mobilfunkstandards GSM. Neben techniksoziologischen Analysen wird herausgearbeitet, daß das GSM-Projekt eine Form ist, in der sich die europäische Integration vollzieht. Die soziologische Interpretation zielt darauf, die Untersuchung von Technologieentwicklung für das Verständnis der Funktionsmechanismen kapitalistischer Industriegesellschaften fruchtbar zu machen. Sie stellt auf Formen der Bearbeitung von Zeit bei der Produktion neuer Technologien ab, durch die sich das gesellschaftliche Verhältnis von 'Gegenwart' und 'Zukunft' verändert.