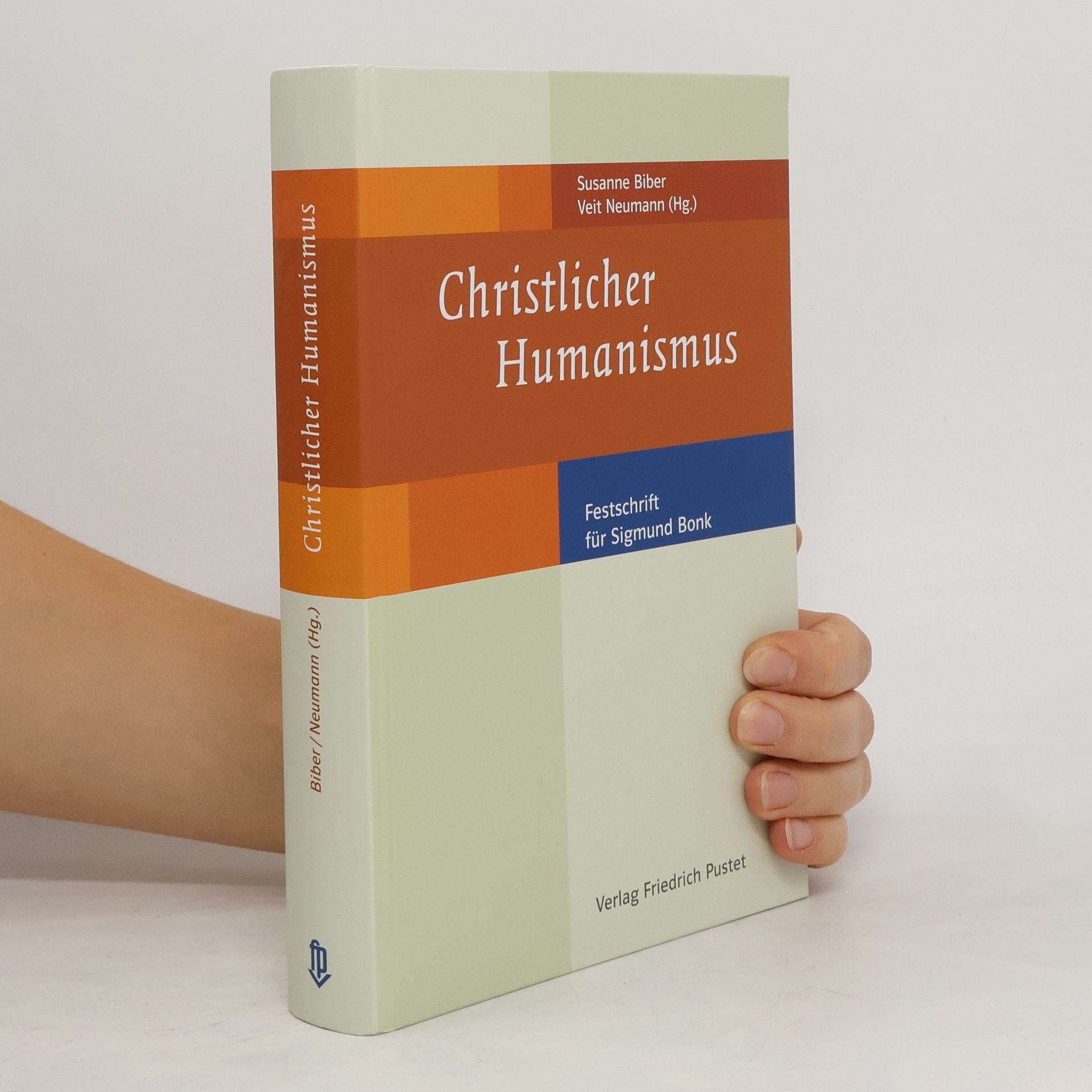Diotima, Sophia - und Maria
Platons Diotima und Jesus Sirachs Sophia als Verweise auf "Maria, Sitz der Weisheit"
- 64 Seiten
- 3 Lesestunden
Die Verbindung zwischen Diotima aus Platons Symposium und der personifizierten Weisheit Sophia bei Jesus Sirach wird als bedeutend für das Verständnis von Maria als Sitz der Weisheit hervorgehoben. Diese Analyse beleuchtet, wie diese beiden Figuren als präfigurative Darstellungen Marias betrachtet werden können und bietet somit einen neuen Blickwinkel auf den Ehrentitel, der in der heutigen Zeit besondere Relevanz hat.