Nichts ist so unstet wie Männlichkeit. Die Geschichte der letzten 500 Jahre ist voll von "Neuen Männern". Die europäische Renaissance definierte den Mann neu und nannte ihn "Neuer Adam". Die französischen Revolutionäre schrieben 1789 die "Regeneration des Mannes" auf ihre Fahnen und schufen ihren "Neuen Mann", den "Homme regenere", den sie als Modell erfolgreich exportierten. In den Revolten von 1968 wurden in Nordamerika und Europa die Grundlagen für den nächsten "Neuen Mann" der Geschichte gelegt. Ob "Neuer Adam" oder "Regenerierter" bzw. "Neuer Mann" - diese Bezeichnungen markieren jeweils den Beginn umfassender sozial-kultureller Neukonstruktionen von Männlichkeit. Das Buch bietet auf der Grundlage jahrelanger Forschungen erstmals eine umfassende kulturwissenschaftlich angelegte Geschichte der Männlichkeiten im neuzeitlichen Europa, die Männergeschichte, Geschlechtergeschichte und allgemeine Geschichte ausgehend von Männerautobiographien und Bildmedien glanzvoll miteinander verbindet.
Wolfgang Schmale Bücher



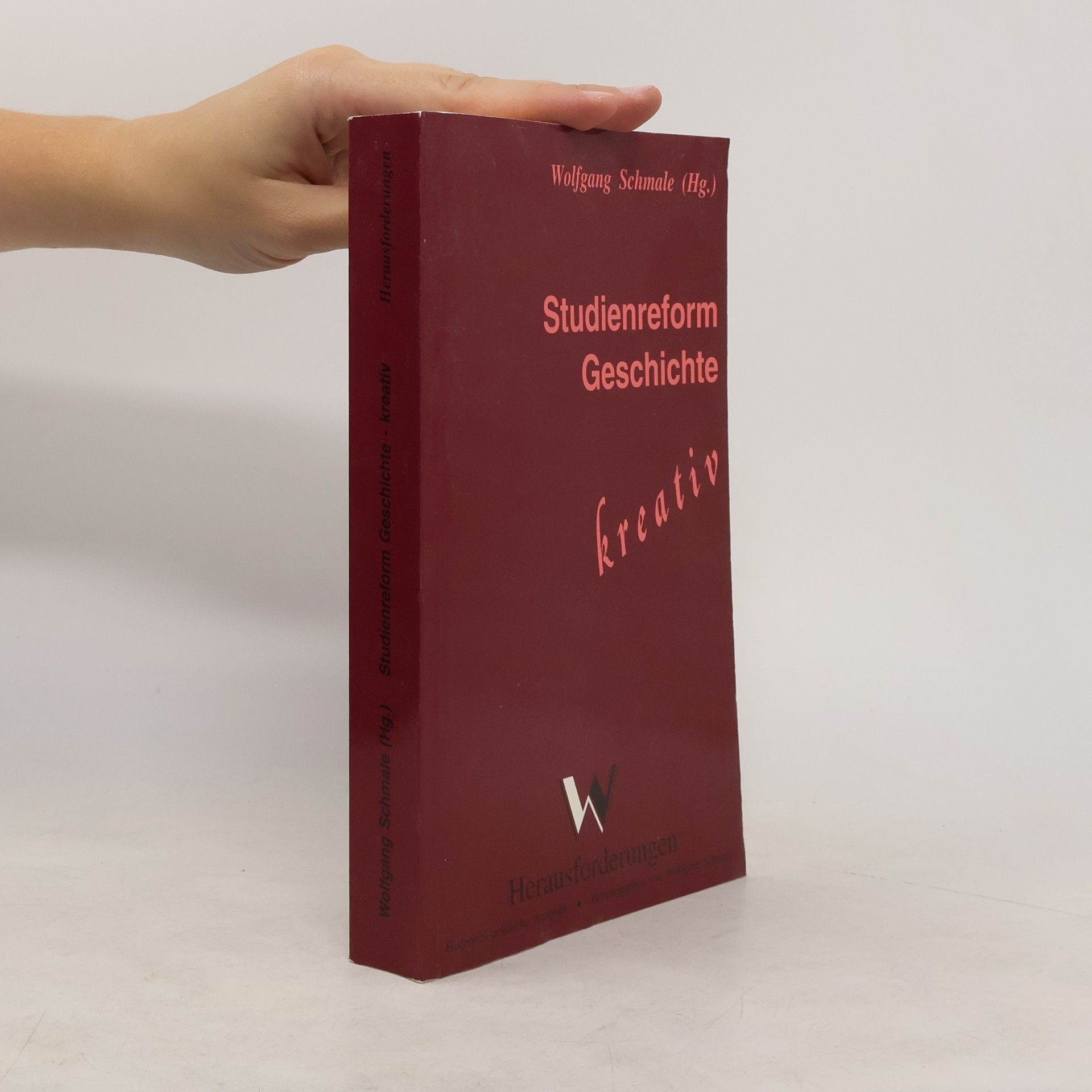
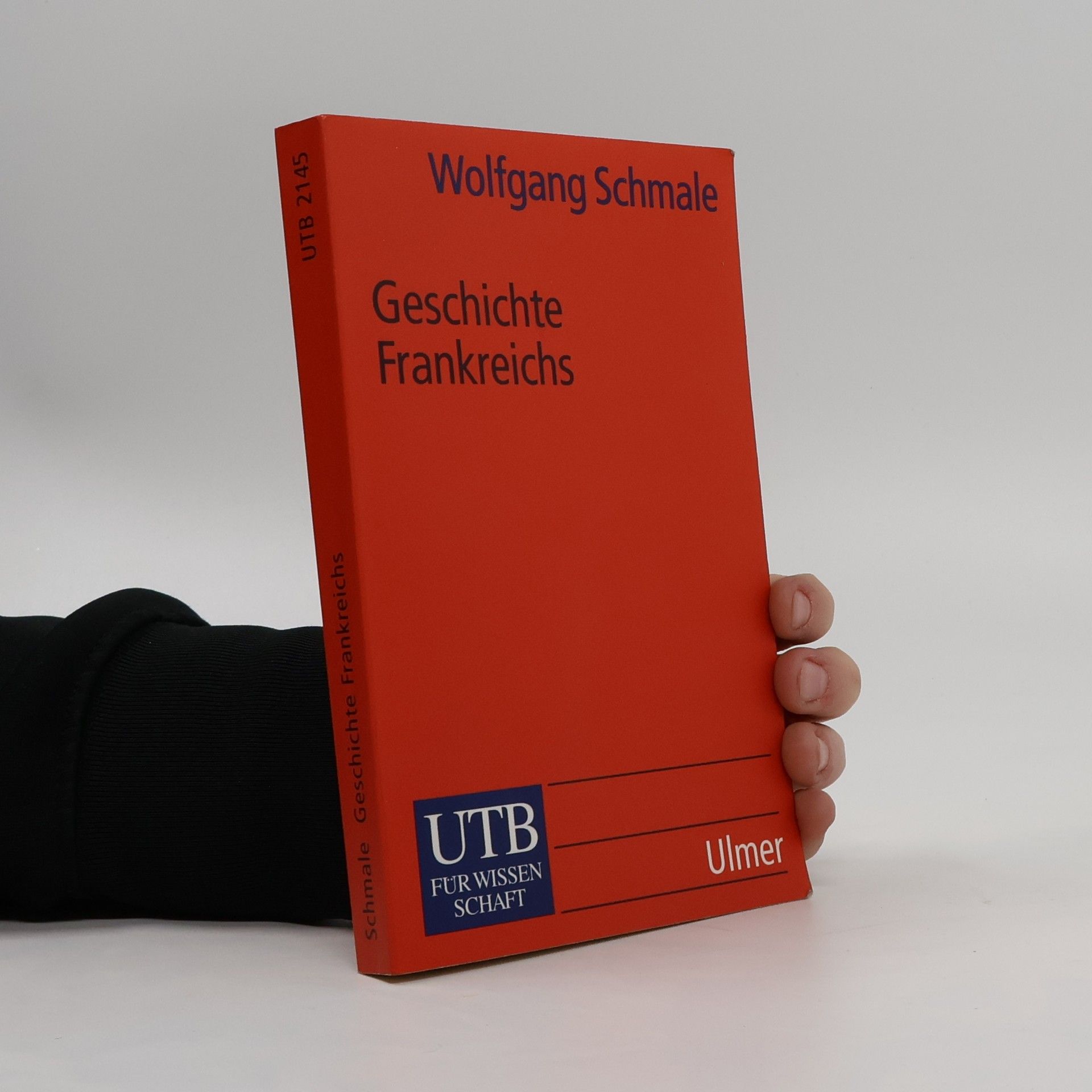
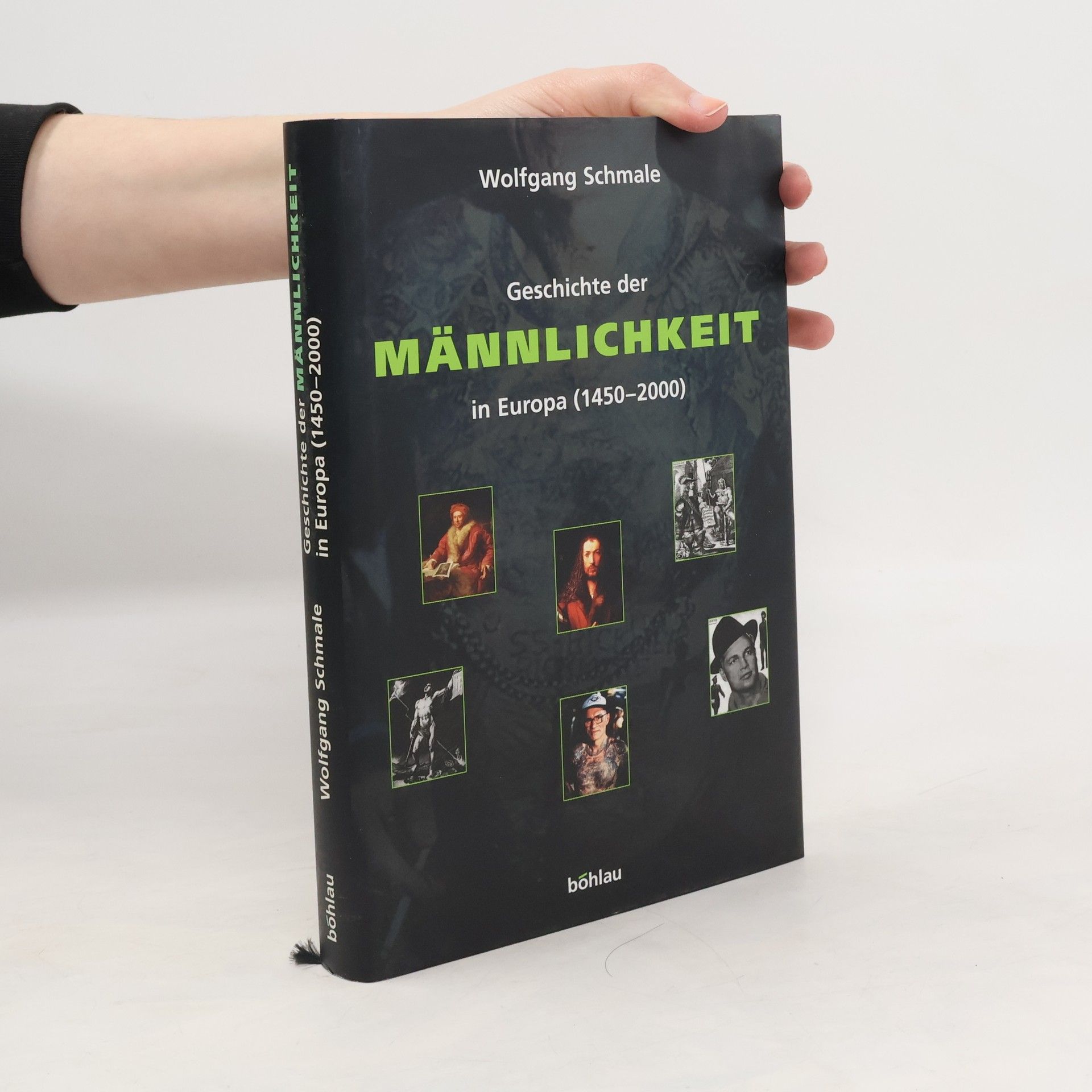
Geschichte Frankreichs
- 432 Seiten
- 16 Lesestunden
Dieses Studienbuch bietet eine kompakte und zuverlässige Darstellung der Geschichte Frankreichs von Vercingetorix bis Jacques Chirac. Die chronologisch geordneten Kapitel enthalten wichtige Ereignisse und Personen mit Lebensdaten im Text.
Studienreform Geschichte
- 414 Seiten
- 15 Lesestunden
Gesellschaftliche Orientierung
Geschichte der "Aufklärung" in der globalen Neuzeit (19. bis 21. Jahrhundert)
- 379 Seiten
- 14 Lesestunden
Die Relevanz der Aufklärung des 18. Jahrhunderts zeigt sich auch im 21. Jahrhundert als wichtige gesellschaftliche Orientierung in Krisenzeiten. Wolfgang Schmale untersucht diesen historischen Prozess seit dem frühen 19. Jahrhundert und beleuchtet die Beiträge von Intellektuellen wie Hegel, Foucault und J. I. Israel. Durch den Einsatz digitaler Methoden analysiert er die Aufklärung aus einer globalgeschichtlichen Perspektive und argumentiert, dass sie als zukunftsfähige Lebenswissenschaft auch fundamentaler Kritik standhält.
#ImmanuelKant
Kosmopolit digital im postkolonialen Zeitalter
Immanuel Kant gehört zu den bekanntesten Philosophen der Aufklärung. Das Buch zeichnet erstmals ein Porträt des „digitalen Kant“ in Europa, Asien, Afrika und Amerika. Denn wer im Digitalzeitalter etwas über historische Persönlichkeiten erfahren möchte, startet eine Websuche, liest den Wikipedia-Artikel, sucht ein YouTube-Video …. Längst besitzen historische Persönlichkeiten eine digitale Identität und die meisten, die sich z.B. für Immanuel Kant interessieren, kommen zuerst mit dieser digitalen Identität in Kontakt. Der digitale Kant etwa trägt dazu bei, dass die Aufklärung global so populär wie nie zuvor ist. Mit seiner Untersuchung hat Wolfgang Schmale Neuland betreten und erstaunliche Ergebnisse zutage gefördert.
Das Digitalzeitalter ist weder disruptiv noch revolutionar, sondern setzt die Logik und die Grundkonflikte der Moderne seit dem 18. Jahrhundert und der Aufklarung fort. Zugleich werden sie mehr als je zuvor in globalem Ausmass in jeden Haushalt und die alltagliche Lebenswelt der Menschen transferiert. Wolfgang Schmale kontextualisiert das Digitalzeitalter in der Moderne mit ihren guten, schlechten und widerspruchlichen Seiten. Das Konzept des digitalen Human(itar)ismus verschafft in dieser Konstellation Orientierung. Die Chance, die globale Digitalitat, die das Digitalzeitalter auszeichnet, fur eine humanere Gesellschaft und fur die Herstellung von Dekolonialitat zu nutzen, ist noch nicht endgultig vertan. Schmale begibt sich mit der historisch-kritischen Analyse des Digitalzeitalters auf schwieriges Gelande und zeigt, wie die durch KI vorangetriebene Digitalisierung der Lebenswelt in einen kontrollierten Prozess umgewandelt werden kann, bei dem die Menschenwurde den wichtigsten Massstab darstellt.
Der "Schreib-Guide Geschichte", der für den Einsatz in Lehrveranstaltungen und für das Selbststudium konzipiert ist, denkt das Erlernen von Geschichte, also das Geschichtsstudium, vom Schreiben der Geschichte her. Der Schreibführer trainiert die Fähigkeit, die zu erlernenden allgemeinen wissenschaftlichen sowie genuin geschichtswissenschaftlichen Methoden in gutes wissenschaftliches Schreiben umzusetzen. Es geht dabei nicht nur um das Schreiben, sondern auch um das gute Vortragen und Präsentieren wissenschaftlich gewonnener Ergebnisse. Die systematische Strukturierung des Stoffes und seine Fokussierung auf das Schreiben und die möglichen Endprodukte wie Seminararbeit, Rezensionen und andere wissenschaftliche Formate machen den Schreib-Guide zum unverzichtbaren Begleiter durch das Studium.
Was wird aus der Europäischen Union?
- 165 Seiten
- 6 Lesestunden
Europa scheint bis zum Hals in Problemen zu stecken. Angesichts von Brexit und Finanzkrise hier, Populismus und Europamüdigkeit dort scheint es nur noch die Wahl zwischen Streit und Stillstand zu geben. Doch woher kommen all die Schwierigkeiten? Oder geht es Europa vielleicht doch gar nicht so schlecht? Mit dem Blick des Historikers und der Haltung eines überzeugten Europäers erkundet Wolfgang Schmale die Wurzeln der genannten Phänomene und macht sich über das Verhältnis von Nation und Europa Gedanken. Vor allem aber zeigt er auf, wie die Europäische Union doch noch den Weg in die Zukunft finden kann.


