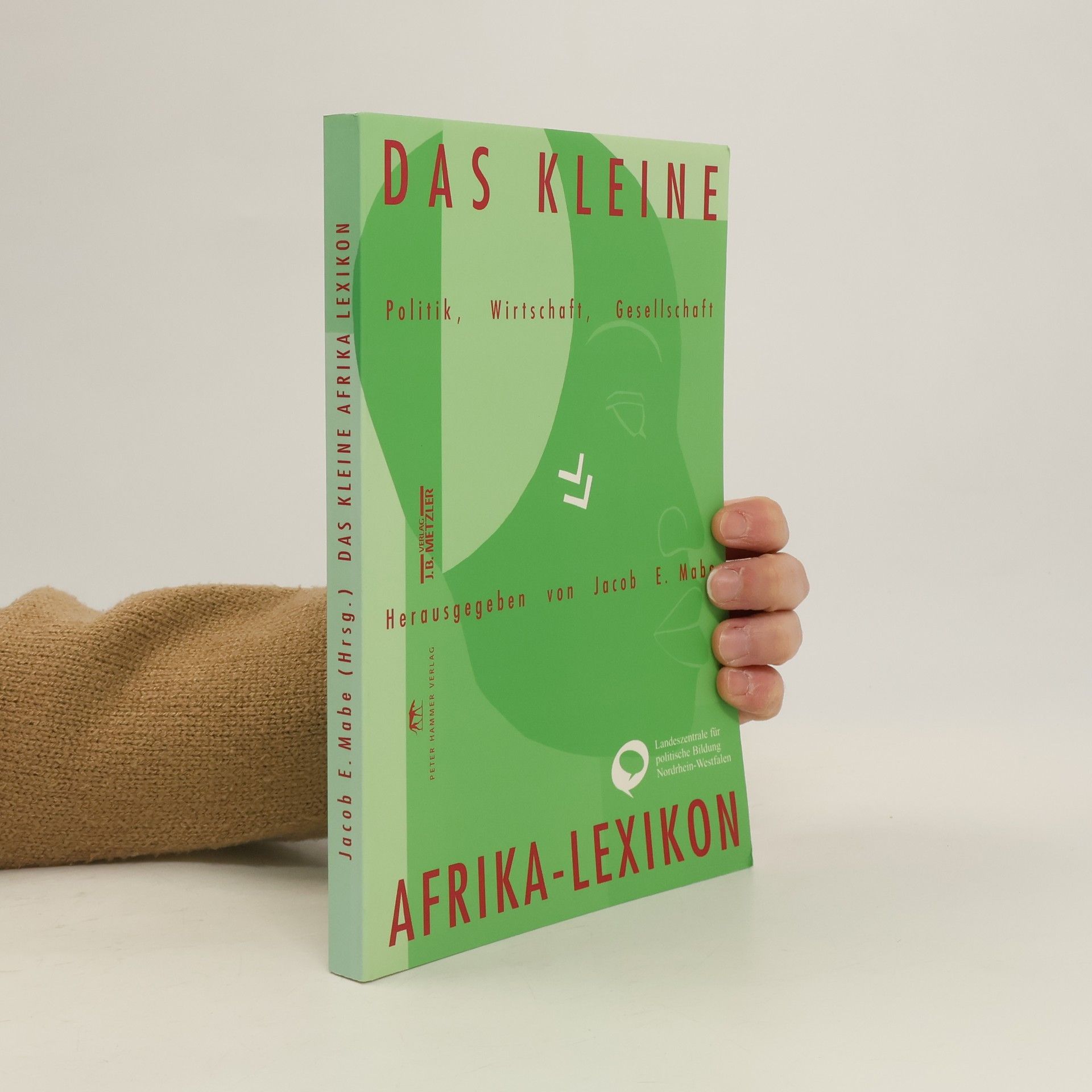Das Afrika-Lexikon
- 719 Seiten
- 26 Lesestunden
Das vorliegende Werk ist die erste umfassende Informationsquelle über den afrikanischen Kontinent in Europa. Fachwissenschaftler informieren über Geografie und Geschichte, Politik und Wirtschaft, Länder, Gesellschaften und Kulturen, Sprachen und Literaturen, Kunst und Musik, Religionen und Philosophie. Ein unentbehrliches Nachschlagewerk.