Siegfried Behrendt Bücher
1. Jänner 1960
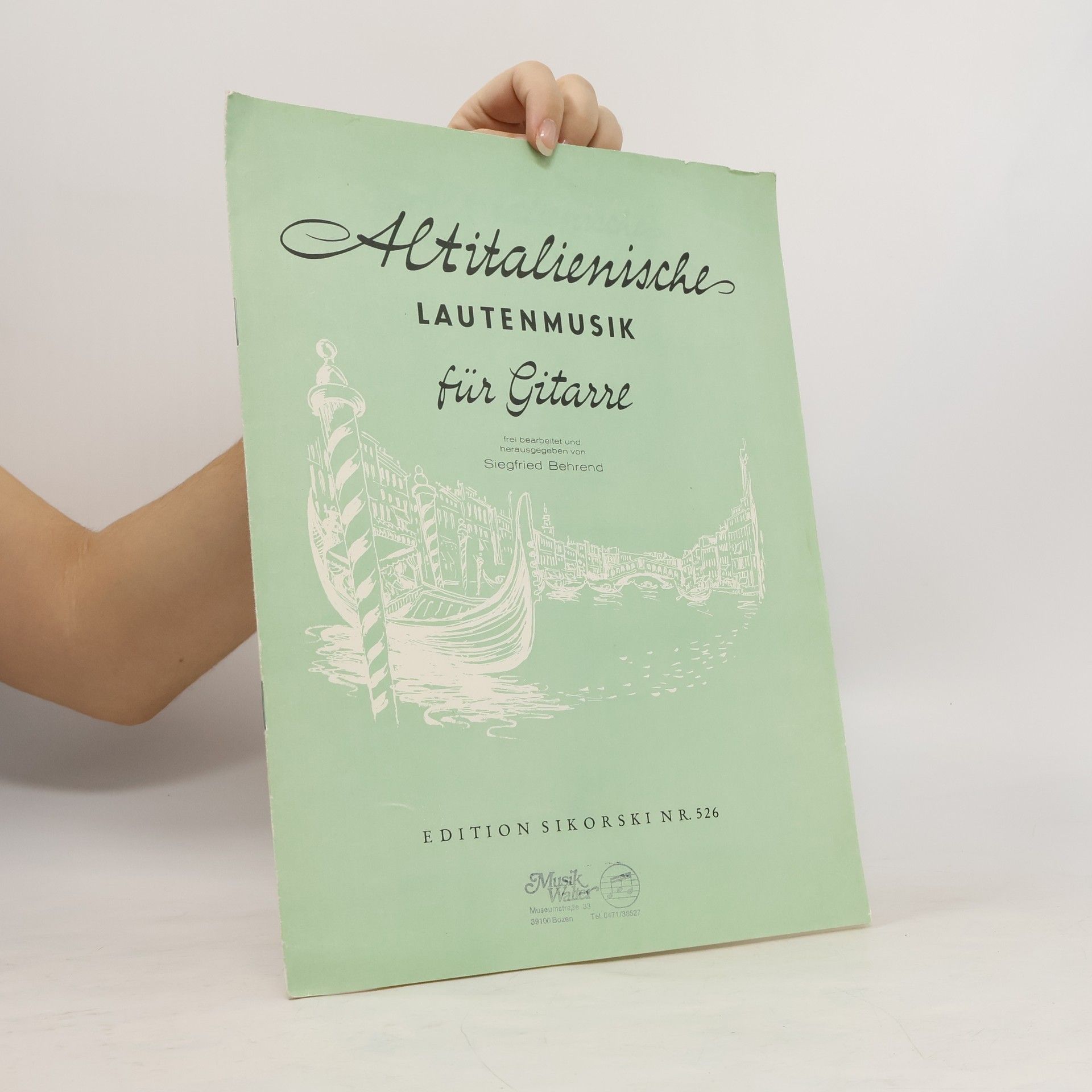



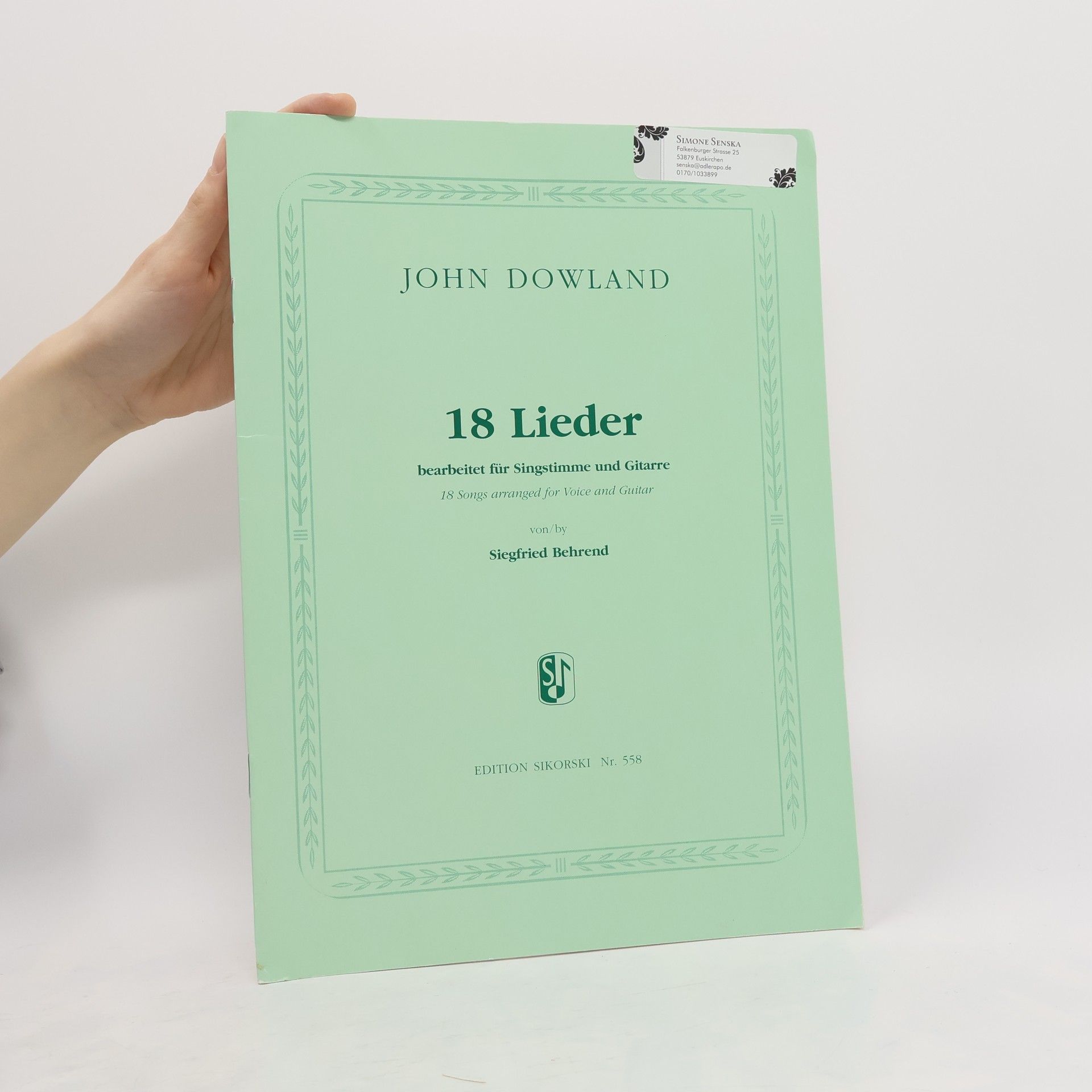
Impressionen einer Spanischen Reise
Suite espagnola Nr. 1
Neue Ökologie - 3: Auf dem Weg zu einer Green Economy
Wie die sozialökologische Transformation gelingen kann
- 302 Seiten
- 11 Lesestunden
Green economy is the future ? this volume illuminates options, challenges and factors of success, providing perspectives for politics and the economy.