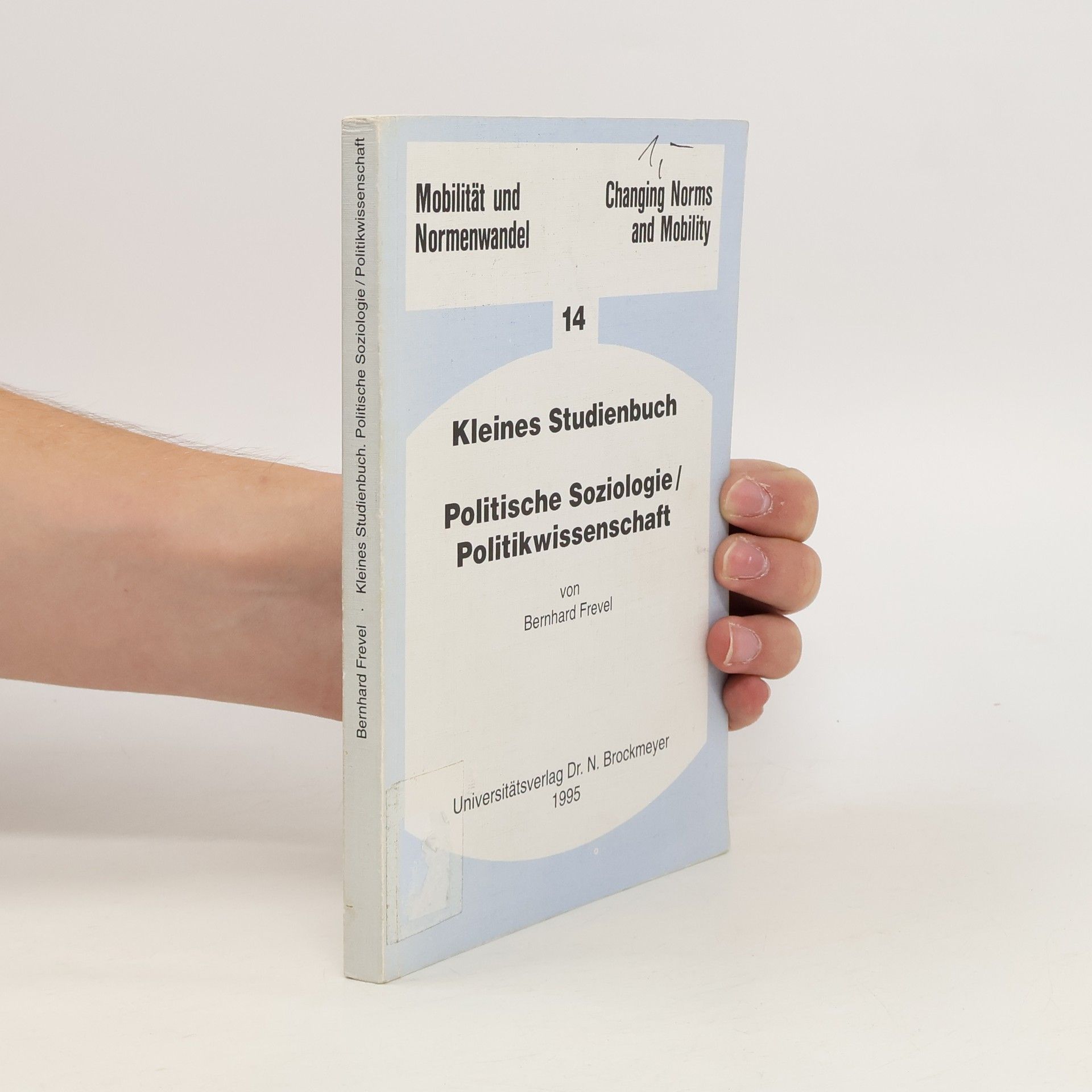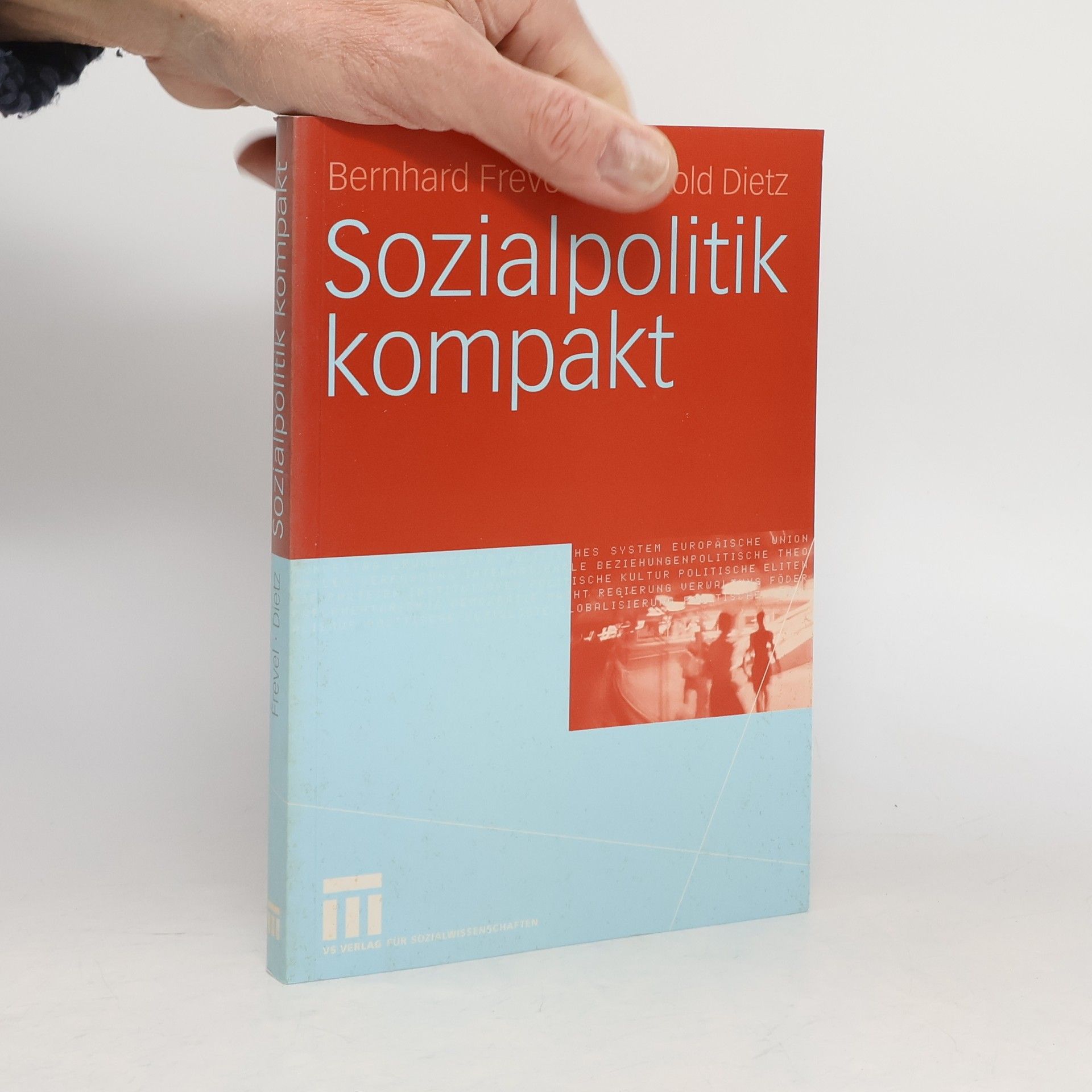Wer kontrolliert die Polizei?
Juristische und sozialwissenschaftliche Analysen von Strukturen und Kompetenzen
Nach einem tödlichen Polizeieinsatz in Dortmund wird wieder diskutiert, wer die Polizei nach solchen Vorfällen kontrolliert? Vorschläge dafür liegen auf dem Tisch, aber gibt es den politischen Willen für Veränderungen bei der Polizei in NRW? Das diskutiert Christoph Ullrich mit Benjamin Sartory und Tobias Zacher. Von Christoph Ullrich.