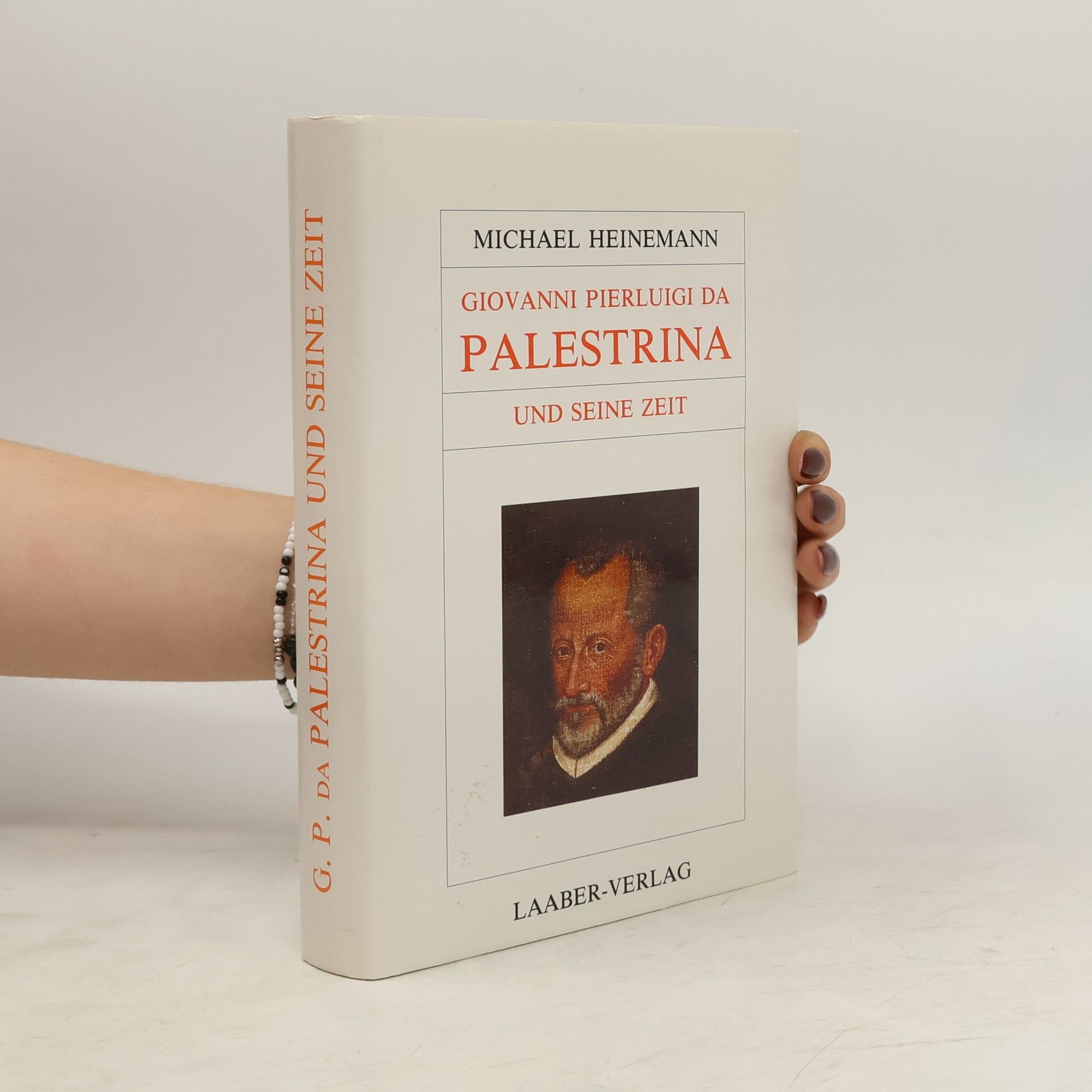Die erstaunliche Geschichte eines Musikers aus Halle an der Saale, der zum englischen Nationalkomponisten aufstieg Die Liebe Georg Friedrich Händels (1685 - 1759) gehörte der Oper, bevor er zum populären Klassiker des Oratoriums wurde. In beiden Gattungen blieb er einem Stil treu, den er in Italien gelernt hatte und nach 1712 in England nicht mehr prinzipiell veränderte. Die große Geste des Musiktheaters prägte auch sein Leben: Sein Auftreten war grandios, sein Scheitern nicht minder.
Michael Heinemann Bücher
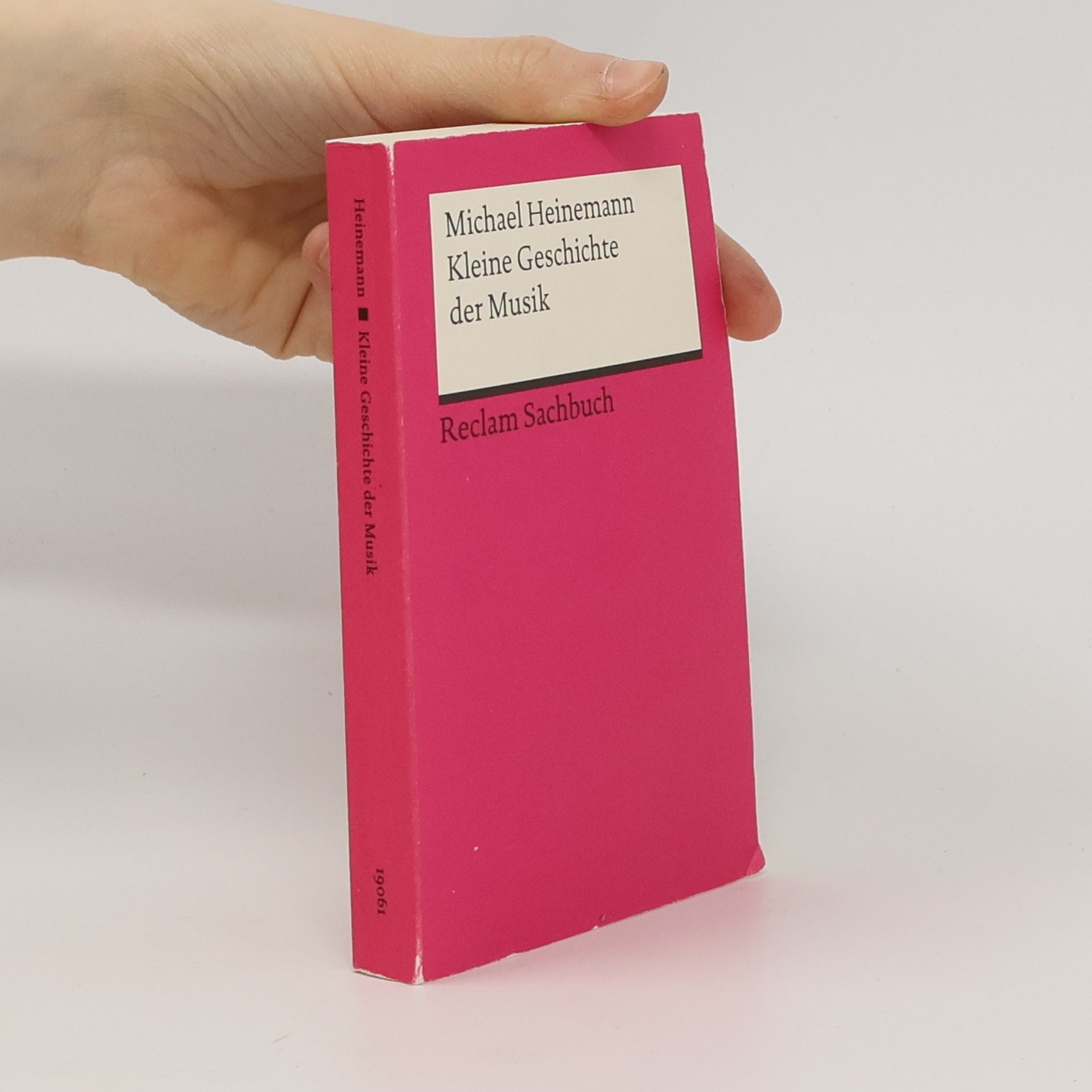




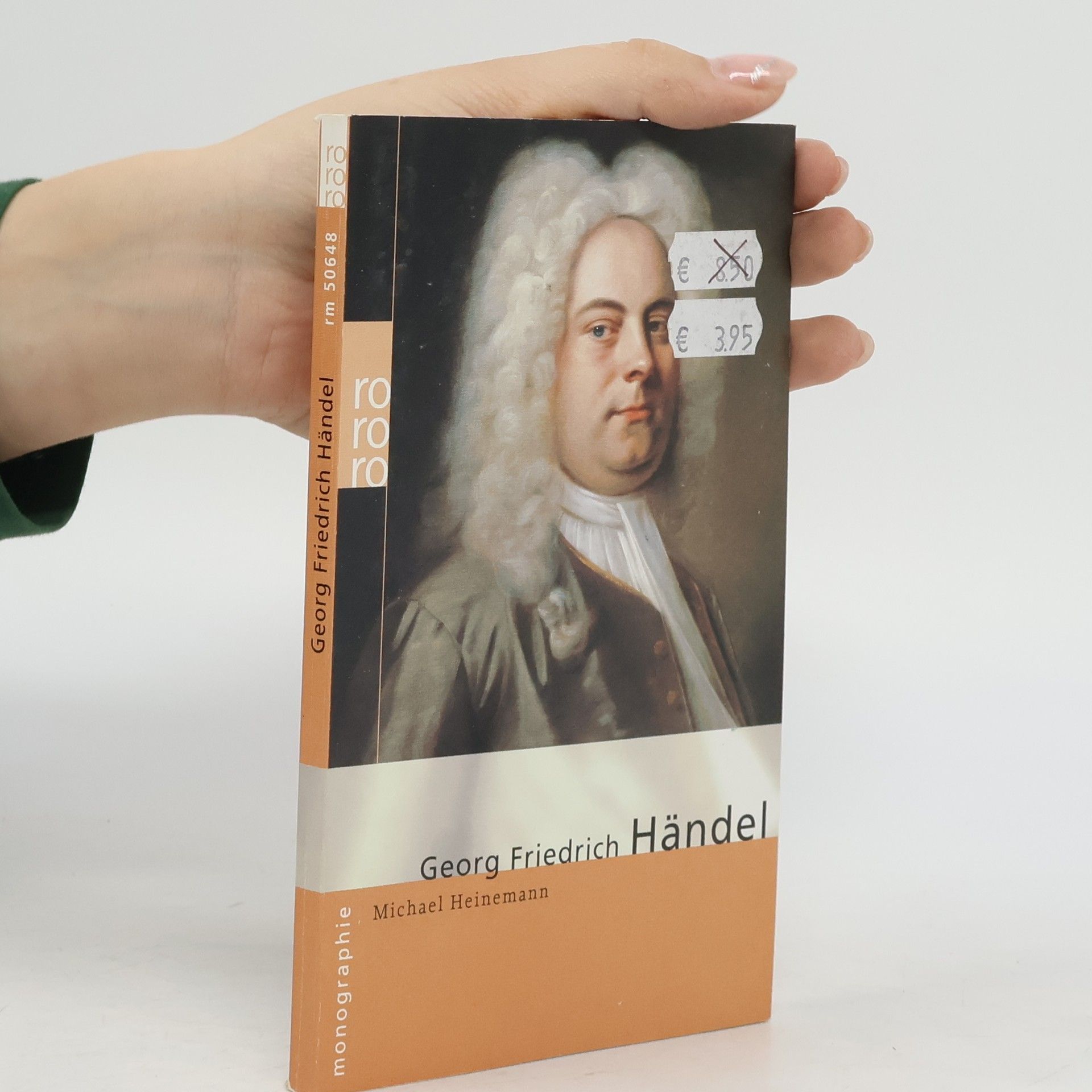
Die Auseinandersetzung mit Beethovens Musik geht über das bloße Hören hinaus und beleuchtet die verschiedenen Dimensionen des Hörens als sinnliche Erfahrung. Trotz seiner Taubheit suchte Beethoven nach neuen Klängen und entwickelte innovative Spieltechniken, was ihn zu einem Pionier in der Musik machte. Das Buch zeigt, wie er verschiedene Wahrnehmungsmodi explizit machte und bietet tiefere Einblicke in die emotionale und intuitive Dimension seiner Werke. Es liefert zudem wertvolle Ansätze zur Beantwortung zentraler Fragen in der Beethoven-Diskussion.
Heinrich Schütz (1585-1672), oft als «Vater der deutschen Musik» bezeichnet, gilt als genuin protestantischer Komponist und Inbegriff eines Kirchenmusikers. Doch war er Hofkapellmeister, nicht etwa Kantor; und auch wenn vorwiegend geistliche Werke von ihm gedruckt überliefert sind, so geben doch die Nachrichten von musikdramatischen Produktionen, an denen er mitwirkte, den Blick frei auf einen Künstler, dessen überragende Bedeutung als Mittler zweier musikalischer Kulturen, italienischer Neuerungen und deutscher Traditionen, erst in jüngster Zeit erkannt sind.
Claudio Monteverdi
Die Entdeckung der Leidenschaft
Monteverdi war der erste, der dem Menschen ermöglichte, von sich selbst zu singen. Verlassene Frauen und verunsicherte Helden können nun ihre Gefühle auf die Bühne bringen. Sehnsüchte und Leidenschaft nehmen Gestalt an: in einer natürlichen Sprache der Musik. Jenseits der Vorgaben von Stil und Konvention entdecken Individuen die Möglichkeit, ihre Affekte auszudrücken. Subjektiv. Ungebunden. Radikal in der Konzeption neuer Klänge. Auch in der Kritik der Tradition. So eröffnet Musik Alternativen. Töne berühren den Körper. Ihre Kombination ist nicht mehr bloß geistige Übung für Gelehrte. Sinnlichkeit ersetzt das Kalkül der Vernunft. Erfordert Mut auch auf Seiten der Interpreten: Kraft und Lust, sich Dissonanzen auszusetzen, die doch immer wieder zurückfinden. Zur Harmonie des Himmels, zum Einklang des liebenden Paares. Michael Heinemanns Buch nähert sich Monteverdis Musik aus der Perspektive des Hörens. Aus der Verbindung der Erfahrungen aus Kulturgeschichte und der musikalischen Praxis entsteht so ein Bild dieser Zeitenwende in der Musik.
Kleine Geschichte der Musik
Heinemann, Michael – Klassiker der Musikgeschichte mit Erläuterungen – 3. durchges. und aktual.
Die Entwicklung der Musik ist untrennbar mit allgemeinen geschichtlichen Entwicklungen verbunden. Kompositionstechnische, ästhetische und sozialgeschichtliche Begriffe helfen, den Reichtum musikalischer Werke in Geschichte und Gegenwart zu strukturieren und zu begreifen. Gleichzeitig erläutert dieser Band, der hier in einer überarbeiteten, aktualisierten Version in der Reclam Sachbuchreihe erscheint, die Grundzüge einer allgemeinen Musiklehre, so dass er auch als Einführung und Einstiegshilfe in die Musik generell dienen kann.