Fachsprachen
- 327 Seiten
- 12 Lesestunden

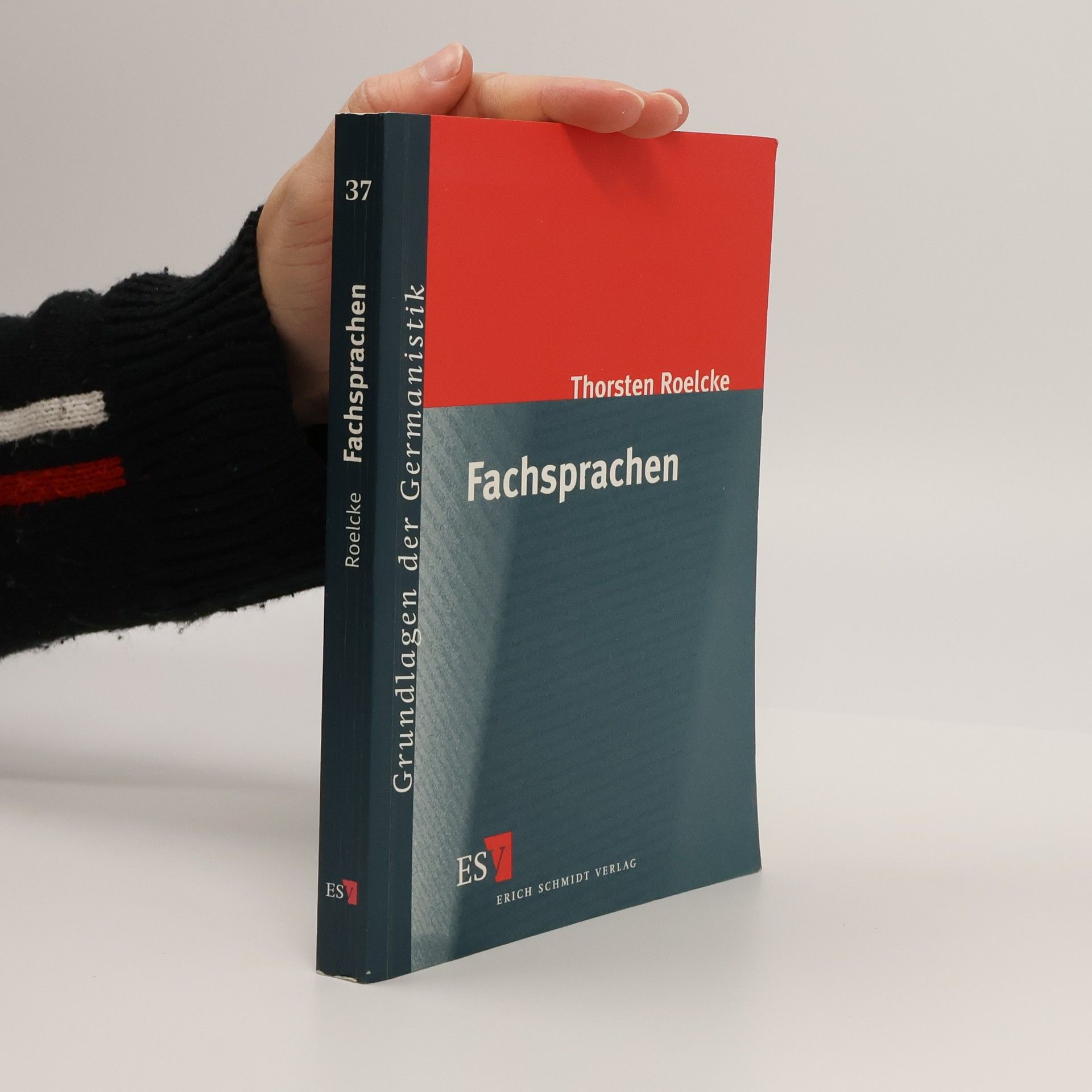



Studien und Dokumentationen zur deutschen Sprachreflexion in Barock und Aufklärung
Wie denken deutsche Sprachgelehrte im 17. und 18. Jh. über das Lateinische als internationaler Lingua franca der Wissenschaft und über die beiden anderen alten Bildungssprachen Griechisch und Hebräisch? In dem vorliegenden Werk wird die zeitgenössische Diskussion über Genealogie und Typologie der drei Sprachen, deren Merkmale und ihre Bewertung, Entlehnung und Purismus sowie Gebrauch und Didaktik von Fremdsprachen aufgearbeitet. Diese Aufarbeitung erfolgt zum einen anhand einer ausführlichen Dokumentation zahlreicher Quellen und Belege und zum anderen mittels einer textnahen Interpretation, welche einen Anschluss der Ergebnisse an weitere Befunde und Fragen der deutschen Sprach- und Kulturgeschichte erlaubt. Auf diese Weise wird eine wichtige Lücke der Germanistik geschlossen und gleichzeitig eine Grundlage für weitere Forschungen geschaffen.
Analysen und Tabellen
Die Reihe Studia Linguistica Germanica (SLG), 1968 von Ludwig Erich Schmitt und Stefan Sonderegger begründet, ist ein renommiertes Publikationsorgan der germanistischen Linguistik. Die Reihe verfolgt das Ziel, mit dem Schwerpunkt auf sprach- und wissenschaftshistorischen Fragestellungen die gesamte Bandbreite des Faches zu repräsentieren. Dazu zählen u. a. Arbeiten zur historischen Grammatik und Semantik des Deutschen, zum Verhältnis von Sprache und Kultur, zur Geschichte der Sprachtheorie, zur Dialektologie, Lexikologie/Lexikographie, Textlinguistik und zur Einbettung des Deutschen in den europäischen Sprachkontext.
German
Thorsten Roelcke geht es in diesem Buch um die geschichtliche Entwicklung der deutschen Sprache - und um die Frage, warum das Deutsche heute so ist, wie es eben ist. Dabei steht die Entwicklung des sprachlichen Systems im Deutschen selbst im Vordergrund und wird auf ihren sozialen und kulturellen Bedingungen hin betrachtet. Es werden die verschiedenen Ebenen der sprachlichen Entwicklung verfolgt, wie die von Laut und Schrift, Grammatik, Wortschatz oder Mundart und Standardsprache.