Franz Josef Holznagel Bücher
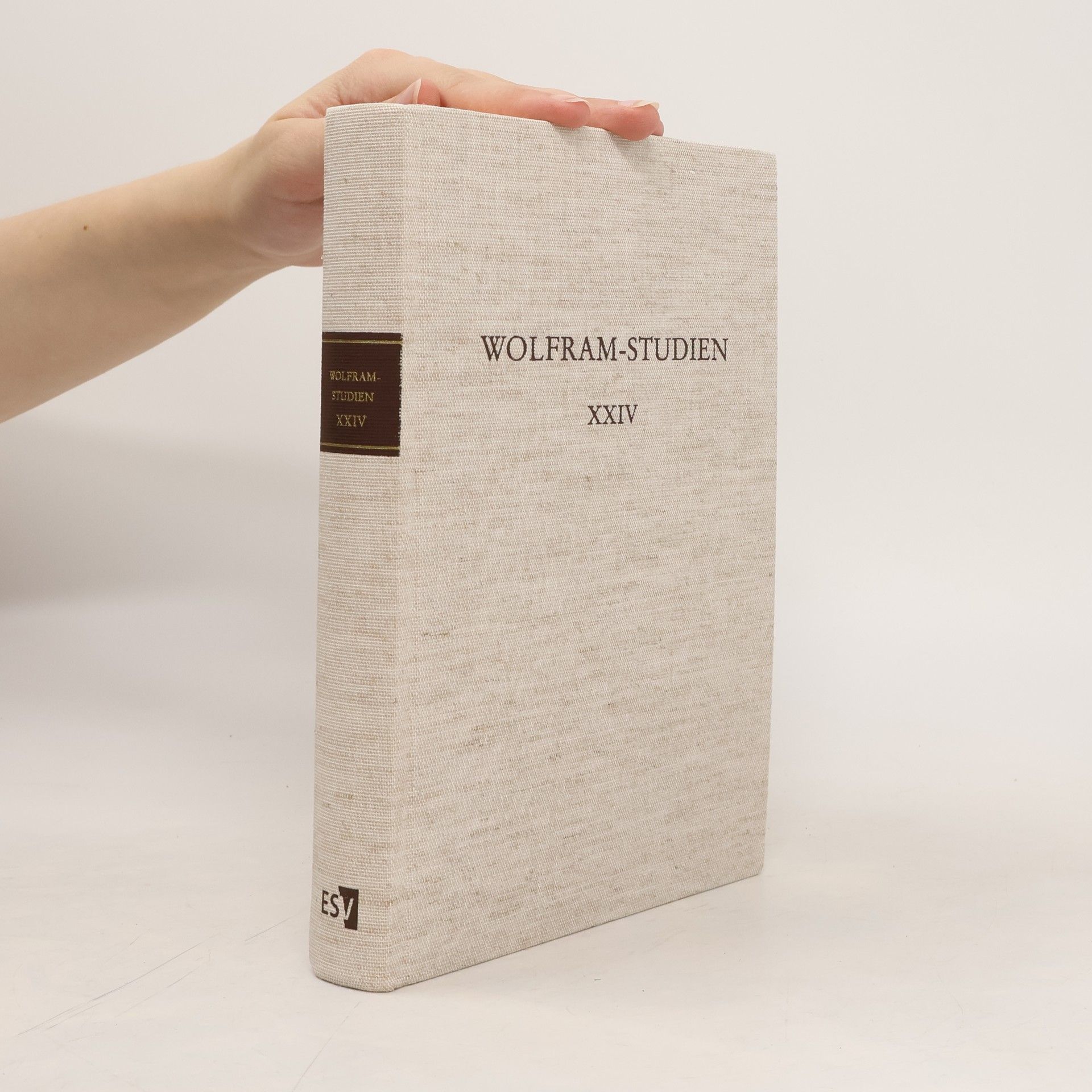

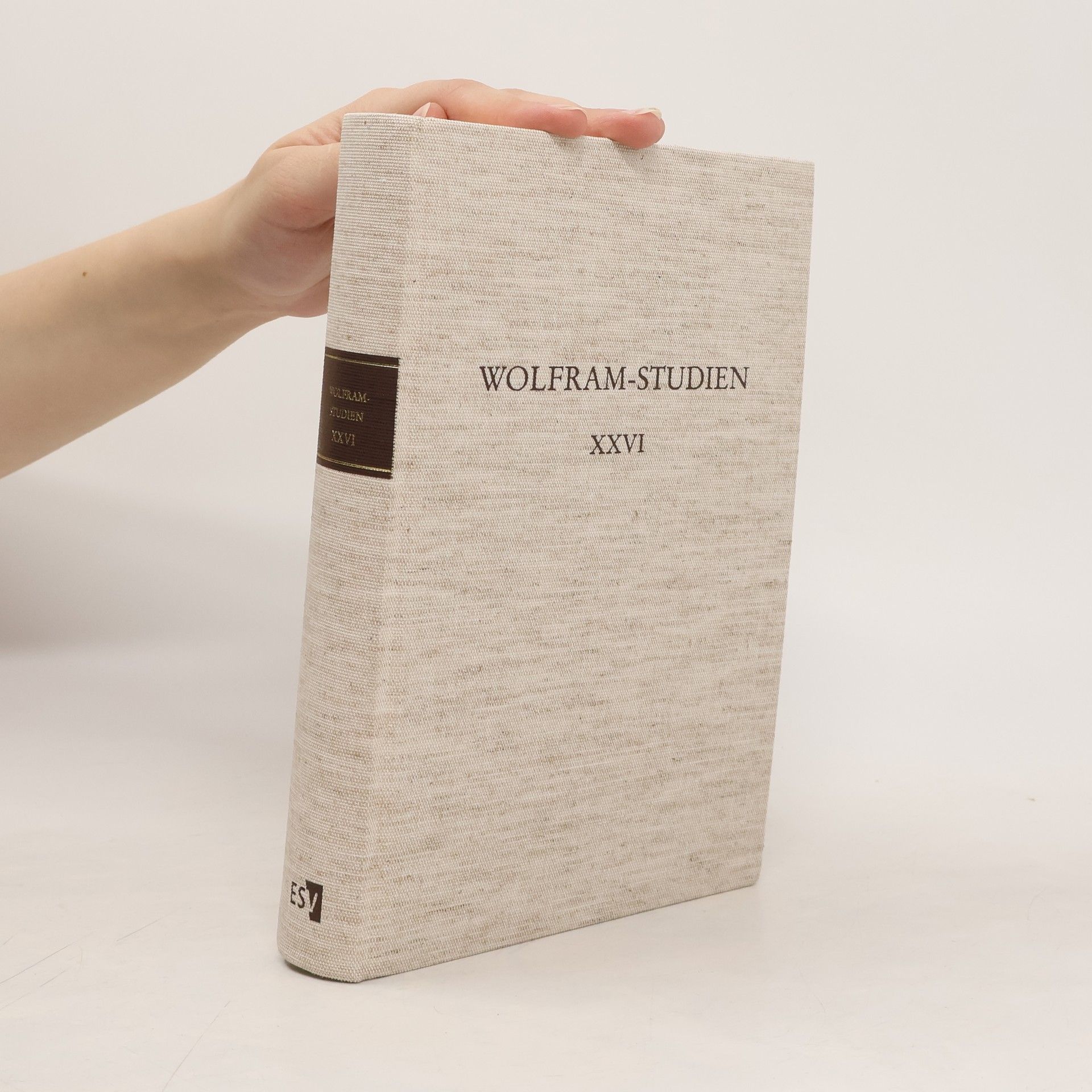
Wolfram-Studien XXVII
Literatur im mittelniederdeutschen Sprachraum (1200–1600) - - Produktion und Rezeption - - Rostocker Kolloquium 2021
Band XXVII der Wolfram-Studien zur Literatur im mittelniederdeutschen Sprachraum zwischen 1200 und 1600 versammelt die Ergebnisse des Rostocker Kolloquiums von 2021. Die Beiträge widmen sich u. a. der Textkultur der mittelalterlichen Hansestadt am Beispiel Rostocks, den medialen Transferprozessen im ersten niederdeutschen Gesangbuch sowie dem Erzählen in Versen in mittelniederdeutschen Mären und Fabeln. Weitere Beiträge hinterfragen z. B. Paradigmen der niederdeutschen Literaturgeschichtsschreibung: „wie hansisch war die Literatur im Norden?“ und setzen sich mit Minnesängern und Minnesangüberlieferung im niederdeutschen Raum auseinander. Schließlich geht es u. a. auch um den „Wolfenbütteler Äsop“ Gerhards von Minden, um die Sicherung des Seelenheils in mitteldeutscher geistlicher Literatur und um die soziale Funktion der Sprache in Dietrich Koldes „Kerstenen Spieghel“.
Das deutschsprachige Mittelalter hat von den Anfängen bis zum 16. Jahrhundert eine Vielzahl kleiner Dichtungen hervorgebracht, die sowohl weltliche als auch geistliche Themen behandeln. Trotz intensiver Forschung in den letzten Jahrzehnten haben diese Werke nicht die nötige Beachtung gefunden. Der vorliegende Band zielt darauf ab, den aktuellen Stand der Forschung zur Kunst der "brevitas" und den literarischen Kleinformen im deutschsprachigen Mittelalter kritisch zu bilanzieren und deren Erschließung voranzutreiben. Die Diskussion in den 15 Beiträgen konzentriert sich auf vier zentrale Themen: die Poetik der "brevitas"; die Typen geistlicher und weltlicher Kleindichtungen vom Frühmittelalter bis zur Frühen Neuzeit; die Überlieferung dieser kleinen literarischen Formen in Handschrift und Druck sowie deren Rezeption und mediale Transformationen. Zudem werden die Ergebnisse eines Workshops zu besonderen Grenz- und Problemfällen in der Edition mittelhochdeutscher Märchen präsentiert. Der Sammelband bietet somit wichtige konzeptionelle Überlegungen zu literarischen Kleinformen und kombiniert diese mit einer Vielzahl aufschlussreicher Fallbeispiele zur Typologie, Überlieferung und Edition der Texte. Er basiert auf den Vorträgen des 24. Kolloquiums der Wolfram von Eschenbach-Gesellschaft, das im September 2014 in Rostock stattfand.